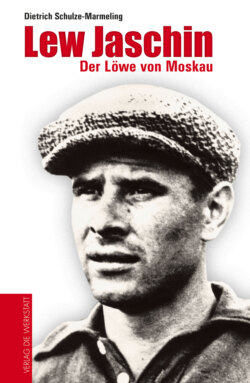Читать книгу Lew Jaschin - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
Ein schwieriger Beginn
Lew Jaschins sportliche Interessen gelten zunächst nicht nur dem Fußball. Als Junge träumt er davon, Schachweltmeister zu werden. Jaschin startet seine Fußballkarriere unter den schwierigen Bedingungen des Krieges und eines von Deutschen verwüsteten Landes. Die Laufbahn des größten Torwarts des 20. Jahrhunderts beginnt holperig. Eigentlich will Jaschin gar nicht ins Tor. Man verbannt ihn dorthin – aufgrund seiner Körpergröße. Gleichzeitig spielt er Eishockey. Als seine Torwartkarriere im Fußball Rückschläge erleidet, richtet er sein Hauptaugenmerk auf das Eishockeytor. Im kleinen Drahtkasten avanciert er zu einem der Besten seines Landes. Erst 1953, da ist Jaschin bereits 24, kann er den großen Alexander Khomich als Dynamos Nummer eins im Fußballtor beerben.
Lew Jaschin als Baby.
Die Familie Jaschin: Vater Iwan Petrowitsch, Stiefmutter Alexandra, Lew und sein jüngerer Bruder Boris.
Schach und Fußball
Lew Jaschin wird am 22. Oktober 1929 in Bogorodskoje geboren, einem Stadtteil im Osten Moskaus. Die Jaschins wohnen hier in der Nähe des Sokolniki-Parks. Es ist eine Industriearbeiterfamilie. Vater Iwan Petrowitsch arbeitet als Schleifer im Flugzeugmotorenwerk „Roter Oktober“, das in Tuschino nördlich von Moskau liegt und zum Militärproduktionskomplex Krasnij Bogatir („Roter Held“) gehört. Als Jaschin sechs ist, stirbt seine Mutter Anna Mitrofanowna an Tuberkolose. Einige Jahre später heiratet der Witwer Alexandra Petrowna, die sich nun um Lew und seinen jüngeren Bruder Boris kümmert.
Als Halbwüchsiger interessiert sich Jaschin zunächst für Volleyball und Basketball – Sportarten, in denen seine Körpergröße von Vorteil ist. Fußball entwickelt sich erst später zur sportlichen Leidenschaft Nummer eins. Obwohl er 1964 erzählt: „Ich hatte für den Fußball schon immer eine große Schwäche und begann, wie alle Kinder, auf der Wiese und im Hof.“
Der junge Jaschin hegt zunächst auch ein großes Interesse am Schachspiel. In den 1920ern war Schach zum sowjetischen Volkssport avanciert, aktiv gefördert von der Kommunistischen Partei, der KPdSU. Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin hatte erklärt: „Schach ist Gymnastik des Verstands.“ Mit dem Brettspiel soll das intellektuelle Niveau der Bevölkerung angehoben werden. Ab Ende der 1920er wird auch der Schachsport mit Fünfjahressplänen angetrieben. Starke Spieler werden vom Staat bezahlt und können sich so ganz dem Spiel widmen. Bald erfüllt das Spiel nicht nur eine gesellschaftspolitische Funktion. Sowjetische Schacherfolge sollen die Überlegenheit des sozialistischen Systems demonstrieren.
Der berühmteste Repräsentant der sowjetischen Schachschule ist der russische Jude, Literaturliebhaber und Kommunist Michail Botwinnik aus St. Petersburg, der 1948 erstmals Weltmeister wird. Seine Trainingsmethoden und sein logisch-wissenschaftlicher Spielstil beeinflussen eine ganze Generation von Schachspielern. Die Parteifunktionäre hofieren Botwinnik. Der junge Jaschin ist sein Fan und will den Champion eines Tages beerben. Für sein späteres Torwartspiel, das stark vom Antizipieren geprägt ist, ist die Beschäftigung mit dem Schach womöglich hilfreich:
Schachspieler müssen die nächsten Züge des Gegners vorausberechnen und ihre Steine zwecks Kontrolle des Raumes entsprechend verschieben. Im Fußball muss der Torwart ebenfalls die Angriffszüge des Gegners antizipieren, seine Vorderleute entsprechend dirigieren und auch seine eigene Position der Spielsituation anpassen. Der ehemalige Bundesligatrainer Felix Magath glaubt, „dass es sinnvoll ist, wenn ein Fußballer auch Schach spielt. Von dieser Beschäftigung habe ich viel für die Theorie im Fußball gelernt. (…) In jeder Situation muss man versuchen, nicht irgendeinen Zug zu machen, sondern den besten. Genauso sollte ein Fußballer, wenn er spielt, nach der besten Lösung suchen.“ Schach sei mit seinen vielen Steinen „eigentlich auch ein Mannschaftsspiel. Das Schachspiel wird erst richtig schön, wenn die Figuren gut zusammenarbeiten und nicht, wenn eine von ihnen ganz allein übers Brett spaziert.“
Auch der ehemalige Bundesligaprofi und Nationalspieler Marco Bode sieht Parallelen zwischen Schach und Fußball: „Aus der gleichen Startposition heraus wird immer wieder nach uralten unveränderten Regeln gespielt – doch nach wenigen Zügen entstehen Stellungen, die völlig neu und einmalig erscheinen. Dann begibt man sich auf die Suche nach einer Strategie, versucht seine eigenen Figuren so auf dem Schachbrett zu positionieren, dass sie in einer Weise zusammenwirken, die das plötzliche Erkennen von Kombinationen erlaubt, um die gegnerische Stellung zu ‚knacken‘. Da der Gegner merkwürdigerweise genau das Gleiche tut, entsteht ein stetiger Wechsel aus Angriff und Verteidigung. Letztlich entscheidet die bessere Strategie, die genauere Kombination, oft genug aber auch fehlende Aufmerksamkeit über Sieg oder Niederlage.“
Sibirien
Am 18. Dezember 1940 erteilt Hitler die Weisung Nr. 21 an die Wehrmacht, „auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen.“ Am 22. Juni 1941 überfallen die Deutschen mit drei Millionen Soldaten und ohne Kriegserklärung die Sowjetunion. Rumänien, Italien, die Slowakei, Finnland und Ungarn schließen sich dem Angriff an und schicken weitere 600.000 Soldaten in die Schlacht. Das „Unternehmen Barbarossa“ ist kein Krieg wie andere. Der Journalist und Autor Joachim Käppner: „Dies war ein Krieg, der nicht wie so viele vor ihm dem Gewinn von Territorien, Rohstoffen, Macht diente. Es war ein Krieg neuen Typs, in dem es keinen Ausgleich geben konnte und keinen Kompromiss und dem Angegriffenen nicht einmal Aufgabe und Kapitulation blieben, um das Schlimmste abzuwenden. Das Schlimmste war ihnen bereits vorbestimmt: die Ermordung und Versklavung ganzer Völker. Wehe den Besiegten. ‚Es handelt sich um einen Vernichtungskampf‘, hatte Hitler Kommandeuren der Wehrmacht schon im März 1941 erklärt.“ Wehrmachtsgeneral Erich von Manstein befiehlt 1941 seinen Soldaten: „Das jüdisch-bolschewistische System muss ein für allemal ausgerottet werden.“ Käppner: „Holocaust und Vernichtungskrieg gehörten untrennbar zusammen.“
In den ersten Wochen des Krieges verzeichnet die Wehrmacht gewaltige Geländegewinne. Bis Mitte Oktober machen die Deutschen nach mehreren Kesselschlachten drei Millionen Gefangene. Aber der rassistisch motivierte Überfall stärkt Stalins Stellung. Das Volk rückt an die Seite des Diktators. Schnell wird klar, dass aus einem „Blitzsieg“ nichts wird. Die Wehrmacht trifft auf einen unerwartet zähen Willen zum Widerstand. Im Dezember 1941 erleiden die Deutschen vor Moskau eine empfindliche Niederlage. Das Blatt wendet sich immer mehr zugunsten der Roten Armee. Anfang 1943 verliert die Wehrmacht die Schlacht um Stalingrad und bezahlt mit der Vernichtung ihrer sechsten Armee.
Wegen der deutschen Invasion wird die Fabrik, in der Lew Jaschins Vater arbeitet, im Herbst 1941 nach Uljanowsk an der Wolga evakuiert; daher muss die Familie Jaschin dorthin umziehen. Dem Vater bleibt dadurch die Teilnahme am „Großen vaterländischen Krieg“ erspart, denn als Spezialist in der Schleiferei ist er unersetzlich.
Im Herbst 1943 wechselt der knapp 14-jährige Lew Jaschin von der Schulbank in die Fabrik, um in der Kriegsproduktion zu helfen. Der Krieg verhindert einen formellen Schulabschluss. Er wird Schlosserlehrling an der Werkbank des Flugzeugmotorenwerkes „Roter Oktober“. Jaschin: „Als ich mit 14 Jahren, 1943, die Schule verließ, dachte niemand an Fußball. Ich war ein dünnes hungerndes Bürschchen, der Krieg hatte in Moskau die Not in allen Familien zu einem ungebetenen Gast gemacht.“
In Sibirien beginnt Jaschin mit dem Rauchen. Seine Witwe Walentina erzählte dem Autor, dass ihr Mann die ersten Glimmstengel von seinem Vater bekommen habe. „Die Männer mussten häufig an der freien Luft arbeiten. Dort war es bitterkalt. Lews Vater hatte Angst, dass sein Sohn an der Maschine vor Erschöpfung einschlafen und sich verletzen würde. Er ermunterte ihn zum Rauchen, damit er wach bleiben würde.“ Später qualmt Jaschin täglich bis zu 80 Zigaretten.
Torwart-Premiere im Krieg
Erst 1944 kehrt die Familie Jaschin nach Moskau zurück. Im selben Jahr steht Lew erstmals im Fußballtor. Bei einem Spiel zwischen den Mannschaften der verschiedenen Abteilungen des Werkes wird der Junge zwischen die Pfosten geschickt. Gegen seinen Willen. Jaschin: „Wie alle Kinder in Moskau hatte auch ich zunächst auf der Straße gekickt. Meine frühesten Erinnerungen sind die an verrückte Spiele. Ich hätte wirklich gerne als Stürmer gespielt, weil ich es liebte, Tore zu schießen, aber wegen meiner Größe und Sprungkraft war ich dazu bestimmt, Torwart zu sein. Die Chefs der Mannschaft haben mir diese Entscheidung aufgedrückt.“ Jaschin macht seine Sache gut. „Ich habe mir dann vorgenommen, kein Tor reinzulassen und mich trotzdem möglichst wenig in den Dreck zu werfen. Also habe ich mir gedacht: Das kannst du nur mit Köpfchen. Und irgendwie hat’s geklappt.“
Mit 16 bekommt er ein Magengeschwür und wird zur Kur ans Schwarze Meer geschickt. Ursache ist die schlechte Qualität der Lebensmittel, möglicherweise aber auch bereits das Rauchen. Magenprobleme werden ihn sein Leben lang verfolgen.
Derweil verliert die deutsche Wehrmacht weitere Schlachten im Osten. Am 22. Juni 1944, dem „Barbarossatag“, startet die Rote Armee eine Großoffensive, die wenige Tage später in der Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte mündet. Am 16. April 1945 beginnt der Umfassungsangriff gegen Berlin und leitet den Untergang des Nazi-Reichs ein. Am 2. Mai kapituliert Berlin. Zwei Tage später erzwingt Stalin die bedingungslose Gesamtkapitulation. In zweifacher Ausfertigung: am 7. Mai vor den Westallierten im französischen Reims, und in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai vor dem sowjetischen Oberkommandierenden in Berlin-Karlshorst. Jaschin: „Als uns am 9. Mai 1945 die Meldung vom Sieg unserer Armee über den Hitlerfaschismus erreichte, eilte ich in die Stadt. Im Zentrum sangen wir, umarmten uns. Immer wieder schrien wir: ‚Sieg! Frieden!‘ Die Freude wollte kein Ende nehmen.“
Aber sein Land bezahlt einen enormen Preis für den Sieg über den Nationalsozialismus. Ab dem 22. Juni 1941 sind in der Sowjetunion ca. 27 Millionen Menschen ums Leben gekommen, in der Mehrheit Zivilisten. Und der Verlierer hinterlässt eine verbrannte Erde. „Ansiedlungen wurden dem Erdboden gleichgemacht, Fabriken gesprengt, Schachtanlagen geflutet, Eisenbahnverbindungen unterbrochen, demontiert, unbrauchbar gemacht. Nach einer sowjetischen Verlustbilanz fielen ihr [der Strategie der ‚verbrannten Erde‘, Anmerk. d.A.] 70.000 Dörfer, 1.700 städtische Ansiedlungen, 32.000 Betriebe und Industrieunternehmen, 98.000 Kolchosen, 1.900 Sowchosen, 2.900 Maschinen- und Traktorenstationen, 765.000 km Eisenbahnverbindungen zum Opfer. 25 Millionen waren obdachlos.“ (Helmut Altrichter)
Der Jaschin-Entdecker: Arkadi Tschernischow
Nach dem Krieg ziehen die Jaschins von Sokolniki nach Tuschino, um näher am Werk zu sein. 1947 wird Lew zum Wehrdienst einberufen. Stationiert ist er in Moskau, wo er als Mechaniker bei der Luftwaffe dient. Jaschin wird nun Torwart des Luftwaffen-Teams „Flügel der Sowjets“.
Hier wird er von Arkadi Iwanowitsch Tschernischow entdeckt. Tschernischow ist keine Legende des Fußballs, sondern des Eishockeys: Als Assistenz- und Cheftrainer der sowjetischen Eishockey-Nationalelf führt er diese während seiner zwei Amtszeiten 1954–57 und 1961–72 zu vier Olympiasiegen und elf Weltmeistertiteln. Tschernischow, weltweit einer der erfolgreichsten Eishockeytrainer, begann seine Sportkarriere als Fußballer und Bandyspieler. Bandy ist ein Vorläufer des heutigen Eishockeys und entstand im Mittelalter in den Fens des englischen Ostens. Größe des Feldes, Anzahl der Spieler und Spielzeit entsprechen aber mehr den Regeln des Fußballs als des Eishockeys oder Hockeys. Außerdem wird nicht mit einem Puck gespielt, sondern mit einem kleinen Ball. Während das Spiel in Ländern mit milden Wintern allmählich verschwand bzw. komplett dem in der Halle gespielten Eishockey wich, blieb es in Russland und Schweden unverändert populär. Tschernischow wurde 1937 mit Dynamo im Sommer sowjetischer Fußballmeister und im Winter Bandy-Champion. Im Fußball feierte er diesen Triumph noch einmal 1940, im Bandy 1938, 1940 und 1941.
1945 wechselte er zum FK Dynamo Minsk, spielte aber auch noch für Dynamo Moskaus Eishockeyteam. Als im 22. Dezember 1946 die erste sowjetische Eishockeymeisterschaft angepfiffen wurde, schrieb sich Tschernischow gleich in deren Annalen ein, als er das erste Tor in der Geschichte der Liga erzielte.
Lew Jaschin beim Militär, 1948.
Zunächst denkt Jaschin (Mitte) an eine Karriere als Eishockeyspieler.
Tschernischow amtiert von 1948 bis 1975 als Cheftrainer von Dynamos Eishockey-Team. Zugleich ist er für die Fußballjunioren des Klubs verantwortlich. Der Journalist Igor Iwanow: „In den damaligen Nachkriegsjahren sah Tschernischow seine Aufgabe darin, körperlich gut entwickelte und begabte Burschen systematisch für Fußball und Eishockey zu interessieren. Er schaute bei zahlreichen Spielen von Schülerund später auch Soldatenmannschaften zu.“ Tschernischows Zöglinge sollten möglichst viele Sportarten beherrschen. Jaschin spielte außer Fußball und Eishockey auch noch Basketball und Handball.
Jaschin erzählt später über die enge Beziehung von Fußball und Eishockey in der UdSSR: „Tschernischow verlangte von jedem Fußballer, dass er auch Eishockey spielen konnte. Das hatte mehrere Gründe. 1951 hatten wir noch keine so schönen Hallen in Moskau wie jetzt, da man zu jeder Zeit Fußball spielen kann. Die Winter aber mussten auch damals genutzt werden, also spielten wir Fußballer Eishockey. Tschernischow vertrat den Standpunkt, dass dieses Spiel die Reaktionsschnelligkeit fördert, den Blick für Kombinationsmöglichkeiten schult und zur Härte erzieht.“
Über die Grenzen des Torraums hinaus
Tschernischow beobachtet Jaschin im Tor von „Flügel der Sowjets“, als es diese im Park am Chimki-Hafen mit einem anderen Armeeteam aufnehmen. Mit dabei ist Dynamo-Torwart Alexander Khomich. Auch Khomich ist von Jaschin angetan. Tschernischow lädt den 20-Jährigen zum Dynamo-Training ein. Später erzählt er darüber: „Der junge Jaschin war mir aufgefallen, weil er meiner Vorstellung von einem Torwart entsprach: groß, schlank, gute Körperbeherrschung. Mir imponierte sein Trainingseifer und die Art, wie er das Spiel auffasste – schöpferisch mitdenkend. Außerdem spielte er Eishockey – als Stürmer. Das war sehr wichtig. Denn im Angriff lernt ein junger Sportler die Taktik besser zu begreifen. Es kam der Zeitpunkt, da ich ihm vorschlug: ‚Ljowa, wenn du willst, nehme ich dich in die Juniorenauswahl.‘ Er machte zwar technisch noch viele Fehler, aber es freute mich, dass er meinen Ratschlägen aufmerksam zuhörte und sie befolgte.“ Tschernischow ermuntert Jaschin, das Torwartspiel aktiver zu interpretieren: „Ich sagte, ‚Ljowa, du spielst im Eishockey Stürmer und bist im taktischen Kombinieren gut. Versuch doch mal, nicht im Tor stehen zu bleiben, sondern über die engen Grenzen des Torraums hinauszutreten.‘ Er probierte es und hatte Erfolg.“
Der Slapstick-Keeper
1949 – nach Beendigung des Militärdienstes – wird Jaschin offiziell Dynamo-Fußballer. Hier muss er zunächst einmal eine harte Ausbildung durchlaufen. Vor allem bemüht man sich, dem „etwas steifen, langen Lulatsch“ (Iwanow) Beweglichkeit beizubringen. Jaschin misst 1,89 Meter und ist 82 Kilo schwer.
Die Ausbildung ist brutal. Iwanow: „Die Konsequenz und Zielstrebigkeit sowjetischer Trainer ist bekannt. Tag für Tag bis zu sechs Stunden Gymnastik, schwimmen, ins Wasser springen (als Mutprobe), auf der Aschenbahn laufen, springen, werfen, stoßen, im Turnsaal Gewichte stemmen, boxen, ringen, Basketball und Volleyball spielen, im Winter dann Schlittschuh laufen und skilaufen – so groß und umfangreich ist das Kapital, das sich ein Sportler für sein ganzes Leben erarbeiten muss, um später damit richtig zu wirtschaften!“ Für Jaschin kommt noch das Torwarttraining hinzu.
Im Herbst 1949 treffen im Halbfinale des Moskauer Pokals Dynamos Senioren und Dynamos Nachwuchs aufeinander. Mit Jaschin im Tor schlägt der Nachwuchs die Senioren, bei denen Khomich zwischen den Pfosten steht, sensationell mit 1:0. Wenige Monate später wird Jaschin in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen.
Seinen Start bei den Dynamo-Senioren als holperig zu bezeichnen, wäre nett formuliert. Zutreffender wäre es, von einer Katastrophe zu sprechen. 1950 hat Jaschin seinen ersten Einsatz in der B-Elf von Dynamo. Die Mannschaft befindet sich im Trainingslager in Gagry. In einem Testspiel gegen Traktor Stalingrad (heute Rotor Wolgograd) verursacht Jaschin ein Gegentor. Und was für eines. Der gegnerische Torwart schlägt den Ball ab, bis weit in die gegnerische Hälfte hinein. Der mitspielende Torwart Jaschin will vor den gegnerischen Angreifern am Ball sein, prallt aber bei seinem Ausflug mit seinem Mitspieler Jewgeni Awerianow zusammen. Beide gehen zu Boden, und der Ball trudelt ins Tor. Jaschin hatte sich nur auf den Ball konzentriert und dabei nicht registriert, dass Awerianow herangerauscht kam, um per Kopf zu klären.
Jaschin schildert später die fatale Situation so: „Zum ersten Mal bin ich damals mit der Mannschaft ins Trainingslager gefahren. Und dort war dieses unglückliche Spiel. Es war ein interessantes Spiel, gerade für mich. Es war mein erstes Spiel für die Dynamo-Mannschaft. (…) Es kam zu einer solchen Situation, dass der Torwart der gegnerischen Mannschaft direkt mir ins Tor schoss. Das war zum Lachen, aber auch bitter, bis zu Tränen. Er fing den Ball ab, trat an den Strafraum und gab einen so starken Schuss ab, dass ich loslief, mit einem Verteidiger zusammenstieß, wir fielen hin, und der Ball rollte ins Tor. Nun, die dort saßen, waren unsere Kameraden – Khomich, Karzew, Beskow, Solowjow –, sie fielen direkt von der Bank und brachen in ein lustiges Gelächter aus. Sie haben zum ersten Mal gesehen, dass ein Torwart dem anderen ein Tor reinschießt. (…) Ich hörte sie fragen, wo um alles in der Welt man diesen Torwart aufgetrieben hätte.“
„Meine Beine zitterten wie Laub“
Am 2. Juli 1950 muss sich Jaschin erstmals in der A-Elf bewähren. Dynamo spielt gegen Spartak. Auch Jaschins A-Elf-Debüt verläuft unglücklich. Eine Viertelstunde vor Schluss kommt er für Khomich aufs Feld, der sich die Schulter ausgerenkt hat. Eigentlich wäre jetzt Dynamos zweiter Torwart Walter Sanaja an der Reihe gewesen, doch dieser ist erkrankt. (Im sowjetischen Fußball durfte bereits damals ein verletzter Spieler ausgewechselt werden – allerdings nur, wenn es sich bei ihm um den Torwart handelte.) Jaschin: „Ich stand hinter dem Tor als Reservetorwart. Und da ruft mir der Trainer zu: ‚Was stehst du da rum, los, geh aufs Feld.‘ Wie sollte ich aufs Feld gehen? 50.000 Zuschauer, damals kamen noch die Menschen zum Fußball. Man liebte ihn. Ich gehe hin, aber ich kann nicht auf einem Fleck stehen. Meine Beine zittern wie Laub. Was sollte ich tun? Stehen konnte ich nicht. Ich begann im Strafraum hin- und herzugehen. Ich sehe, dass ein Ball angeflogen kommt. Ich müsste ihn nehmen, fangen. Ich lief hin, und da wuchs plötzlich Parschin empor, keiner weiß, woher er kam. Er schoss mit dem Kopf über mich hinweg, und der Spielstand war 1:1. Als wir nach dem Spiel in die Umkleidekabine kamen, erschien einer aus der Leitung und sagt: ‚Woher haben Sie einen solchen Torwart genommen? Der muss hier verschwinden, und für die A-Mannschaft ist er nicht mehr zu nominieren.‘“
Jonathan Wilson beschreibt dieses Tor etwas anders: Jaschin sei nach einer Flanke von Alexander Paramonow erneut mit einem eigenen Abwehrspieler zusammengestoßen – dieses Mal mit Wsewolod Blinkow. Dabei habe er Nikolai Parschin den Ball so vorgelegt, dass dieser nur noch abzustauben brauchte.
Ab in die Reserve
Gegen Dynamo Tiflis spielt Jaschin dann erstmals über die volle Distanz im Tor der A-Elf. Das Spiel endet 5:4 – nach einer 4:1-Führung Dynamos. Khomich: „Bei seiner zweiten Prüfung, im Treffen mit Dynamo Tiflis, versagte er absolut. Wir führten 4:1. Durch Lews fahrlässige Spielweise – er verschuldete zudem einen Elfmeter – konnte der Gegner noch drei Tore erzielen. Das Fazit: Lew wurde für zwei Jahre in die Reservemannschaft verbannt. Ich weiß heute, dass er sich in diesen Jahren das Rüstzeug für seine erfolgreiche Laufbahn holte. In dieser Situation, in der andere aufgegeben hätten, begann Lew noch verbissener an sich zu arbeiten, machte sich die Erfahrungen anderer Torleute zu eigen und fügte bereits Neues, Eigenes hinzu. So schaffte er dann, als er in die Oberliga-Elf zurückkehrte, innerhalb von zwei Jahren den Sprung zum Klassetorwart.“
Jaschin über seine vorübergehende Degradierung: „Hätte ich in dieser Phase meinen Abschied angekündigt, glaube ich kaum, dass sie [die Dynamo-Verantwortlichen, Anm. d.A.] viel Zeit darauf verwendet hätten, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber ich konnte mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Ich habe weiter hart gearbeitet, und zu meiner Überraschung haben sie mich nicht abgesägt.“
Alexander Khomich wird Jaschins zweiter Lehrmeister. Iwanow: „Zwischen den beiden Torhütern gab es eine besonders starke Bindung: Der ‚Tiger‘ hatte in Jaschin seinen Nachfolger erkannt und ihn fast zwei Jahre lang ‚aufgebaut‘. Khomich hatte Jaschins eisernen Willen und Eifer bald erkannt. Die Folge war, dass der ‚Tiger‘ von seinem Schüler nur noch mehr forderte. Denn dieser Bursche, das war ihm klar, war genau der richtige Typ, den Dynamo im Tor benötigte. Und er sollte alles beherrschen können!“
Dynamo in Ostberlin
1951 spielt Dynamo Moskau erstmals auf deutschem Boden. Anlass sind die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin. Es sind nach Prag 1947 und Budapest 1949 die dritten Festspiele dieser Art, deren Träger der „Weltbund der demokratischen Jugend“ ist. Erstes Großereignis ist ein Freundschaftsspiel der noch jungen DDR-Auswahl gegen Dynamo Moskau, das nun von Wiktor Dubinin trainiert wird. Jaschin ist als dritter Keeper mitgereist.
Das Neue Deutschland kündigt Dynamo als „das beste Team der Welt“ an. Die Gäste trainieren auf dem Paul-Zobel-Sportplatz in Pankow, benannt nach dem von den Nazis im KZ Dachau zu Tode gefolterten Kommunisten, Widerstandskämpfer und Arbeitersportfunktionär. Das Neue Deutschland berichtet: „Die mit 21 Spielern und 3 Trainern erschienenen Sowjetsportler zeigten eine kleine Probe ihres überragenden Könnens, obwohl – wie ihr Betreuer erklärte – es sich nur um ein leichtes Konditionstraining handelte. Vor dem Balltraining hatten sie bereits ihre Gymnastikübungen absolviert, wobei im Gegensatz zum Training der deutschen Mannschaft jeder Spieler seine eigene Übung ausführte.“ Für die ca. 100 Zuschauer sei es fast unmöglich gewesen, „unter den drei Torstehern Khomich, genannt ‚Tiger‘, herauszufinden, da sie sich in den tollkühnen Paraden kaum nachstanden. (…) Besonderen Eindruck hinterließ der Ernst und Eifer, mit dem die Sowjetsportler ihr Training betrieben. Niemals unterbrach einer von ihnen das Training oder beschäftigte sich auch nur wenige Minuten mit anderen Dingen.“
Das Kräftemessen mit der DDR-Auswahl findet im erst im Mai 1950 eröffneten Walter-Ulbricht-Stadion statt. Im Volksmund firmiert es bald als „Zickenwiese“, angelehnt an Ulbrichts eigenwilligen Spitzbart. (1973 wurde das Stadion nach einem Umbau als „Stadion der Weltjugend“ wiedereröffnet. Inzwischen wurde die DDR von Erich Honecker regiert. Bei der SED-Spitze war der Stalinist Ulbricht in Ungnade gefallen, weshalb sein Name aus der DDR-Öffentlichkeit getilgt wurde.)
Am Sonntag, dem 5. August, kommen 80.000 in die im Stadtbezirk Mitte gelegene Schüssel, zum größten Teil sind es Jugendliche aus 104 Ländern (einschließlich der Bundesrepublik), und sehen einen 5:1-Sieg der Dynamo-Mannschaft. Für die DDR erzielt Heinz Satrapa den Ehrentreffer: „Ich freue mich, dass ich dem berühmten ‚Tiger‘ Khomich einen Treffer in die Maschen setzen konnte.“ Das Neue Deutschland: „Die deutschen Spieler waren von der fairen Spielweise und dem hohen Niveau der sowjetischen Fußballer begeistert.“ Heinz Schoen, Mittelläufer der DDR-Auswahl: „Die Kondition der sowjetischen Freunde war überragend. Auch in der Ballführung sind sie Weltklasse. Ich hatte es sehr schwer, mich auf den überragenden Dribbelkünstler Beskow einzustellen.“ Und Hans Siegert, Trainer der DDR-Auswahl: „Die sowjetischen Sportler zeichnete ihr ausgezeichneter Kollektivgeist aus. Sie waren in ihrer Einzelleistung ebenso gut wie im Mannschaftsspiel. Hervorragend ist der Aufbau des Sturmspiels aus der Hintermannschaft heraus.“ Alfred Kunze schwärmt in der Neuen Fußball-Woche: „Wir sahen beste Fußballkunst, die in wunderbarer Weise die Zweckmäßigkeit mit der Schönheit verband. Wir sind um eine große Erfahrung und um ein großes Erlebnis reicher. Wir sprechen immer von den vier Komponenten des Fußballspiels: Technik, Taktik, Kondition, Siegeswille. Auf jedem dieser Gebiete hat uns die sowjetische Mannschaft viel gezeigt. (…) Wir – unsere elf Spieler und auch alle sachkundigen Zuschauer – wissen jetzt, was das Spiel ohne Ball bedeutet.“ Aber Dynamo ist nicht nur sportlich eine Sensation, sondern mit den knielangen Hosen und blauen Trikots mit dem geschwungenen silbernen „D“ auch modisch eine Klasse für sich – jedenfalls im Osten.
Fünf Tage später misst man sich erneut, und erneut schauen 80.000 zu. Diesmal gewinnt Dynamo „nur“ mit 2:0. Die DDR-Nationalelf verkauft sich gut, findet aber bei ihren blitzschnellen Kontern in Khomich ihren Meister. Ein Teil des Publikums verhält sich nicht im Sinne der Weltfestspiele, indem es frenetisch das heimische Team anfeuert, was der sozialistische Verhaltenskodex und die brüderliche Verbundenheit mit der UdSSR nicht vorsieht. Das Neue Deutschland: „Ein Teil der Zuschauer zeigte sich nicht auf der Höhe des schönen, fairen und kämpferischen Spiels und nahm am Spielgeschehen in völlig einseitiger Weise Anteil. Damit bewiesen sie nur, dass sie die alte üble nationalistische Überheblichkeit noch immer nicht überwunden haben. Sie zeigten, dass ihnen das Bewusstsein von den elementarsten Pflichten eines Gastgebers abgeht. Dies wiegt umso schwerer, als es jedem Deutschen eine selbstverständliche nationale Pflicht sein sollte, sich des großen Vertrauens der Jugend der Welt und vor allem des großen Sowjetvolkes würdig zu erweisen.“
Puck statt Ball
In Dynamos Fußballhierarchie kommt Jaschin an Khomich und Walter Sanaja vorerst nicht vorbei, weshalb Eishockey seine Hauptbeschäftigung wird. Tschernischow: „Die Stammtorhüter der Dynamo-Klubmannschaft stellten seinerzeit Extraklasse dar, Khomich u. a., so dass Jaschin zunächst nicht zum Zuge kam. Ich beeilte mich nicht, ihn ‚anzubieten‘. Ließ ihn Eishockey spielen – nun auch hier im Tor. Er entpuppte sich als großartiger letzter Mann, und binnen ein paar Wochen war er die Nummer eins in der Mannschaft.“
Zwei Winter, 1951/52 und 1952/53, hütet Jaschin den kleinen Drahtkäfig des Eishockeyteams. Am 6. März 1953 wird Dynamos Eishockeyteam mit Jaschin im Tor sowjetischer Pokalsieger. Die Meisterschaft beendet Dynamo als Dritter. Jaschin wird später dazu eingeladen, mit dem sowjetischen Nationalteam zur Eishockeyweltmeisterschaft 1954 nach Stockholm zu fahren. Es ist das erste WM-Turnier, bei dem die UdSSR dabei ist. Und auch das erste, das sie als Weltmeister beendet. Mit der WM 1954 löst die Sowjetunion Kanada als dominierende Eishockey-Macht ab – ohne Jaschin im Tor, aber mit Arkadi Tschernischow als Trainer. Tschernischow 16 Jahre später, anlässlich des 40. Geburtstags von Jaschin: „Ich bin überzeugt, dass Lew, wäre er beim Eishockey geblieben – 1953 war er da unser bester Torwart – eine ebenso großartige Entwicklung genommen hätte. Lew war ein seltenes Talent, das vom Dynamoklub unterstützt und gefördert wurde.“ Der Ausflug aufs Eis ist nicht umsonst: Für Jaschin war „das Eishockey-Intermezzo eine gute Schule. Hier erwarb ich Kühnheit, schnelle Reaktion.“
Aber ebenfalls 1953 verkündet der nun 33-jährige Khomich seinen Rücktritt. Der „Tiger“ geht zunächst zu Spartak Minsk. Nach dem Ende seiner Karriere wird er Sportfotograf für Sowjetski Sport und fährt in dieser Funktion zu den WM-Turnieren 1970, 1974 und 1978.
Am 2. März 1953, vier Tage bevor Jaschin mit Dynamo den Pokal im Eishockey holt, feiert er im heimischen Stadion gegen Lokomotive Moskau eine gelungene Rückkehr ins Tor der ersten Fußballmannschaft. Er entscheidet sich nun komplett für den Fußball. Tschernischow: „Leider wechselte er die Zunft. (…) Die Liebe zum Fußball war größer. Es kam die Zeit, wo sich die Fußballtrainer wieder auf Lew besannen. Es machte großen Spaß, mit ihm zu arbeiten, und ich freue mich, dass ich ihn zur Liebe zum Fußball und zum Eishockey erzogen habe.“ Jonathan Wilson ist überzeugt: „Wäre Khomich noch ein weiteres Jahr länger geblieben, hätte die Entscheidung auch gut andersherum ausfallen können.“
Jaschin wird Dynamos neue Nummer eins – vor Walter Sanaja, der 1946 von Dynamo Tiflis zum Namensvetter in Moskau gestoßen war. Sanaja ist vier Jahre älter als Jaschin, misst aber auch zehn Zentimeter weniger. 1953 macht Jaschin 13 Ligaspiele und gewinnt im Herbst mit Dynamo den Pokal. In diesem Jahr wurde er somit zweifacher Pokalsieger: als Eishockeyspieler und als Fußballer. Anschließend will ihn sein Trainer nicht mehr auf dem Eis sehen, weil er um die Knochen seines neuen Stars fürchtet. Sanaja, der immer weniger Einsätze bekommt, wechselt 1954 zurück nach Tiflis und lässt anschließend seine Karriere bei Neftjanik Baku ausklingen. Seine Tochter Marina ist als Eiskunstläuferin bei den Olympischen Winterspielen 1972 dabei.
Jaschin ist nun de facto Profi. Walentina Jaschina: „Als Fußballspieler hat Lew natürlich nie gearbeitet. Die Spieler waren zwar offiziell keine Berufsspieler. Sie waren formal bei Ministerien und staatlichen Unternehmen angestellt. Am Ende seiner Karriere war Lew Oberst im Innenministerium. Er nahm an offiziellen Feiern des Ministeriums teil, aber einen Dienst hat er dort nicht verrichtet.“
In der Bundesrepublik Deutschland sind zu dieser Zeit auch die Besten der Besten nur sogenannte Vertragsspieler. Sie müssen einen Beruf ausüben, und ihre monatlichen Gehälter dürfen zunächst 160 DM, später 320 bzw. 400 DM (1958) nicht überschreiten. Der deutsche Oberligaspieler kann von den Trainingsbedingungen, der Rundumversorgung und Entlohnung eines Dynamo-Akteurs nur träumen. 1952 berichtet der Spiegel: „‚Dynamo‘, der Sportclub des sowjetischen Innenministeriums, hat ein eigenes Stadion mit Schwimmbad, Gaststätte, Tennishalle und Kino. Die Wohnungen aller ‚Verdienten Sportler‘ des Clubs liegen im Stadiongelände. Im Sommer wie im Winter fahren die Aktiven in ein clubeigenes Krim-Sanatorium. Die Spitzensportler arbeiten nur dem Scheine nach. Ihr Gehalt schwankt zwischen 3.000 und 4.000 Rubel im Monat (1 Rubel ca. 1 DM), einschließlich der Prämien für jedes Spiel. Für Reisen gibt es nur das Flugzeug.“