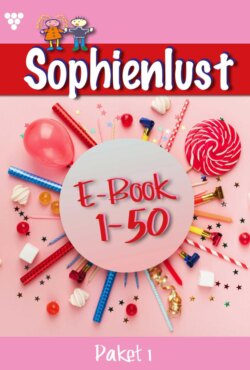Читать книгу Sophienlust Paket 1 – Familienroman - Diverse Autoren - Страница 26
ОглавлениеDer Junge zerrte seine Mutter zum Schaufenster. »Das Auto will ich haben«, verlangte er.
Franziska Fellmann seufzte in sich hinein. »Du hast schon so viele Autos, Michael. Wir müssen jetzt Nele von der Schule abholen.«
Michael stampfte wütend mit dem Fuß auf. »Ich will das Auto aber haben, oder habt ihr auch kein Geld mehr wie die Winzers?«
In diesem Augenblick erwachte in Franziska Fellmann eine Idee, aber noch war sie zu vage, als dass sie ernsthaft darüber nachdenken konnte.
»So viel Geld, wie du dir denkst, haben wir auch nicht«, sagte sie nur.
Entgeistert sah er seine Mutter an.
»Warum nicht?«, fragte er.
»Das erkläre ich dir zu Hause. Jetzt holen wir Nele ab.«
Es mochte seine Verblüffung sein, dass ihm ein Wunsch abgeschlagen wurde, die ihn schweigen ließ. Obgleich erst knapp sechs Jahre alt, war Michael Fellmann ein sehr aufgeweckter, wenn auch maßlos verwöhnter Junge.
Wie verwöhnt er und seine Schwester Cornelia waren, war Franziska Fellmann erst in letzter Zeit so recht bewusst geworden und es stimmte sie sehr nachdenklich. Sie wollte sich gleich heute einmal mit ihrem Mann eingehend darüber unterhalten.
Cornelia, bereits acht Jahre, stand ihrem Bruder an Eigensinn nichts nach.
»Erst will ich ein Eis, bevor wir heimfahren«, forderte sie kategorisch. »Michael hat bestimmt auch eins bekommen.«
»Er hat keins bekommen«, erklärte Franziska Fellmann energisch. »Vor dem Essen gibt es kein Eis mehr, dann habt ihr nie Appetit.«
»Du bist heute vielleicht ätzend«, stellte Cornelia fest.
Das harte Wort ging Franziska durch und durch. War sie nur heute besonders hellhörig, oder hatte sie den Kindern zu viel nachgesehen, fragte sie sich.
»Gut, dann bin ich ätzend«, erwiderte sie betont. »Solche Ausdrücke möchte ich in Zukunft nicht mehr hören, Nele.«
»Mutti nörgelt heute dauernd«, quengelte Michael. »Das Auto, das ich haben wollte, hat sie mir auch nicht gekauft.«
»Ihr wollt nur immer. Das Wort ›Bitte‹ kennt ihr wohl gar nicht mehr.«
Michael stieß seine Schwester an und schnitt eine Grimasse. Franziska sah es wohl, sagte aber nichts. Viele Dinge gingen ihr durch den Sinn, die durch das Gespräch, das die beiden nun miteinander führten, noch tiefer in ihrem Bewusstsein Fuß fassten.
»Jetzt hat Rosi den Salat«, sagte Cornelia. »Nun muss sie in ein Heim. Jetzt kann sie nicht mehr angeben mit ihrem tollen Auto und der Villa, die viel schöner wäre als unsere. Das geschieht ihr ganz recht.«
»Weil ihr Vater so krank geworden ist?«, fragte Franziska betroffen nach. Wie gefühllos die Kinder waren. Ihre Kinder! Ihre Hände wurden ganz kalt.
»Was würdet ihr sagen, wenn unser Vati so krank werden würde?«, fragte sie beklommen.
»Ach, Vati wird doch nicht krank«, erklärte Michael wegwerfend. »Der treibt so viel Sport. Der ist kerngesund.«
Herr Winzer hatte auch einen kerngesunden Eindruck gemacht. Und als Generalvertreter hatte er sehr viel Geld verdient. Aber nun zehrte seine schleichende Krankheit nach und nach das Vermögen auf. Franziska wusste es sehr gut, weil ihnen das schöne Haus der Winzers zum Kauf angeboten worden war.
Nein, ihr Mann war nicht krank, und an Geldmangel hatten sie auch nicht zu leiden. Aber sie hatten sich ihr Geld hart verdienen müssen. Nichts war ihnen in den Schoß gefallen. Und diese beiden verwöhnten Rangen taten so, als wäre es das selbstverständlichste von der Welt.
Gewiss war das auch ihre Schuld. Sie hatten ihnen immer jeden Wunsch erfüllt, doch immer öfter sollte ihr bewusst werden, dass sie ihnen damit keinen Gefallen tat.
»Wir haben eine Neue gekriegt«, erzählte Cornelia. »Die hat vielleicht ein schäbiges Kleid an. Aber lauter Einser hat sie im Zeugnis und wir sollen uns ein Beispiel an ihr nehmen, hat Rektor Schneider gesagt. Pah, was nützen ihr die Einser, wenn sie so schäbig rumläuft.«
»Haben sie eigentlich immer so geredet«, fragte sich Franziska Fellmann wieder. »Und wenn es so ist, warum habe ich dann früher nicht darüber nachgedacht?«
War es ihr erst durch das Unglück der Winzers, die in ihrer nächsten Nachbarschaft wohnten, bewusst geworden, dass man sich seines Wohlstands nicht zu sicher fühlen sollte? Sie war doch gar nicht so veranlagt, dass sie ihren wachsenden Reichtum herauskehrte. Und ihr Mann erst recht nicht. Er arbeitete in seinem Großhandel noch immer von früh bis spät.
»Zu meinem Geburtstag lade ich zwanzig Kinder ein«, erklärte Cornelia mit aller Selbstverständlichkeit.
»Ohne mich vorher zu fragen?«, äußerte sich Franziska Fellmann.
»Du hast doch nie was gesagt«, murrte das Mädchen.
»Zwanzig Kinder hast du auch noch nie einladen wollen.«
»Wir sind reiche Leute, das können die alle ruhig ’mal wissen«, meinte sie altklug.
»Wo hat denn die blöde Gans wieder meine Turnschuhe hingestellt«, brüllte Michael durch das Haus, nachdem er nach langem Mäkeln endlich gegessen hatte.
Mit der »blöden Gans«, meinte er das Hausmädchen Erika, mit der Franziska Fellmann sehr zufrieden war.
Diese erschien auch sogleich mit zornrotem Gesicht. »Das lasse ich mir nicht mehr bieten, Frau Fellmann«, erklärte sie. »Die Kinder werden immer unverschämter. Ich finde auch eine andere Stellung.«
Franziska versuchte, sie zu beschwichtigen, aber schon mischte sich Michael wieder ein.
»Schmeiß sie doch raus!«
»Sie ist doch bloß ein Trampel vom Land«, gab auch Cornelia ihren Kommentar dazu.
Franziska packte blankes Entsetzen. In ihrer Empörung holte sie aus und versetzte jedem der Kinder eine schallende Ohrfeige.
Zuerst waren sie stumm vor Schrecken, dann fingen sie an, so fürchterlich zu schreien, als würden sie am Spieße stecken.
»Was ist hier los?«, fragte Albrecht Fellmann, der gerade nach Hause kam.
»Mutti ist ganz gemein zu uns«, schrieen die beiden im Duett. »Sie hat uns sogar gehauen und alles nur wegen dieser dummen Ziege.«
»Sag jetzt nichts, Albrecht«, bat Franziska Fellmann. »Ich muss dich unbedingt sprechen. So geht es nicht weiter.«
Er drehte sich zu den Kindern um. »Ihr haltet den Mund, sonst bekommt ihr von mir auch noch den Hosenboden voll.«
Er merkte, dass seine Frau aufs höchste erregt war, und sie war ihm doch wichtiger als seine ungezogenen Rangen, die auch ihm manchmal beträchtlich zu schaffen machten.
»Wenn wir nicht andere Saiten aufziehen, Albrecht, wachsen sie uns noch über den Kopf«, stellte Franziska Fellmann niedergeschlagen fest. »Ich will, ich will, etwas anderes hört man nicht mehr von ihnen. Erika wird uns auch davonlaufen, wenn sie von diesen ungezogenen Gören weiterhin so beschimpft wird. Ich mache mir schwere Vorwürfe.«
»Waren sie nicht immer so?«, fragte er nachdenklich.
»Ich weiß nicht. Da waren sie noch kleiner und alles klang so putzig. Man hat darüber gelacht. Aber jetzt werden ihre Ansprüche immer größer und maßloser. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Wir haben unsere Existenz doch auf einer soliden Grundlage aufgebaut.«
»Und mit sehr viel Arbeit«, nickte er.
»Aber so, wie sie eingestellt sind, werden sie alles verjubeln. Ich habe Fehler gemacht, Albrecht. Ob sie noch gutzumachen sind?«
»Dann habe ich genauso viel Schuld«, bemerkte er, »und wir müssen gemeinsam einen Weg finden, um sie in vernünftige Bahnen zu leiten. Aber wie? Das wird nicht so leicht sein.«
»Sie haben nicht mal Mitgefühl mit der kleinen Rosi Winzer. Sie spotten noch darüber, weil sie jetzt nicht mehr auf so großem Fuße leben können.«
»Dann müssten wir ihnen vielleicht klarmachen, dass wir uns auch nicht alles erlauben können«, stellte er nach einem langen Schweigen fest. »Wir wollen erst mal in Ruhe darüber schlafen, Franzi. Natürlich will ich auch, dass sie nicht lebensuntüchtige Menschen werden.«
»Und ich werde mich mal um Frau Winzer kümmern. Ich schäme mich richtig, dass ich auch so gedankenlos bin.«
»Tu das«, nickte er. »Wegen des Hauses habe ich schon mit ihr verhandelt.«
»Und?«
»Ich habe ihr eine größere Anzahlung geboten und den Rest auf Leibrente, damit sie eine Sicherheit hat. Man gewöhnt sich leicht an ein sorgenfreies Leben, Franzi, aber wenn man die Ansprüche zurückschrauben muss, ist es ein hartes Erwachen.«
»Das soll uns nicht passieren«, murmelte sie. »Wir werden unsere Ansprüche schon beizeiten zurückschrauben, meinst du nicht?«
Er tätschelte ihre Wange. »Du bist ja so bescheiden geblieben, Liebes. Darüber kann ich mich wirklich nicht beklagen. Die Kinder haben wir halt zu sehr verwöhnt, aber vielleicht finden wir noch einen Ausweg.«
*
Elisabeth Winzer war nicht so bescheiden geblieben wie Franziska. Sie war eine hübsche Frau, die sich immer nach der neuesten Mode gekleidet hatte, die zweimal in der Woche zum Friseur gegangen war, die jedes Jahr einen neuen Sportwagen fuhr und die teuersten Pelze trug.
Damit war es vorbei und geblieben war eine Frau, die mit dem Schicksal haderte.
Sie brach auch gleich in Tränen aus, als Franziska Fellmann kam, und erklärte schluchzend, dass sich ja nun schon lange niemand mehr um sie kümmerte.
Franziska fühlte sich unbehaglich und rang sich tröstende Worte ab.
»Das soll ja kein Vorwurf für Sie sein, liebe Frau Fellmann«, erklärte Elisabeth Winzer, die sich in den guten Zeiten gernhatte Bess nennen lassen.
»Neun Monate ist mein Mann nun schon krank, und Tag für Tag schneien mir nur Arzt- und Krankenhausrechnungen ins Haus. Ich bin Ihrem Gatten ja so dankbar, dass er mir ein so großzügiges Angebot für das Haus gemacht hat. Die anderen wollten mich ja alle übers Ohr hauen.«
Es war wirklich ein herrliches Haus, aber bei der kostbaren Ausstattung, die auch einen Swimmingpool im Keller einschloss, hatten sie sich wohl doch ein wenig übernommen. Gut, wenn Herr Winzer nicht krank geworden wäre, wäre die Belastung tragbar gewesen. Aber nun hatte er keinen Verdienst mehr und seine Lebensversicherung wurde erst fällig, wenn er einmal die Augen schloss. Dass er zum Sterben verurteilt war, hatte sich bereits herumgesprochen, und wenn Franziska früher auch manches an Elisabeth Winzer auszusetzen gehabt hatte, jetzt empfand sie doch tiefes Mitgefühl mit dieser noch so jungen und einstmals lebenslustigen Frau.
»Ich möchte vor allem nicht, dass unsere Kinder erfahren, dass mein Mann dieses Haus gekauft hat«, erklärte sie eindringlich.
»Aber warum denn nicht?«, fragte Frau Winzer staunend.
»Weil sie ohnehin schon maßlos arrogant sind«, erwiderte Franziska ehrlich. »Sie denken viel zu materiell.«
»Das war bei Rosi auch so, aber nun wird sich ihr und unser Leben zwangsweise völlig ändern«, sagte Frau Winzer leise. »Mein Mann wird nicht mehr gesund. Ich habe mich entschlossen, Rosi in ein Kinderheim zu geben. Es ist ein sehr schönes Heim. Können Sie sich noch an Frau Rennert erinnern, die früher einmal vorübergehend den Kindergarten hier geleitet hatte? Sie ist jetzt dort in Sophienlust Heimleiterin geworden. Ich habe es mir vorige Woche mit Rosi angesehen, und seither ist meine Kleine gar nicht mehr so traurig, dass sie in ein Heim soll. Für mich ist alles ohnehin schlimm genug. Es ist so schrecklich, wenn man nichts anderes mehr tun kann, als warten. Hoffen kann ich ja schon lange nicht mehr. – Man sollte eben doch früher daran denken, was alles passieren kann. Aber wer denkt schon daran, wenn es einem gut geht.«
Worte, über die es sich nachzudenken lohnte. Franziska Fellmann beschäftigte sich auf dem Heimweg noch damit. Gut Sophienlust! Frau Winzer hatte ihr noch ausführlich davon erzählt.
Wenn man nun auch Nele und Michael für eine Zeit in ein solches Kinderheim gab, wo sie ihren Hochmut verlieren konnten?
Es war ihr ein schmerzlicher Gedanke, sich von ihnen zu trennen, aber wenn es zum Besten für sie war, sollte es überlegt werden.
*
Mit dieser Andeutung konnte sie Erika auch bewegen, von ihrer Kündigung Abstand zu nehmen.
»Gut täte es den beiden schon, wenn sie es mal lernen müssen, sich anzupassen und nicht nur kommandieren können«, meinte die treue Seele unverblümt. »Sie tanzen Ihnen ja auch schon auf der Nase herum, ohne dass Sie es merken.«
Immer wieder sprach Franziska es mit ihrem Mann durch, ohne einen endgültigen Entschluss fassen zu können. Aber dann gab eine für sie recht bittere Stunde doch den Ausschlag. Sie wurde zum Klassenlehrer von Cornelia bestellt.
»Es tut mir leid, dass ich es Ihnen sagen muss, Frau Fellmann, aber Cornelia ist ein Unruhestifter in dieser Klasse. Alle Kinder will sie unterjochen und wird in einem Maße ausfallend, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht, dass sie kaum zu bändigen ist. Ich kann auch nicht dulden, dass sie die Kinder aus bescheidenen Verhältnissen wie Dreck behandelt. Zudem entsprechen ihre Leistungen in keiner Weise dem Klassendurchschnitt. Sie meint, sie hätte es als Tochter eines reichen Vaters nicht nötig zu lernen. Dabei ist sie intelligent genug.«
Wenn Michael erst zur Schule kam, würde sie wahrscheinlich noch Schlimmeres zu hören bekommen, denn er protestierte jetzt schon überaus renitent gegen seine Einschulung.
An diesem Tag fasste Franziska Fellmann den Entschluss, sich mit Frau von Schoenecker, der Besitzerin des Gutes Sophienlust, in Verbindung zu setzen. Sie bat um ein ganz persönliches Gespräch.
So schwer es ihr auch fiel, sie legte die Karten ganz offen auf den Tisch.
»Es ist doch wohl ein Armutszeugnis, das wir uns ausstellen müssen, aber wir werden unserer beiden Rangen nicht mehr Herr«, erklärte sie. »Und wenn ich diese braven Kinder hier sehe, weiß ich nicht, ob ich Ihnen überhaupt das zumuten kann, unsere beiden aufzunehmen.«
»Wir sind schon mit manchen schwierigen Kindern fertig geworden«, erwiderte Denise von Schoenecker freundlich. »Rosmarie Winzer hat sich auch sehr rasch eingelebt. Wenn ich Ihnen damit helfen kann, wollen wir es auf einen Versuch ankommen lassen. Wir pflegen zwar keinen militärischen Drill, aber parieren müssen sie schon.«
Begeistert von dem wunderschönen Anwesen, gestärkt durch das freundliche Entgegenkommen, das man ihr entgegengebracht hatte, kehrte Franziska Fellmann zurück.
»Das geht aber nicht, dass du ohne uns wegfährst«, wurde sie von Michael empfangen. »Was hast du uns mitgebracht?«
»Gar nichts«, erwiderte sie ruhig. »Es wird sich bei uns manches ändern.«
Ungewohnt ernste Worte bekamen Cornelia und Michael zu hören. »Ihr denkt immer, wir können das Geld nur so aus dem Ärmel schütteln«, sagte sie, »aber Vati muss sehr hart dafür arbeiten. Und weil es ihm zu viel wird, werde ich ihm künftig im Geschäft helfen.«
»Und wir?«, fragten sie bestürzt.
»Ihr kommt in ein Kinderheim und zwar in das Gleiche, wo Rosi Winzer ist.«
»In ein Heim für arme Kinder?«, fragte Cornelia empört.
»Es ist kein Heim für arme Kinder, es ist ein schönes Heim für alle Kinder.«
»Aber Rosi wird sich ins Fäustchen lachen und denken, dass wir nun auch kein Geld mehr haben«, meinte Cornelia, während Michael seine Mutter noch immer stumm und entgeistert anstarrte.
»Sie wird sich nicht ins Fäustchen lachen«, widersprach Franziska. »Sie hat nämlich schon gelernt, dass man nicht alles haben kann, was man haben will.«
»Du willst mich ja bloß wegschicken, weil der blöde Lehrer so geklatscht hat«, begehrte Cornelia auf.
Franziskas Miene wurde streng. »Für euch sind alle Menschen, die nicht das tun, was ihr wollt, blöd und dämlich und was weiß ich. Aber ihr werdet in eurem Leben noch sehr oft auf solche Menschen angewiesen sein.«
Michael schob die Unterlippe vor. »Dann geh ich eben in das Heim. Dann brauche ich wenigstens nicht zur Schule.«
»Das wird dir dort auch nicht erspart bleiben. In die Schule musst du trotzdem«, wurde er von seiner Mutter belehrt.
Ihm hatte es die Stimme verschlagen. »Warum bist du eigentlich so böse mit uns, Mutti?«, fragte er dann nach einer Weile doch recht kleinlaut.
»Weil es mich sehr kränkt, dass ihr jetzt so oft so böse Worte aussprecht. Nehmen wir mal Erika. Sie sorgt für euch, sie macht euch das Frühstück, putzt eure Schuhe, wäscht eure Sachen und soll sich dann auch noch gefallen lassen, von euch beschimpft zu werden? Denkt einmal darüber nach. So klein seid ihr nicht mehr.«
»Ich bin aber noch klein«, begehrte Michael auf. »Ich gehe noch nicht in die Schule.«
»Auf einmal. Sonst redest du doch schon so supergescheit daher.«
*
»Mutti ist wirklich böse«, sagte Michael bedrückt zu seiner Schwester, als sie allein waren.
»Ich bin auch böse«, erwiderte sie grollend. »Ich will nicht in ein Heim. Dann esse ich einfach nichts und werde krank. Ich werde es ihnen schon zeigen.«
Diesmal war Michael vorsichtiger. »Wenn man nichts isst, muss man sterben, wie unser Kanarienvogel.«
»Warum wollen sie uns ausgerechnet in das Gleiche Heim schicken wie Rosi, wenn wir schon wegmüssen«, überlegte Cornelia. »Na, sie werden es sich schon noch überlegen. Ich sage es Vati schon, dass ich es ungerecht finde.«
»Warst du in der Schule wirklich böse?«, erkundigte sich Michael.
»Pöh – ich spiele bloß nicht mit den Armeleutekindern. Das hat Rosi auch nicht getan. Frau Winzer hat immer gesagt, dass wir Unterschiede machen sollen.«
»Aber sie haben nun auch kein Geld mehr. Vielleicht haben wir auch keins mehr, und Mutti sagt es uns bloß noch nicht«, vermutete Michael. »Sie schicken uns weg, damit wir nicht merken, wenn unser Haus verkauft wird und so.«
Cornelia bekam kugelrunde Augen. »Dann will ich lieber weg, sonst lachen sie mich in der Schule auch aus.«
»In so ’nem Heim kann es vielleicht ganz schön sein«, versuchte Michael sie zu trösten.
»In einem Heim sind nur Waisenkinder, die kein Geld haben«, stellte Cornelia hochtrabend fest. »Wir haben aber Eltern.«
»Vati ist gekommen«, flüsterte Cornelia. »Jetzt reden sie bestimmt darüber. Ich gehe mal ein bisschen lauschen.«
»Ich lausche nicht«, erklärte Michael.
»Dann lässt du es eben bleiben.«
*
»Nun, hast du mit ihnen gesprochen?«, fragte Albrecht Fellmann seine Frau.
»Sehr ernsthaft sogar.«
»Was haben sie gesagt?«
»Du kennst sie ja. Ich habe ihnen erklärt, dass ich dir helfen müsste im Geschäft. Na ja, irgendetwas musste ich doch anführen.«
Das bekam Cornelia glücklicherweise nicht mit, aber dann hörte sie, das Ohr an das Schlüsselloch gepresst, fast jedes Wort.
»Was kostet dieses Heim eigentlich?«, fragte Albrecht Fellmann.
»Das liegt im eigenen Ermessen. Es gibt Unterschiede, und das finde ich sehr schön. Wir werden natürlich einen angemessenen Preis bezahlen. Das ist es mir wert.«
»Aber das brauchen unsere Rangen doch nicht zu wissen. Ich möchte nicht, dass sie sich den andern wieder überlegen fühlen. Sprechen wir lieber später weiter«, fuhr er fort. »Vielleicht lauscht einer.«
Cornelia trat darauf schnell den Rückzug an. Aber eigentlich hatte sie gehört, was sie hören wollte.
Man bezahlte einen angemessenen Preis dafür. Arm konnten ihre Eltern also nicht sein. Sie erzählte es Michael sofort.
»Sie wollen bloß nicht, dass wir es wissen«, erklärte sie triumphierend. »Verrat dich nicht. Wenn wir zahlen, haben wir es auch besser als die anderen.«
»Aber vielleicht müssen Vati und Mutti dafür unser schönes Haus verkaufen«, vermutete Michael kleinlaut.
»Ob ich Erika mal frage?«, überlegte Cornelia.
»Ach, die ist doch sauer, weil wir sie angeschimpft haben.«
»Wenn ich aber ganz nett mit ihr bin?«
»Versuch’s doch mal«, meinte er zögernd.
Ganz schüchtern schlich sich Cornelia in die Küche. »Erika?«, begann sie tastend.
»Was willst du denn?«, fragte diese leicht erstaunt.
»Bist du noch wütend auf uns?«
»So schnell legt sich das bei mir nicht«, kam die Erwiderung.
»Hat Mutti schon was zu dir gesagt, ob du bleiben kannst?«
»Ich kann gehen, wann ich will und wohin ich will. Ich finde immer eine Stellung«, erwiderte Erika selbstbewusst. »Ich brauche mich nicht tyrannisieren zu lassen. Ich bin nur gespannt, wie lange es die nächste aushält mit euch.«
»Wir kommen doch in ein Heim«, raunte Cornelia. »Weißt du das noch nicht?«
»Steht es schon fest?«, fragte Erika interessiert.
»Ich glaube schon. Weißt du, wie so ein Heim aussieht?«
»Nein. Ich war in keinem. Aber zu Hause durfte ich nicht solche Sprüche riskieren wie ihr, das kann ich euch versichern. Da habe ich gleich rechts und links eine gefegt gekriegt.«
»Mutti hat uns neulich auch Ohrfeigen gegeben«, erklärte Cornelia beleidigt. »Nur deinetwegen.«
»Nur weil ihr unverschämt ward«, stellte Erika fest. »Sie hätte das schon früher machen sollen.«
Zu Cornelias großem Bedauern wurde ihr Gespräch unterbrochen. Ihre Mutter betrat die Küche.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie Cornelia verwundert.
»Ich rede mit Erika. Wenn wir nun lieb mit ihr sind, dürfen wir dann hierbleiben?«
»Nur nicht weich werden«, redete sich Franziska Fellmann ins Gewissen. Wenn ich jetzt nachgebe, nützen sie es wieder schamlos aus. Es brauchen ja nur ein paar Wochen zu sein. Das hoffte sie wenigstens. Lange wollte sie sich von ihren Kindern nicht trennen, aber zugleich hoffte sie auch, dass sie eine heilsame Lehre bekommen würden.
»Nein, ich habe euch in Sophienlust schon angemeldet«, erklärte sie entschlossen. »Vati braucht meine Hilfe.« Sie klammerte sich an diese Notlüge, weil alle Vorsätze ins Wanken gerieten, als Cornelias Augen sich mit Tränen füllten.
*
»Ob es gut ist, zwei so verwöhnte Rangen hier aufzunehmen?«, fragte Alexander von Schoenecker seine Frau.
»Du weißt doch, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Sophienlust soll allen Kindern das Gefühl geben, in einer harmonischen Gemeinschaft aufzuwachsen. Warum sollen es nur Waisenkinder sein? Ich bewundere Frau Fellmanns Mut, sich von ihren Kindern zu trennen. Leicht fällt es ihr bestimmt nicht. Aber sie tut es zu ihrem Besten. Es wäre gut, wenn auch andere Eltern so viel Einsicht hätten. Gerade solche, die des guten etwas zu viel getan haben. Wir wissen doch zur Genüge, dass es keinem Kind bekommt, wenn ihm alles nachgesehen wird. Und im Elternhaus fehlt es am Ende doch an der Konsequenz.«
»Wie weise du daherredest«, neckte er sie.
»Stimmt es nicht, Alexander? Sind wir denn konsequent? Unsere Kinder lernen den Gemeinschaftsgeist doch auch nur, weil sie ständig in Sophienlust sein können. Es ist viel leichter, fremde Kinder zu erziehen, als die eigenen.«
»Wie recht du hast, mein Liebes.«
»Wir brauchen nur Henrik anzuschauen. Er wird verhätschelt und verwöhnt.«
»Er ist noch ein Baby. Wenn er erst laufen und reden kann, wird er auch mit den anderen in Sophienlust herumtollen und sich einfügen. Diese kurze Spanne können wir unser Kind doch genießen, Denise?«
»Meinst du nicht, dass sich die großen zurückgesetzt fühlen?«, fragte sie leise. »Vielleicht sagen sie es nicht, aber können wir in sie hineinschauen?«
Er nahm sie zärtlich in die Arme. »Ich denke, dass wir unsere Kinder gut genug kennen. Zuerst wollten sie auch eine kleine Familie, aber jetzt sind sie froh, wenn sie in Sophienlust sein können. Manchmal meine ich, unsere Kinder haben es so gut wie keine anderen, Denise. Sie haben die Eltern, die sie sich wünschen, ihr Zuhause und dabei auch noch die Gemeinschaft, in der sie die anderen so richtig verstehen lernen. Jedenfalls werden sie niemals Snobs werden, weil sie sehr früh begriffen haben, dass Besitz und Reichtum wundervolle Geschenke des Schicksals sind, denn sie haben beizeiten gelernt, es zu teilen.«
»Dann solltest du eigentlich keine Einwände mehr erheben, die Fellmann-Kinder bei uns aufzunehmen«, meinte sie.
»Habe ich denn Einwände erhoben?«, wunderte er sich.
»Ich habe es so aufgefasst«, erwiderte sie lächelnd.
»Dann muss ich mich wohl falsch ausgedrückt haben«, brummte er.
*
»Na, Rosi, warum machst du denn ein so trauriges Gesicht?«, fragte Frau Rennert das kleine Mädchen.
»Warum kommen denn Nele und Michael nach Sophienlust?«, erkundigte sich die Kleine schüchtern. »Sie werden mich wieder ärgern, weil wir kein Geld mehr haben.«
»Das werden sie hübsch bleiben lassen«, erwiderte Frau Rennert.
»Ich kenne sie aber. Ich weiß, wie sie sind. Jetzt habe ich endlich richtige Freunde. Nele wird sie mir wegnehmen.«
Frau Rennert sah einige Schwierigkeiten auf sich zukommen, aber sie hatte schon andere gemeistert.
»Mach dir keine Gedanken, Rosi. Hier ist das anders, als in eurer Schule.«
»Wir können doch nichts dafür, dass unser Papi so krank geworden ist«, schluchzte das kleine Mädchen auf. »Ich bin so gern hier, weil die anderen Kinder auch keine Eltern haben.«
»Du hast doch immer noch deine Mutti«, erwiderte Frau Rennert tröstend.
»Aber Papi wird nicht mehr gesund, und unser schönes Haus können wir auch nicht behalten.«
Es war für dieses Kind schwer zu begreifen, aber es war der Wunsch ihrer Mutter, dass sie auf die unvermeidliche Veränderung vorbereitet wurde.
Warum also, so meinte Frau Rennert, sollte man sie nicht auch damit vertraut machen, dass Cornelia und Michael Fellmann hierhergebracht wurden?
»Schau, die Fellmann-Kinder kennst du doch«, meinte sie vorsichtig. »Ihr seid doch Freunde. Du bist doch mit Nele in eine Klasse gegangen.«
»Ja, früher, da waren wir Freunde, weil wir zwei die reichsten in der Klasse waren und Mami hat immer gesagt, dass ich mich mit den andern nicht abgeben soll. Aber dann – nachher«, fuhr sie stockend fort, »da hat Nele gesagt, dass ich auch nicht besser bin, als die anderen.«
»Besser oder nicht besser zu sein, hat nichts mit Geld zu tun«, erklärte ihr Frau Rennert. »Das wird vom Charakter bestimmt, und vielleicht ist es für Nele nun sehr gut, wenn sie auch mal sieht, dass man sich mit allen Kindern verstehen kann, wenn man den guten Willen hat. Du verträgst dich ja auch mit allen.«
»Aber ich war allein und sie kommt mit Michael. Na, du wirst schon noch sehen, Tante Rennert, wie die sein können.«
»Du wirst doch nicht glauben, dass sie mir auf der Nase herumtanzen können. Das wäre ja noch schöner.«
Aber trotz dieser zuversichtlichen Bemerkung, sollte sich der Einzug der beiden Fellmann-Kinder in Sophienlust recht turbulent gestalten.
*
Claudia Brachmann und Edith Wolfram waren mit ihren Kindern zum Einkaufen in die Stadt gefahren. Claudia hatte von ihrem Schwiegervater zum Geburtstag einen eigenen Wagen bekommen, über den sie sich riesig gefreut hatte.
Die beiden jungen Frauen verstanden sich ausnehmend gut, und die kleine Petra, die ein ganz entzückendes kleines Mädchen geworden war, kümmerte sich rührend um den lebhaften Stefan. Dessen Sportwagen war immer dabei, da der kleine Kerl jetzt schon ein ganz schönes Gewicht hatte.
Ein Stadtbummel war auch für Edith eine willkommene Abwechslung. Obwohl ihr Mann sich jetzt eine Sprechstundenhilfe leisten konnte, denn auch seine Arztpraxis war durch die neue Siedlung beträchtlich angewachsen, musste sie manchmal doch noch aushelfen. Sie tat es gern. Sie war glücklich, für den geliebten Mann, der so viel getan hatte, nun auch ganz da sein zu können.
Ihr erster Hochzeitstag stand vor der Tür, und da wollte sie ihm etwas besonders Schönes schenken. Noch war sie sich nicht schlüssig, ob sie eine goldene Taschenuhr, oder doch lieber eine Armbanduhr wählen sollte.
Petra und selbst Stefan wurden von einer Kuckucksuhr magisch angezogen.
So waren die beiden Kleinen beschäftigt, während die jungen Frauen die vorgelegten Stücke aufmerksam betrachteten und kritisierten.
Dann entschied sich Edith doch für die Taschenuhr, die ihr gleich so gut gefallen hatte und besprach mit dem Juwelier noch die Gravierung, während Claudia mit den Kindern, die nun doch unruhig wurden, weil der Kuckuck nicht mehr rufen wollte, nach draußen ging.
Edith hörte einen Aufschrei und mit ihm Petras lautes Jauchzen. Sie stürzte auf die Straße. Wie erstarrt stand Claudia vor dem Kinderwagen, in dem bereits ein Kind saß, das nicht viel älter sein mochte als Stefan.
»Spinne ich, oder ist das wirklich ein Kind?«, ächzte Claudia.
»Noch ein Baby«, jauchzte Petra begeistert.
»Da scheint sich jemand geirrt zu haben«, überlegte Claudia staunend, während Edith sich jenes Tages beklommen erinnert, an dem sie, verstrickt in eine schreckliche Lage, ihre kleine Petra vor die Tür von Sophienlust gelegt hatte.
Nun kam auch der Juwelier heraus und die Verkäuferinnen. »So kann sich doch niemand irren, das muss doch Absicht sein«, schwirrte es durcheinander. Menschen sammelten sich an, und Stefan begann heftig zu protestieren, weil er in seinen Wagen wollte, in dem das Kind mit großen, verwunderten Augen saß.
»Vielleicht hat jemand nur die günstige Gelegenheit genützt, das Kind da hineinzusetzen, um ungestört einkaufen zu können«, vermutete Claudia. »Schauen wir uns mal um.«
Aber in keinem der umliegenden Geschäfte meldete sich eine Frau, die dieser Vermutung recht gab.
»Ob uns jemand erkannt hat, und weiß, dass wir Verbindung zu Sophienlust haben?«, meinte Edith leise. »Vielleicht jemand, der sogar weiß, was ich einmal getan habe?«
»Blödsinn«, erwiderte Claudia. »Das ist doch längst vergessen. Wer hat es denn schon erfahren. Über diese Geschichte ist längst Gras gewachsen.«
»Schauen wir mal nach, ob das Kind eine Nachricht bei sich hat«, flüsterte Edith, während die Zuschauer laut diskutierten über diese so unglaubliche Geschichte, wobei die Person, die das Kind allem Anschein nach ausgesetzt hatte, mit harten Worten bedacht wurde.
Edith wusste, welche schwerwiegenden Gründe einen Menschen zu einer so unglaublichen Tat veranlassen konnte. Bei ihr überwog das Mitgefühl ebenso wie bei Claudia.
»Melden müssen wir es auf jeden Fall bei der Polizei«, stellte diese nüchtern fest. »Es kann sich auch jemand einen üblen Scherz erlaubt haben. Dann können wir den Kleinen ja immer noch mitnehmen. – Nur keine Aufregung, meine Damen und Herren«, wandte sie sich an die Menschenansammlung, die sich gebildet hatte. »Wir nehmen das in die Hand.«
»Erst mal weg von hier, dann können wir alles in Ruhe überlegen«, raunte sie Edith zu. »Stefan ist verflixt schwer.«
Er strampelte, weil er in seinen Wagen wollte.
Aber dort saß ein fremdes Kind, das es anscheinend sichtlich genoss, durch die Straßen geschoben zu werden, während Edith Claudia den strampelnden Stefan abgenommen hatte.
»Na, das ist vielleicht ’ne Überraschung«, meinte Claudia. »Nun bin ich wahrhaft gespannt, was dabei herauskommt.«
Edith schwieg. Jäh und ernüchternd war sie an vergangene Zeiten erinnert worden. Unwillkürlich hielt sie Petras kleine Hand fest umklammert.
*
Besorgt blickte Dr. Wolfram auf die Uhr. Dass Edith noch immer nicht zurück war, ängstigte ihn. So lange blieben sie doch nie in der Stadt. Petra war gewöhnt, um sechs Uhr zu Bett gebracht zu werden. Ob die Sehnsucht sie mal wieder nach Sophienlust getrieben hatte?
Er rief dort an, erhielt aber eine verneinende Antwort. Er versuchte es bei Lutz Brachmann, aber in der Kanzlei meldete sich niemand.
Als er es dann in der Wohnung versuchen wollte, klingelte es an seiner Tür Sturm.
Voller Hoffnung, dass es Edith und Petra wären, öffnete er eilends, aber vor der Tür stand eine Dame, die einen jammernden Jungen an der Hand hielt, der aus der Nase blutete und sich das Knie hielt.
»Mein Sohn ist hingefallen«, stammelte sie. »Bitte helfen Sie, Herr Doktor. Er blutet ja so schrecklich.«
Bert Wolfram war von den Dorfbuben Schlimmeres gewöhnt, aber er redete begütigend auf den Jungen ein und brachte ihn in sein Sprechzimmer.
»Mein Name ist Fellmann«, stellte sich die Fremde vor. »Franziska Fellmann. Ich war auf dem Wege nach Gut Sophienlust. Die Kinder wollten unbedingt etwas trinken, und da ist Michael gestolpert und hingefallen.«
»Ich will nicht nach Sophienlust«, begehrte Michael heftig auf. »Ich will wieder nach Hause. Und Nele auch.«
»Meine Tochter ist draußen im Auto. Darf ich sie hereinholen, sonst ängstigt sie sich womöglich«, murmelte Franziska Fellmann.
»Bitte«, erwiderte Dr. Wolfram. »Jetzt werden wir mal den jungen Mann verarzten.«
Michael sträubte sich hier drinnen, Nele sträubte sich draußen. »Ich will nicht rein«, erklärte sie aggressiv. »Siehst du, das hast du nun davon. Das ist die Strafe vom lieben Gott, weil du uns loswerden willst, Mutti.«
»Das ist die Strafe, weil Michael nicht hören kann«, erwiderte Franziska Fellmann im starken Ton. Die Kinder hatten sie während der Fahrt so schikaniert, dass sie am Ende ihrer Geduld war. Das wollten sie haben und jenes und immer wieder fiel ihnen etwas Neues ein, um sie zum Halten zu zwingen. So hatte sich die Fahrt endlos ausgedehnt. Ihr Mann hatte sie wegen dringender Geschäfte nicht begleiten können.
»So ein doofes Dorf«, nörgelte Nele. »Keine schönen Geschäfte. Hier will ich nicht bleiben.«
Franziska Fellmann seufzte in sich hinein. Sie hatte es sich schon schlimm vorgestellt, die Kinder doch noch zur Vernunft zu bringen, aber so schlimm doch nicht. Sie mussten sich untereinander regelrecht verschworen haben, ihr das Leben noch einmal zur Hölle zu machen. Sie liebte ihre Kinder wahrhaftig, aber nun wurde ihr doppelt bewusst, dass es so mit ihnen nicht weitergehen konnte. Es bewies sich wieder einmal, dass übergroße Rücksicht eine ganz falsche Erziehungsmethode war.
»Warum willst du denn nicht nach Sophienlust?«, fragte drinnen Dr. Wolfram den kleinen Michael. »Es ist doch sehr schön dort.«
»Das glaube ich nicht«, erwiderte Michael aufsässig.
»Überzeuge dich doch erst einmal davon«, sprach Dr. Wolfram begütigend auf ihn ein. »Ich kenne es. Ich komme oft dorthin. Es sind viele nette Kinder dort.«
»Nicht nur arme?«, fragte Michael. »Ich teile meine Sachen nicht. Von mir kriegt keiner was. Warum kommt Nele nicht?«
Die Nase hatte aufgehört zu bluten, das Knie war verbunden. Wieder war eine Viertelstunde vergangen, und Edith war noch immer nicht daheim. Bert Wolframs Gedanken wanderten von dem bockigen kleinen Jungen zu ihr.
Franziska Fellmann erschien wieder. »Meine eigensinnige Tochter will lieber im Wagen warten«, sagte sie resigniert. »Na, du bist ja schon fertig, Michael. Vielen Dank, Herr Doktor. Was bin ich Ihnen schuldig?«
»Ich rechne mit Frau von Schoenecker ab«, erwiderte er mit einem flüchtigen Lächeln. »Ihre Kinder gehören ja schon fast zu meinen Schützlingen.«
Michael warf ihm einen schrägen Blick zu.
»Benimm dich«, ermahnte ihn seine Mutter streng. Er hatte es wieder eilig, nach draußen zu kommen. Franziska Fellmann wandte sich Dr. Wolfram zu.
»Ich hoffe so sehr, dass sie sich in Sophienlust ändern werden«, murmelte sie.
»Das werden sie ganz sicher«, munterte er sie auf. »Sind sie beide so bockig?«
»Und wie. Darum haben wir uns ja entschlossen, sie für eine Zeit fortzugeben. Wir haben sie zu sehr verwöhnt. Sie haben jeden Maßstab verloren. Hoffentlich bin ich nicht zu spät zur Einsicht gekommen.«
»Zu spät ist es nie«, stellte er fest. »Aber wo mag Edith stecken«, überlegte er, als Frau Fellmann mit ihren Kindern davonfuhr. »Es wird doch nichts passiert sein?« Es wurde ihm heiß und kalt, und er ging wieder zum Telefon.
*
Auf dem Polizeirevier mussten Claudia und Edith unzählige Fragen beantworten. Stefan wurde unruhig und begann zu weinen. Petra verlangte nach ihrem Papi. Nur der kleine Findling schien mit seinem Schicksal vollauf zufrieden und lutschte an seinem Daumen. Hunger schien er auch nicht zu haben. Er machte einen recht wohlgenährten Eindruck.
»Wir wollen das Kind ja mitnehmen, aber wir müssen jetzt nach Hause«, stöhnte Claudia. »Sonst wird man uns als vermisst melden.«
Doch die Bürokratie verlangt ihr Recht. Man gestattete ihr nur, ihren Mann anzurufen. Auch Edith wollte das, aber jedes Mal, wenn sie es versuchte, war das Telefon besetzt.
Dr. Lutz Brachmann jedoch war rasch zur Stelle. Gegen die Argumente des bekannten jungen Rechtsanwaltes, konnte auch der Inspektor nichts einwenden.
Kopfschüttelnd hatte Lutz den kleinen Jungen betrachtet. »Euch muss doch ein ganz besonderer Duft umgeben, dass euch die Kinder nur so zufliegen«, brummte er. Aber nachdem er nochmals versichert hatte, dass der kleine Fremdling in Gut Sophienlust gut aufgehoben sein würde, woran man allerdings auch keine Zweifel hegte, durften sie endlich heimfahren.
Zuerst hielten sie beim Doktorhaus an. Bert Wolfram kam ihnen schon völlig aufgelöst entgegen.
»Guter Gott«, stöhnte er, als er den Grund für das lange Ausbleiben erfuhr.
»Untersuch den Kleinen vorsichtshalber«, meinte Lutz Brachmann, während Claudia und Edith rasch ihre eigenen, müden Kinder versorgten.
Bert Wolfram verstand es, mit Kindern umzugehen. Er untersuchte den Kleinen gründlich, der dies als ein Vergnügen zu betrachten schien, denn er lachte laut, als Dr. Wolfram seine Arme und Beine bewegte.
»Gut genährt, gepflegt, völlig normal«, stellte der sachlich fest. »Haarfarbe blond, Augen braun, besondere Merkmale – keine.«
»Die Sachen, die er trägt, sind fast neu und nicht billig«, bemerkte Lutz Brachmann mit Kenneraugen. »Ich weiß ja, was so ein Baby kostet. Er muss ungefähr so alt sein wie Stefan. Wenn er wenigstens reden könnte.«
Dieses Kind umgab ein Rätsel. Wo kam er her, warum hatte man es in den fremden Kinderwagen gesetzt? Diese Fragen bewegten den Arzt und auch den Anwalt.
*
Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, bestieg rasch einen hellblauen Sportwagen, der mit Staub bedeckt war und den Anschein erweckte, als hätte er bereits eine weite Fahrt hinter sich.
»Bist du ihn losgeworden?«, fragte der Fahrer, ebenfalls ein junger Mann.
Sie nickte. »Ich habe ihn in einen Kinderwagen gesetzt.«
»Hat man dich auch nicht beobachtet?«, fragte er misstrauisch.
»Bestimmt nicht. Es war ein glücklicher Zufall. Gleich, nachdem du mich hattest aussteigen lassen, fand ich ihn vor einem Geschäft. Du hättest auf mich warten können. Ich musste ein ganz schönes Stück laufen.«
»Ist dir auch niemand gefolgt?«, fragte er wieder drängend.
»Fahr doch endlich los, damit wir hier wegkommen«, zischte sie. »Nein, niemand ist mir gefolgt. Du weißt doch, wie die Leute sind. Was kümmern sie sich schon um die andern. Schauen wir zu, dass wir über die Grenze kommen. Das Geld haben wir, aber die Dierings werden bestimmt alles in Bewegung setzen, wenn sie das Kind bis heute Abend nicht zurückhaben.«
»Wie blöd doch diese Leute sind«, äußerte er sich verächtlich. »So was fordert einen doch geradezu heraus, sie auszunehmen. Na, jedenfalls sind wir den Bengel los, und nun können wir unser Leben genießen, Kätzchen. Du bist okay. Mit dir kann man was anfangen.«
Sie warf ihm einen raschen Seitenblick zu. »Aber lass dir ja nicht einfallen, mit einer anderen anzubandeln, Joschi. Es würde dir schlecht bekommen.«
Sie hätte es lieber nicht sagen sollen. Seine Lippen pressten sich zusammen. So durfte sie ihm nicht kommen. Er hatte alles ausgeheckt. Erpressen ließ er sich nicht.
Solange sie ihm aus der Hand fraß, konnte sie bei ihm bleiben, aber wenn sie etwa glaubte, ihn in der Hand zu haben, wollte er sie rasch eines Besseren belehren.
»Warum sagst du nichts, Joschi?«, fragte sie misstrauisch.
»Ich muss mich auf die Straße konzentrieren, mein Schatz«, erwiderte er. »Es wäre peinlich, wenn wir im Straßengraben landen würden.«
Er brachte den Motor auf volle Touren und in rasender Fahrt jagte der Wagen über die Landstraße.
*
»Ich will ein Zimmer für mich allein«, stellte Cornelia als erstes fest. Zwar war sie von dem Gut Sophienlust gegen ihren Willen doch beeindruckt, aber das wollte sie vor allem ihrer Mutter nicht zeigen.
Denise warf Frau Fellmann einen warnenden Blick zu, als diese etwas sagen wollte.
»Nun gut, dann bekommst du eben eines allein. Wie gefällt dir dieses?«
Cornelia blickte sich um. »Das zweite Bett muss aber raus«, erklärte sie. »Wo ist der Fernsehapparat? Gibt es überhaupt einen?«
»Nein, es gibt hier keinen. Nur drüben im Pavillon.«
»Ich will jetzt fernsehen«, sagte sie und stampfte mit dem Fuß auf.
»Jetzt wird gegessen«, erwiderte Denise von Schoenecker unbeeindruckt. »Wir hatten euch eigentlich schon früher erwartet und haben ausnahmsweise mit dem Essen gewartet.«
»Wozu denn?«, mischte sich nun Michael ein. »Wir können ja mit Mutti im Hotel essen.«
»Jetzt seid ihr hier und werdet mit den anderen Kindern essen«, erklärte Denise ausdrücklich.
Seltsamerweise flößte sie ihnen doch einen gewissen Respekt ein, obgleich sie jung und schön war und ganz anders, als sie sich die Besitzerin eines Kinderheimes vorgestellt hatten. Vielleicht gerade deshalb.
Die Kinder saßen alle bereits an ihren Plätzen, als sie in den Speisesaal traten.
»Das sind Cornelia und Michael Fellmann«, stellte Denise die Kinder vor. »Kennenlernen könnt ihr euch später. Guten Appetit, Kinder.«
Cornelia bemerkte Rosi, aber sie warf ihr einen abweisenden Blick zu. Mit mürrischer Miene ließ sie sich nieder, aber etwas hinderte sie doch, ihrem Unwillen Ausdruck zu geben.
Michaels Augen wurden groß, als er das appetitliche Essen sah. Schmollend verzog sich sein Mund, als Cornelia ihm zuraunte: »Du isst nichts. Denk dran, was wir uns versprochen haben.«
»Ich habe Hunger«, murrte er.
Cornelia trat ihm auf den Fuß und kniff ihn in den Arm. »Du kannst was erleben«, zischte sie.
»Nun, wollt ihr nicht essen?«, fragte Schwester Gretli freundlich. »Gleich kommt die Nachspeise.«
Michael lief das Wasser im Munde zusammen. Er rückte von Cornelia weg und begann hastig zu essen.
»Verräter«, stieß sie wütend hervor. Schwester Gretli, die es gehört hatte, lächelte.
Neben Michael saß ein kleines Mädchen. »Was meinst du, wie gut die Erdbeerspeise schmeckt«, flüsterte sie.
Er tat so, als wäre Cornelia nicht vorhanden. Sein Magen knurrte und es war sein Magen, nicht ihrer. Wenn sie es ohne Essen aushalten konnte, er nicht. Außerdem schmeckte es ihm prima.
»Nun haben Sie schon einen Vorgeschmack bekommen, Frau von Schoenecker«, sagte Franziska Fellmann mit belegter Stimme. »Und Dr. Wolfram auch. Ich mute Ihnen viel zu.«
»In ein paar Tagen sieht es schon ganz anders aus«, erwiderte Denise frohgemut. »Glauben Sie nur nicht, dass wir es mit allen Kindern von Anfang an leicht haben. Ihre Eigenarten haben sie alle.«
»Es ist so wunderschön hier«, stellte Franziska Fellmann fest. »Hier müssen die Kinder ja zufrieden sein. – Aber Sie bekommen Besuch. Lassen Sie sich bitte nicht aufhalten.«
»Das sind Freunde«, lächelte Denise. »Lieber Himmel, wen bringen sie denn da?«
»Erschreck nicht, Denise«, rief Claudia. »Wir haben mal wieder ein Findelkind.«
»Auf dass das Haus voll werde«, fügte Dr. Wolfram hinzu, der die Brachmanns begleitet hatte.
Er machte eine leichte Verbeugung vor Frau Fellmann. »Wir kennen uns ja schon, gnädige Frau«, sagte er höflich. »Wie Sie sehen, ist Gut Sophienlust Zufluchtstätte für alle.«
Der kleine Findling riss seine müden Äuglein noch einmal auf, als Denise ihn auf den Arm nahm. »Dadi«, lallte er.
»Nennen wir ihn also einstweilen Dadi«, meinte Denise. »Und nun erzählt! – Nein, bleiben Sie doch ruhig, Frau Fellmann. In Sophienlust gibt es keine Geheimnisse. Hier wird alles geteilt. Freude und Leid. Was ist das für ein niedliches Kerlchen.«
»Gefüttert haben wir ihn schon«, erklärte Claudia, die sich, ebenso wie ihr Mann und nun auch mit Frau Fellmann bekannt machten. »Ich würde ihn ja behalten, aber Stefan scheint eifersüchtig zu sein, weil man ihn in seinen Wagen gesetzt hat.«
»Na, da werden unsere Kinder staunen, dass wir wieder ein Baby haben«, war Denises Kommentar, nachdem Claudia die Geschichte erzählt hatte.
*
Weit von Sophienlust entfernt, in einem komfortablen Bungalow schlug eine junge Frau aufschluchzend die Hände vor ihr Gesicht.
»Jetzt müssen wir etwas unternehmen, Jo«, stöhnte sie. »Sie bringen uns das Kind nicht zurück. Mein kleiner Pat. O Gott, was werden sie mit ihm gemacht haben?«
»Beruhige dich, Liebes«, versuchte der Mann sie zu trösten. »Es ist erst acht Uhr. Sie werden warten, bis es ganz dunkel ist. Ich habe ihnen doch versprochen, dass ich nichts unternehme. Ich habe gezahlt. Was können sie für ein Interesse haben, das Kind zu behalten?«
»Vielleicht lebt Pat gar nicht mehr. Wie oft liest man das«, stöhnte sie. »Ich bin schuld. Ich bin an allem schuld. Wie konnte ich Lilly das Kind nur anvertrauen.«
Joachim Dierings Gesicht war fahl. »Immerhin ist sie deine Kusine, Martina. Es geht ihr nur ums Geld. Sie wird dem Kind nichts zuleide tun.«
»Aber der Mann steckt dahinter. Sie muss ihm hörig sein.«
Er legte seine Hände auf ihre Schultern. »Ruhig sein, Kleines. Verlier die Hoffnung nicht. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Sie werden alles wieder hervorzerren, wenn es publik wird. Man wird euren Namen in den Staub treten. Nun doppelt.«
Aus verweinten Augen sah sie ihn an. »Ich werde aus deinem Leben gehen, Jo«, flüsterte sie. »Du sollst darunter nicht zu leiden haben. Ich werde dir auch Pat lassen. Nur leben soll er. Er ist doch alles, was ich dir für deine Liebe geben konnte.«
»Ich liebe dich, Martina. Du bist meine Frau und bleibst es für immer. Wir werden es gemeinsam tragen, wie es auch kommen mag. Wir werden es durchstehen. Jetzt dürfen wir die Nerven nicht verlieren.«
Das Ticken der Uhr, so leise es auch war, tönte wie Hammerschläge in die Stille.
»Gut«, sagte er leise, »ich rufe jetzt die Polizei.«
»Jo«, flüsterte sie, »kannst du mir jemals verzeihen, dass ich so viel Unruhe in dein Leben brachte?«
»Sehr viel, Martina«, erwiderte er heiter. »Dich selbst – deine Liebe, deine Jugend. Ich wollte mir das alles erkaufen, weil ich ohne dich nicht leben konnte, aber du hast mich glücklich gemacht. Mich, einen Krüppel.«
»Sag dieses entsetzliche Wort nicht«, begehrte sie auf.
»Schwer zog er das rechte Bein nach, als er zum Telefon ging und auf seiner rechten Wange brannte dunkel eine lange Narbe.
Martinas Augen folgten ihm. Einmal – unendlich lange schien es bereits her zu sein, hatte sie auch nicht geglaubt, dass sie diesen Mann so lieben könnte. Sie hatte ihn geheiratet, um ihren Vater vor dem finanziellen Ruin zu retten, aber sie hatte Joachim Diering schnell lieben gelernt, seine Güte, seine Menschlichkeit, sein warmes Herz, das trotz des Unglücks, das ihn selbst gezeichnet hatte, nicht verbittert war. Und nicht einen Augenblick hatte sie sich den Verdienst zugeschrieben, ihn vor dieser Verbitterung bewahrt zu haben.
»Sie erwarten uns«, sagte er kaum hörbar, als er zu ihr zurückkehrte.
*
Während die Fahndung nach Lilly Rank und dem seit zwei Tagen vermissten kleinen Patrick Diering eingeleitet wurde, war es in Sophienlust still geworden.
Denise war nach diesem anstrengenden Tag zu ihrer Familie nach Schoeneich zurückgekehrt und hatte ihrem Mann wieder einmal viel zu erzählen.
Alexander von Schoenecker hatte mit den Kindern Sascha, Andrea und Dominik Susanne Berking zu ihren Eltern gebracht, die einmal wieder für ein paar Tage bei ihnen zu Gast gewesen waren.
So wussten auch die drei Schoenecker-Kinder, zu denen selbstverständlich Dominik von Wellentin gezählt wurde, noch nicht, was sich heute alles getan hatte. Aber Denise meinte, dass sie es morgen noch früh genug erfahren würden, sonst könnten sie vor lauter Aufregung wieder nicht einschlafen.
»Na, das sind ja wieder mal schöne Geschichten«, meinte Alexander von Schoenecker.
»Was sind schöne Geschichten?«, fragte Dominik durch die Tür.
»Du sollst schlafen«, ermahnte ihn seine Mutter streng.
»Henrik weint, wenn du das nicht hörst«, stellte er empört fest.
Denise eilte, um nach ihrem jüngsten zu sehen, der ihnen unruhige Nächte bereitete, weil er Zähne bekam.
Dominik folgte ihr. »Was sind schöne Geschichten?«, wiederholte er.
»Du wirst es morgen schon noch erfahren. Jetzt schlaf endlich. Es ist schon spät.«
»Ich finde es ungerecht, wenn ihr uns was verschweigt«, begehrte er auf.
»Du bist ganz schön naseweis, mein lieber Junge.«
»Sind die Fellmann-Kinder gekommen? Machen sie Ärger?«, argwöhnte er.
»Ja, die Fellmann-Kinder sind gekommen«, gab sie seufzend zu.
»Kann ich nicht mal zu Hause bleiben? Ich fühle mich gar nicht so richtig wohl«, flunkerte er geistesgegenwärtig.
»Du bist nur neugierig. Nein, du bleibst nicht zu Hause. Du gehst mit. Marsch, ins Bett.«
Wenn seine Mutter einen so strengen Ton anschlug, war nichts zu machen. Dominik wusste das nun schon langsam. Da nützte kein Schmollen und kein Bitten.
»Schließlich gehört Sophienlust mir«, trumpfte er auf.
»So sehr viel anders als die Fellmann-Kinder ist er auch nicht«, überlegte sie. »Nicht ganz so aufsässig, aber immerhin kehrt er manchmal ganz schön den Erben heraus.«
»Wenn du einmal erwachsen bist und Verstand genug hast, kannst du es allein verwalten«, erwiderte sie gleichmütig. »Ich weiß nur nicht, ob es dir gefallen würde, wenn deine Geschwister darauf beharren, dass Schoeneich ihnen gehört.«
Er schob die Unterlippe vor. »Hab ich ja nicht so gemeint«, brummte er und trollte sich.
Henrik beruhigte sich rasch und schlief wieder ein. Minutenlang betrachtete sie das süße Kindergesichtchen. Er würde ihr noch einige Jahre ganz gehören. Es machte sie glücklich, denn die drei größeren wuchsen ihr viel zu schnell heran.
Aber dann wanderten ihre Gedanken zu dem kleinen Findling, von dem sie nichts wussten, als dass sich jemand seiner entledigt hatte. Die Mutter? Vielleicht hatte sie jetzt schon die Reue gepackt? Oder weinte gar eine Mutter um ihn, der man das Kind weggenommen hatte?
Welche Gründe gab es, ein hilfloses Kind auszusetzen? Eine Notlage? Diesen Anschein erweckte die Gepflegtheit des Kindes nicht. Es war bis zu seinem Auffinden nicht vernachlässigt worden.
Entführung? Ein kalter Schauer jagte über ihren Rücken. Entführung bedeutete zugleich meist auch Erpressung, wenn es nicht ein bloßer Racheakt war.
Oder war es nur eine Kurzschlusshandlung einer Frau, die einen Mutterkomplex besaß und es dann mit der Angst bekommen hatte? Aber dann hätten die Eltern sich doch wohl sofort gemeldet.
Sie rief noch einmal beim Polizeirevier an, aber man konnte ihr nichts Neues berichten. Bis hierher war die Fahndung nach Lilly Rank noch nicht gedrungen.
Alexander gelang es, seine Frau zu beruhigen. »Das Kind lebt und ist in Sicherheit, das ist die Hauptsache«, stellte er fest. »Alles andere wird sich finden.«
*
Auf Gut Sophienlust lag Cornelia Fellmann allein in ihrem Zimmer. Voller Trotz und Empörung redete sie sich ein, nichts aber auch gar nichts schön zu finden.
Michael war für sie ein ganz elender Verräter, und sie würde es ihm schon zeigen, dass sie sich nicht durch einen guten Nachtisch bestechen ließ, wenn ihr bei dem Gedanken daran auch noch so sehr das Wasser im Munde zusammenlief.
Gemein fand sie es auch von ihm, dass er widerspruchslos zu Toni ins Zimmer gezogen war. Und geratscht hatte er auch gleich mit ihm.
Sie hatte noch mit niemanden ein Wort gewechselt, war aber gleichzeitig wütend, dass Rosi nicht versucht hatte, sich an sie heranzumachen, damit sie ihren Zorn wenigstens an ihr hätte auslassen können. Aber Rosi hatte sich ferngehalten und so getan, als ob sie schon ganz hierher gehörte.
Rosi war überhaupt an allem schuld! Niemals wäre Mutti auf den Gedanken gekommen, sie in ein Kinderheim zu geben, wenn Rosi nicht hierhergekommen wäre. Dieser Gedanke setzte sich in Cornelias Kopf fest.
Sie erschrak fürchterlich, als die Tür leise geöffnet wurde. Daheim schlief sie mit Michael Wand an Wand und die Verbindungstür blieb immer offen. Sie hatte niemals so sehr das Gefühl gehabt, ganz allein zu sein wie hier.
Tappende Schritte kamen auf ihr Bett zu und sie schrie leise auf.
»Pscht, ich bin es doch bloß«, vernahm sie die Stimme ihres Bruders.
»Lass mich in Ruhe«, fauchte sie ihn an, obgleich sie sehr erleichtert war.
»So brauchst du doch nun auch wieder nicht zu sein, Nele«, raunte er. »Eigentlich ist doch alles ganz schön hier, und das Essen ist prima.«
»Das haben sie nur gemacht, damit wir denken sollen, es ist immer so. Aber wenn Mutti morgen wieder weg ist, wirst du schon sehen, was wir für einen Fraß bekommen.«
»Toni sagt aber, dass das Essen manchmal noch viel besser ist, und Magda die beste Köchin überhaupt ist. Und alle sind sehr nett. Schläge gibt es nie.«
»Das wäre auch noch schöner«, meinte Cornelia. »Das sollen sie bloß probieren. Überhaupt gehe ich wieder fort. Ich will nicht hierbleiben. Wir sind keine Kinder, die sie von der Straße aufgelesen haben.«
Michaels naiver Verstand konnte ihr nicht ganz folgen. »Meinst du das kleine Kind? Ich finde es aber ganz gemein, wenn man ein Kind einfach in einen fremden Kinderwagen setzt. Dann hätten sie es doch gleich nach Sophienlust bringen können. Hier wird niemand weggeschickt.«
»Das sagt wohl auch dein Toni«, stieß Cornelia zornig hervor. »Red doch mit dem, und lass mich in Frieden.«
»Na, wenn du so bist«, meinte er, »dann kann ich ja wieder gehen. Hast du denn gar keinen Hunger?«
Um nichts in der Welt hätte Cornelia zugegeben, dass ihr Magen jämmerlich knurrte, aber Michael hörte es.
»Hier hast du ein paar Kekse«, wisperte er. »Die Carola hat sie mir gegeben.«
»Da Cornelia sich nicht rührte, legte er sie auf das Nachttischchen.
»Wer ist Carola?«, fragte Cornelia plötzlich.
»Das nette große Mädchen mit den blonden Haaren. – Sie ist wirklich sehr nett. Sie meinte auch, dass du sicher Hunger hättest.«
»Ich mag dich nicht mehr«, zischte sie. »Du lässt dich bestechen. Ich nicht.«
»Quatsch, bestechen«, murrte er. »Mir wird schlecht, wenn ich Hunger habe.«
Er hörte ein Geräusch und schlich schnell in sein Zimmer zurück. Toni blinzelte.
»Warst du bei deiner Schwester?«, fragte er gedämpft. »Ich klatsche nicht, du kannst es mir ruhig sagen.«
»Sie ist richtig blöd«, knurrte Michael. »Sie hungert lieber.«
»Na, warte es nur ab, bis Magda Waffeln bäckt.«
»Sind die gut?«, wollte Michael wissen.
»Jetzt wird geschlafen«, sagte eine leise Stimme durch die Dunkelheit.
*
»Wir wollten heute noch über die Grenze, Joschi«, drängte Lilly Rank zur gleichen Stunde ihren Begleiter. »Mach jetzt nicht schlapp.«
»Ich habe es mir anders überlegt. Zu so später Stunde kontrollieren sie womöglich schärfer. Morgen ist Wochenendverkehr. Wozu haben wir es eigentlich so eilig?«
»Martina wird sicher nicht mehr warten. Ich kenne sie doch. Pat ist ihr ein und alles.«
Er kniff die Augen zusammen. »Aber du weißt hoffentlich auch, was sie aufs Spiel setzt, wenn sie die Polizei benachrichtigt. Welche Frau gibt so viel Annehmlichkeiten schon gern auf. Mit dem Kind wollte sie Diering doch nur fester an sich binden.«
Lilly versank in Nachdenken. »Das habe ich auch immer gedacht, aber ich meine, sie liebt ihn wirklich.«
»Diesen Krüppel? Was kann er ihr denn schon bieten außer dem goldenen Käfig.« Er lachte höhnisch.
»Er liebt sie. Er liebt sie abgöttisch«, bemerkte Lilly sinnend. »Du könntest eine Frau gar nicht so lieben, Joschi.«
»Fang nicht mit solchen Quatsch an. Wir wollen uns ein angenehmes Leben machen, Kätzchen. Das war doch auch dein Wunsch. Du warst doch nur neidisch auf Martinas Geld, nicht etwa auf ihren Mann.«
Es war sein zynischer Ton, der sie noch nachdenklicher stimmte. Ja, sie hatte Martina beneidet, das stimmte wohl, aber insgeheim hatte sie sich auch gewünscht, einmal von ihm so liebevoll behandelt zu werden, wie Joachim Diering seine Frau behandelte.
»Jetzt krieg bloß keinen Moralischen«, murrte er. »Dem Kind ist doch gar nichts passiert und Diering tun die fünfzigtausend nicht weh. Wenn ich es mir recht überlege, hätten wir ihm ruhig noch mehr abknöpfen können.«
»Hoffentlich ist Pat wenigstens in gute Hände gekommen«, seufzte sie niedergeschlagen.
»Du bist eine dumme Gans«, fauchte er sie an. »Nun fang auch noch das Heulen an und posaune es überall herum. Dann haben sie uns wenigstens gleich. Aber das eine möchte ich dir sagen, mein liebes Kind, es war deine Idee, das Kind zu entführen, nicht meine.«
Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. »Wie kannst du das nur sagen, Joschi?«, fragte sie einfältig. »Es war dein Plan. Du hast ihn ausgeheckt und du hast gesagt, es kann gar nichts schiefgehen.«
»Es geht auch nichts schief«, erklärte er wütend, »wenn du jetzt nicht das heulende Elend bekommst. Sie werden sich hüten, die Presse einzuschalten. Dann kommt alles von dem alten Rank wieder ans Tageslicht, und daran hat Diering bestimmt kein Interesse, und deine liebe Kusine schon gar nicht. In ein paar Tagen haben sie ihr Kind ja auch wieder. Die deutschen Behörden sind da sehr genau. Und aus reiner Nächstenliebe wird wohl keiner ein fremdes Kind bei sich aufnehmen, ohne die Behörden zu verständigen. Das dumme Gesicht möchte ich gesehen haben, das die Frau gemacht hat, als sie in dem Kinderwagen ein fremdes Gör fand.«
Lilly betrachtete ihn nachdenklich. Er sah gut aus. Er war genau der Typ, auf den ein junges Mädchen hereinfiel. Maßlos hatte sie sich in ihn verliebt und eine Zeit hatte er ihr den gutsituierten jungen Mann vorgespielt, der dann ganz plötzlich und ohne seine Schuld in Schwierigkeiten verstrickt wurde.
Dass dem nicht so war, dass er schon bei ihrem Kennenlernen in Schwierigkeiten steckte, hatte sie schon bald erfahren.
Aber da war sie ihm schon hörig gewesen. Sie vermeinte Martinas mahnende Worte zu hören, als sie einmal zufällig die beiden zusammen traf.
»Nimm dich in acht vor diesem Mann, Lilly!«, hatte sie gesagt. »Er gehört nicht zu der Sorte, die es ernst meint.«
Sie ist nur neidisch, weil er so gut aussieht, hatte Lilly damals in ihrer Einfalt gedacht. Weil er jung und fesch ist und nicht so schwerfällig wie ihr Jo.
Lilly war nicht gerade mit geistigen Fähigkeiten gesegnet. Sie war ein hübsches, aber etwas unerfahrenes Mädchen. Mit schönen Worten konnte man sie leicht aufs Glatteis führen. Warnungen verschloss sie sich.
Martina hatte sie in ihrem Hause aufgenommen, weil sie sie darum gebeten hatte. In ihrer Heimatstadt war der Name Rank in aller Munde gewesen, als Martinas Vater in diese üble Konkursaffäre verwickelt wurde.
Martina hatte im richtigen Augenblick den Reeder Joachim Diering geheiratet. Die Affäre um ihren Vater wurde von ihm hinter den Kulissen geregelt.
Aber Martina war plötzlich eine reiche Frau. Und sie war die mittellose Lilly Rank, die mit ihrer Mutter von einer recht bescheidenen Rente leben musste, nachdem ihr Onkel sie nicht mehr unterstützen konnte.
Bald hatte ihre Mutter sie dazu überredet, sich an Martina zu halten, die sie auch freundlich aufgenommen hatte. Es ging alles recht gut, bis Joschi – Joseph Kovac – in ihr Leben trat.
»Ich habe eine Idee«, sagte er in ihre Gedankengänge hinein. »Ich gehe beim Morgengrauen mit dem Geld zu Fuß über die Grenze und du kommst mit dem Wagen nach. Wir treffen uns in Straßburg.«
»Warum?«, fragte sie misstrauisch.
»Kätzchen, überleg doch mal. Man wird nach uns beiden suchen, wenn sie wirklich die Polizei verständigt haben sollten. Hast du deiner Kusine etwa meinen richtigen Namen gesagt?«, fügte er rasch hinzu.
Hatte sie es? Sie wusste es nicht mehr. Aber sie hätte es auch nicht zugegeben, als sie in seine lauernden Augen blickte. Sie hatte plötzlich Angst.
Immer wieder hatte Joschi sie beschwichtigt. Dem Kind wird ja nichts passieren, hatte er ihr eingeredet. Diering wird zahlen und das Geld hole ich ab. Das ist doch das Gefährlichste, und das nehme ich auf mich.«
Er hatte das Geld aus dem Schließfach, in dem es hinterlegt worden war, abgeholt und nichts war passiert. Sie hatte Pat versorgt, wie er es gewöhnt war. Nicht ein Härchen war ihm gekrümmt worden.
Das Kind war mit ihr vertraut. Es hatte nicht mal nach seiner Mutter geweint. Joschis lange gefasster Plan war in die Tat umgesetzt worden, als Martina ihren Mann auf eine kurze Geschäftsreise nach Kopenhagen begleitete. Und sie war mit dem Kind weit vom Schuss, als Joschi alles andere erledigte.
»Was hast du Jo eigentlich gesagt?«, fragte sie langsam.
Er zuckte die Schultern. »Er soll das Geld hinterlegen, und dann bekommen sie ihr Kind zurück, falls sie die Polizei nicht verständigen. Natürlich habe ich ihm auch gesagt, dass du dich ebenfalls in unserer Gewalt befindest. Jetzt leg dich aufs Ohr, Kätzchen. Ich gehe noch ein Glas Bier trinken.«
Sie war müde und hatte Angst. Sie wagte nicht, ihm zu widersprechen.
Sie lauschte seinen leisen Schritten nach, als er die Treppe hinabging. Plötzlich kam ihr eine Idee. Ganz leise erhob sie sich und huschte, immer nach unten lauschend, in das Nebenzimmer.
Den Koffer mit dem Geld hatte er unter das Bett gestellt. Aber wo war der Schlüssel? Warum kam sie eigentlich auf den Gedanken, sich davon zu überzeugen, ob sich das Geld wirklich noch in dem Koffer befände?
Sie zitterte vor Angst, als sie ihn hervorzog, probierte die Schlösser, die zu ihrer Überraschung aufsprangen. Ganz rasch überlegte sie. Er musste vorhin etwas herausgenommen haben, und als sie plötzlich in sein Zimmer getreten war, hatte er keine Zeit mehr gefunden, den Koffer wieder abzuschließen. In diesem kleinen Gasthof fühlte er sich wohl auch allzu sicher.
Sie öffnete nach kurzem Zögern den abgeschabten Lederkoffer. Bündel von Geldscheinen lagen bündelweise darin. Es mussten weit mehr als fünfzigtausend sein.
Hatte Joschi ihr nicht die Wahrheit gesagt? Was hatte er mit Joachim Diering wirklich ausgemacht? Stimmte es auch, dass er sie aus dem Spiel gelassen hatte oder war auch das Lüge? Blieb am Ende alles an ihr hängen?
Die Angst saß ihr im Nacken. »Ich gehe im Morgengrauen mit dem Geld über die Grenze«, gellten ihr seine Worte in den Ohren. »Du kommst mit dem Wagen nach.«
Wollte er sich wirklich mit ihr treffen? Wollte er nicht mit dem Geld auf und davongehen?
Auf leisen Sohlen schlich sie zur Treppe. Undeutlich konnte sie Joschis Stimme vernehmen. Er lachte, wahrscheinlich trank er mehr als ein Bier. Dabei blieb es ohnehin nie.
Krampfhaft überlegte Lilly. Nach ihr würde man fahnden, nach ihrem Wagen, den Martina ihr zur Verfügung gestellt hatte. Ganz so naiv war sie doch nicht, als dass ihr nicht klar wurde, dass sie in weitaus größerer Gefahr schwebte als Joschi.
Es waren nur Sekunden, in denen sie eine Entscheidung traf. Ihr kamen sie, aufgezehrt von Angst, endlos vor. Dann aber griff sie nach dem Koffer und eilte die Treppe hinab.
Ihr Herzschlag setzte aus, als sie bemerkte, dass die Tür zum Schankraum einen Spalt offen stand. Aber nichts rührte sich hier draußen.
Die Nacht nahm sie auf. So schnell sie ihre Füße tragen konnten, lief Lilly davon. Der Koffer war schwer, als wäre er mit Bleigewichten gefüllt und nicht mit Geldscheinen. Sie torkelte, stolperte, rannte keuchend blindlings in die Dunkelheit hinein.
*
»Was sagte der Mann am Telefon?«, fragte der Inspektor Joachim Diering. Sein Blick wanderte zwischen dem Mann mit dem angegrauten Schläfen und dem zernarbten Gesicht und der reizvollen jungen Frau hin und her, deren Schönheit auch die Verzweiflung, die in ihren umschatteten Augen zu lesen war, nichts anzuhaben vermochte.
»Patrick und Lilly befänden sich in Sicherheit«, erwiderte Joachim Diering dumpf. »Sobald ich das Geld hinterlegt hätte, und er es sicher in den Händen hätte, würden sie zurückkehren.«
»Es ist doch immer dasselbe. Man vertraut Verbrechern mehr als uns«, tönte die vorwurfsvolle Stimme durch den Raum.
Joachim Diering richtete sich auf. »Das Geld bedeutet mir nichts. Das Kind bedeutet mir alles. Aber wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass Lilly an diesem schrecklichen Geschehen nicht unbeteiligt ist.«
Es waren schwere Stunden für ihn und seine Frau, als sie die Gründe darlegten, warum sie um jeden Preis die Polizei und die Presse meiden wollten.
»Wir wollen unser Kind zurückhaben«, sagte Joachim Diering leise, seinen Arm fest um Martinas Schultern legend. »Etwas anderes interessiert uns nicht.«
»Es ist ziemlich viel Zeit verstrichen«, brummte der andere. »In der Zwischenzeit können sie längst ins Ausland entkommen sein. Frau Diering, versuchen Sie sich an den Namen des Mannes zu erinnern, wenn es Ihnen auch schwerfällt.«
Martina starrte auf den Fußboden. »Es ist schon Wochen her, dass Lilly ihn erwähnte, als ich sie einmal eindringlich ermahnte, sich nicht mit ihm einzulassen. Sie nannte ihn Joschi«, stieß sie dann hervor. »Wahrscheinlich ist es mir nur in der Erinnerung haftengeblieben, weil ich meinen Mann Jo nenne.«
Wie viel Zeit verstrich, während er ihr Bilder vorgelegt wurden, wusste sie nicht zu sagen. Immer wieder schüttelte sie resigniert den Kopf. Dann aber, plötzlich, ruckte ihr Kopf empor.
»Das könnte er sein«, flüsterte sie. »So ähnlich jedenfalls sah er aus, nur trug er die Haare länger.
»Joseph Kovac«, sagte der Inspektor, »wegen Rauschgiftschmuggels festgenommen, aber aus Mangel an Beweisen auf freien Fuß gesetzt. Wir werden sehen.«
Und wieder in ihr Haus, das so leer und öde schien, zurückgekehrt, begannen für Joachim Diering und seine Frau Stunden bangen, qualvollen Wartens.
*
»Nun, Dadi, wie geht es uns«, sprach Denise von Schoenecker auf das jauchzende Baby ein, das nichts von der Aufregung wusste, die es verursachte.
»Leider ist er zu klein, um uns Antwort zu geben«, meinte Claudia Brachmann, die ebenfalls zu früher Stunde mit ihrem Sohn nach Sophienlust gekommen war, um sich nach dem Findelkind zu erkundigen.
»Und wenn er groß genug dazu sein wird, bevor sich seine Mutter oder seine Angehörigen gemeldet haben, wird er nicht einmal seinen wahren Namen wissen«, bemerkte Denise gedankenvoll. »Stell dir einmal vor, man würde Stefan entführen oder Henrik.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte Claudia bestürzt. »Ein entführtes Kind kann es doch wohl kaum sein. Das würde doch nicht in einen fremden Kinderwagen gesetzt. Man würde Lösegeld dafür verlangen.«
»Vielleicht hat man dieses bekommen und wollte das Kind möglichst rasch und unauffällig loswerden.«
»Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen«, sagte Claudia nachdenklich. »Aber warum hat man sich ausgerechnet meinen Kinderwagen ausgesucht?«
»Zufall wahrscheinlich.«
»Na, dann könnte ich nur sagen, dass wir vom Himmel auserwählt sind, solche Zufälle zu erleben. Nein, Denise, ich kann es nicht glauben. Zufälle laufen einem nicht nach.«
»Vielleicht haben wir eine magnetische Anziehungskraft«, überlegte Denise. »Dieses Kind ist so süß, dass keine Mutter es fertig bringen würde, es auszusetzen.«
»Du lässt dich von deinen eigenen mütterlichen Gefühlen leiten. Gib ihn mir mal.«
Dadi, wie er nun genannt wurde, fand es anscheinend sehr belustigend, von einem Arm auf den anderen zu wandern. Er patschte Claudia mit seinen festen Händchen kräftig ins Gesicht und zeigte lachend seine weißen Zähnchen.
»Ein Psychologe würde aus seinem Benehmen wahrscheinlich schließen, dass er gewöhnt ist, von mehreren Frauen betreut zu werden«, vermutete Denise.
»Oder aber, dass er ein freundliches Kind ist«, lächelte Claudia nachsichtig. »Stefan geht ja auch zu dir und zu seiner Omi, ohne Geschrei anzustimmen.«
»Aber er mault, wenn ihn ein anderer auf den Arm nimmt, na ja, meine Vermutung mag vage sein, aber sein Instinkt sagt mir, dass es auf keinen Fall seine Mutter war, die ihn in euren Kinderwagen setzte.«
»Aber auch nicht jemand, dem er völlig gleichgültig war«, stellte Claudia fest. »Er war gewaschen, frisch gekleidet und gefüttert. Aber was meinst du, sollten wir uns nicht auch unseren Söhnen widmen? Sie werden ungeduldig.«
Stefan und Henrik, die im Laufstall herumkrabbelten, machten sich lautstark bemerkbar.
»Übernimmst du sie mal?«, fragte Denise. »Ich möchte mich mal um die Fellmann-Kinder kümmern. Frau Fellmann ist heute Morgen heimgefahren. Der Junge hat sich ja ganz manierlich benommen, aber mit dem Mädchen werden wir noch allerlei auszustehen haben, wie mir scheint.«
»Vielleicht sollte man sie mal übers Knie legen«, stellte Claudia drastisch fest.
Denise warf ihr einen missbilligenden Blick zu. »Sie ist acht Jahre alt«, bemerkte sie.
»Und mit Verlaub gesagt, ein unverschämt verzogenes Gör«, kam die rasche Erwiderung. »So was hatten wir hier noch nicht.«
»Pure Opposition, weil sie nicht Mittelpunkt ist. Das wird sich legen.«
»Du bist eine unverbesserliche Optimistin, Denise.«
Denise von Schoenecker lächelte. »Ich erinnere mich an eine Zeit, in der du das Gegenteil davon behauptet hast.«
»Es muss ziemlich lange her sein«, erwiderte Claudia mit einem leisen Lachen.
»So lange nun auch wieder nicht. Es scheint nur so, als hätte die Zeit Flügel, Claudi. Man möchte sie gern anhalten.«
»Aber was nützt es. Das können wir leider nicht. Na dann eile zu den Fellmann-Kindern. Wie ich Henrik kenne, hält er es nicht lange ohne seine Mutti aus.«
Denise warf ihrem kleinen Sohn einen langen Blick zu. »Mir scheint eher, dass er ein richtiges Vaterkind ist«, stellte sie nachdenklich fest. Er kann noch so müde sein, aber wenn er Alexander bemerkt, ist er sofort hellwach.«
»Dann pass nur schön auf, dass er ihn nicht zu sehr verwöhnt. Ich habe auch meine Liebe Not mit Opa und Oma und am Ende sehe ich mich gezwungen, ihn eines Tages auch noch in Sophienlust einzuquartieren, damit er nicht zu übermütig wird.«
*
»Brauche ich nicht zur Schule gehen?«, erkundigte sich Cornelia hoffnungsvoll bei Schwester Gretli.
»Heute nicht. Sie haben Ausflugstag. Du kannst dich erst ein bisschen eingewöhnen.«
»Ich gewöhne mich nicht ein«, erwiderte das Kind hochfahrend. »Ich wollte nicht her. – Warum ist Rosi nicht da?«, fragte sie dann zögernd, als Schwester Gretli nicht auf ihre Bemerkung einging.
»Sie ist natürlich mit zum Schulausflug«, kam die Erwiderung.
»Ich will nicht wieder mit ihr in einer Klasse sein«, begehrte Cornelia auf.
»Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Es sei denn, du willst noch mal die zweite Klasse wiederholen.«
Cornelia schaute sie verachtungsvoll an. »Ich bin viel schlauer als Rosi«, versicherte sie grimmig ernst.
»Bilde dir nicht zu viel ein«, erklärte Schwester Gretli gelassen. »Sie ist eine der Besten in der Klasse.«
Cornelia verschlug es die Stimme. War sie auch nicht gerade fleißig oder gar ehrgeizig gewesen, so hatte sie doch immer eine Note besser abgeschnitten als Rosi. Und jetzt sollte diese besser sein?
»Cornelia, du hast heute Morgen wieder nichts gegessen«, mischte sich Frau Rennert ein.
Es hatte sie ungeheuere Überwindung gekostet, aber sie wollte Michael beweisen, dass sie zu ihrem Wort stand. Sie ärgerte sich fürchterlich darüber, wie er sich auf das Frühstück gestürzt hatte.
»Ich werde auch nichts essen. Nie. Ich fahre mit meiner Mutti nach Hause«, erklärte sie trotzig.
»Deine Mutti ist schon heimgefahren«, eröffnete ihr Frau Rennert. »Ganz früh.«
»Ohne uns auf Wiedersehen zu sagen?« Cornelias Augen funkelten wütend.
»Ihr habt noch geschlafen. Ausnahmsweise darfst du in der Küche noch frühstücken, wenn du möchtest.«
»In der Küche – bei den Dienstboten?«, fragte Cornelia empört.
»Wir bezeichnen unsere Angestellten nicht so. Sie gehören zu uns«, erwiderte Frau Rennert ruhig. »Aber scheinbar hast du tatsächlich keinen Hunger. Geh zu den anderen Kindern. Carola spielt mit ihnen im Pavillon.«
Ich werde es euch schon zeigen, dachte Cornelia, als sie sich plötzlich allein sah. Ich laufe weg und dann bekommt ihr Ärger. Mutti und Vati werden schon dafür sorgen.
Sich vorsichtig umschauend entfernte sie sich, bereit, in einem unbeobachteten Augenblick zu entwischen.
Aber bei den Rosenbeeten im Park arbeitete ein Mann, und drüben tauchten auch ein paar Erwachsene auf, und dann bellte ein Hund zu ihren Füßen, legte sich nieder und schaute sie aus feuchten Augen an. Es war ein schöner Hund. Da niemand ihre Gedanken erraten konnte, gestand es sich Cornelia ein. Sie überlegte, ob sie ihn streicheln dürfte, da rieb er seine Schnauze auch schon an ihrem Bein.
»Du bist ein schöner Hund«, sagte sie. »Um dich kümmert sich auch niemand. Da sieht man mal, wie die Leute hier sind.«
»Wauwau«, bellte Senta und da kamen fünf ihrer Hundekinder herbei. Ein paar größere und ein paar kleinere. Cornelia schaute recht verdutzt, als sie sich um ihre Mutter scharten.
Und dann stand plötzlich Denise von Schoenecker neben ihr. »Nun mit Senta und ihren Jungen hast du dich scheinbar schon angefreundet, Cornelia«, sagte sie ruhig. »Ich hoffe, dass du dich bald einleben wirst.«
Cornelia wollte gern widersprechen, aber mit dieser Dame konnte sie einfach nicht so reden wie mit den anderen. Um sich jedoch nichts zu vergeben, schwieg sie lieber.
»Dort ist der Pavillon«, erklärte Denise gelassen. »Du bist ja die falsche Richtung gegangen. Ich gehe mit dir.«
Aus dem Pavillon schallten fröhliche Kinderstimmen. Jemand spielte Klavier.
»Die singen ja falsch«, sagte Cornelia. »Ich habe in Singen eine Eins.«
»Dann mach es ihnen doch vor«, forderte Denise sie lächelnd auf.
Es war für Cornelia eine gute Gelegenheit zu beweisen, dass sie mehr konnte, als die anderen. Dieses Bewusstsein stärkte ihr Rückgrat.
Michael blinzelte ihr zu, als sie an Denise von Schoeneckers Seite den hellen Raum betrat. Cornelia tat so, als kenne sie ihn gar nicht. Wolfgang Rennert erhob sich erwartungsvoll vom Klaviersessel.
»Cornelia möchte mit euch singen«, sagte Denise. »Fangt noch mal an.«
»Nele kann gut singen«, tönte Michaels Stimme in das Schweigen hinein.
»Ich kenne das Lied nicht«, erklärte Cornelia trotzig.
»Freilich kennst du es«, versicherte Michael. »Du hast es doch in der Schule gelernt.«
Sie warf ihm einen flammenden Blick zu. »Er weiß alles besser«, murmelte sie.
»Vielleicht kannst du auch schon Klavierspielen«, fragte Wolfgang Rennert.
»Ein bisschen«, entfuhr es Cornelia nun doch gegen ihren Willen. »Ich mag aber nicht.«
»Nun, dann später vielleicht mal«, meinte er gleichmütig.
»Frau Rennerts Sohn hatte sich herausgemacht. Er war ein selbstsicherer Mann geworden, der an seiner Aufgabe gewachsen war und seinen Pflichten mit viel Einsatzkraft nachkam. Er verstand es meisterhaft, die Kinder in Schach zu halten, mit ihnen umzugehen und ihnen auch all das beizubringen, wozu in der Schule nicht viel Zeit war.
Frau Rennert selbst war überglücklich, dass seinen vielseitigen Begabungen so viel Entfaltungsmöglichkeiten in Sophienlust geboten wurden.
Er gab den Kindern Zeichen- und Musikunterricht, überwachte bei den Schulpflichtigen die Hausaufgaben, bereitete die Kleinen gewissenhaft auf die kommende Schulzeit vor und war immer dann zur Stelle, wenn man ihn in schwierigen Situationen brauchte.
Niemand sprach mehr davon, dass er einmal einen Schritt vom rechten Wege abgewichen war und die, die sich daran erinnerten, wussten heute, dass er es nur für seine Mutter getan hatte.
Nun, zum Singen hatte Cornelia sich nun doch durchgerungen, um sich vor allem vor den anderen zu produzieren, aber siehe da, es wollte gar nicht so gut klappen, wie sie es gedacht hatte. Vielleicht kam es daher, weil alle Augen so erwartungsvoll und kritisch an ihren Lippen hingen, vielleicht aber auch daher, weil diese Kinder so friedfertig vereint dasaßen und sie abseits stand, mit all ihren Vorurteilen belastet.
Als sie falsche Töne über die Lippen brachte, stockte sie und begann zu weinen.
»Liebe Güte, heulen brauchst du doch deswegen nicht«, ließ Toni sich vernehmen, der sich bemüßigt fühlte, Michaels Schwester ein wenig aufzumuntern. »Das ist doch alles halb so schlimm.«
»Das ist nur Lampenfieber«, mischte sich auch Denise von Schoenecker freundlich ein. »Hör erst eine Weile zu, Cornelia, dann geht es ganz von selbst.«
»Komm, setz dich neben mich«, forderte Carola die Kleine auf, was Cornelia dann auch nach kurzem Zögern tat.
*
Die Schulkinder waren auf ihrem Ausflug. Dominik hatte es noch immer nicht verwunden, dass er hatte mitgehen müssen und so die Fellmann-Kinder und das Findelkind noch nicht anschauen konnte. Er hielt sich dagegen an Rosi, von der er eingehende Informationen erhoffte.
Rosi zeigte sich allerdings sehr wortkarg, was die Fellmann-Kinder anbetraf.
»Wenn sie ekelhaft zu dir sind, dann werde ich denen was erzählen«, meinte Dominik aggressiv.
»Ich gucke sie gar nicht an«, versicherte Rosi.
Dominik überlegte. »Das geht auch wieder nicht«, meinte er vernünftig. »Mutti mag das nicht. Wir wollen Frieden haben. Wir wollen uns doch alle verstehen.«
»Mal sehen, was du sagst, wenn du sie erst besser kennst«, meinte Rosi. »Na ja, Michael hat sich ja gar nicht so blöd benommen, aber Cornelia verträgt es nicht, wenn sich nicht alles um sie dreht.«
Sie hatte bereits vergessen, dass sie nicht viel anders gewesen war, aber daran wurde sie sehr unbekümmert von Dominik erinnert.
»Du hast dich auch ganz schön angestellt, als du die erste Zeit hier warst«, stellte er fest.
Rosi sah ihn verwundert an. Das konnte sie sich gar nicht mehr vorstellen.
»Staunen wird sie ja, dass ich in der Schule so gut bin«, meinte sie stolz. »Was meinst du, wie frech sie manchmal war.«
Dazu schwieg Dominik lieber, denn er war auch manchmal ganz schön frech.
»Komm, gehen wir mit Kati«, schlug er vor. »Omi hat ihr bestimmt was ganz Leckeres mitgegeben.«
Rosi hatte es zuerst nicht begriffen, dass Katis Mutti zugleich Dominiks Omi war, aber wie es dazu kam, hatte er ihr schon einmal erzählt.
Es war wie im Märchen, dass ein armes kleines Mädchen von reichen Leuten adoptiert worden war, und dass aus einer Katy Ebert eine Kati von Wellentin wurde.
Rosi hatte ein solches Märchen nicht erlebt. Ganz im Gegenteil. Aus dem verwöhnten Kind, dem jeder Wunsch erfüllt wurde, war ein bescheidenes Mädchen geworden. Das aber wurde ihr gar nicht bewusst. Sie hatte richtige Freunde gefunden, es war ihr zur Selbstverständlichkeit geworden, alles mit ihnen zu teilen, wie es auch Dominik und Kati taten, und Sascha und Andrea.
Frohen Mutes marschierten die drei Kinder hinter den anderen her, und Rosi vergaß, sich Sorgen über Cornelia Fellmann zu machen.
*
Lilly Rank hatte es gar nicht begreifen können, dass sie mit dem Geld entkommen war. Querfeldein war sie gelaufen und an der Straße, die nach Norden führte, hatte ein Auto angehalten, das sie mitnahm.
Sie bedachte in ihrer Furcht vor Joschi gar nicht, dass ihr daraus erneute Gefahr erwachsen könnte. Aber der Fahrer des Kombiwagens war ein gutmütiger, biederer Mann, der sie mitleidig betrachtete.
»Junge Mädchen sollten zu so später Stunde nicht mehr allein auf der Landstraße sein«, hatte er nur besorgt geäußert. »Meiner Tochter würde ich schön die Leviten lesen. Ist das Geld ausgegangen?«, fragte er dann.
Einen ganzen Koffer voll Geld hatte sie, aber sie nickte beklommen.
»Wohin wollen Sie denn?«, erkundigte er sich.
Ihr fiel keine andere Stadt ein, als jene, in der sie Patrick ausgesetzt hatte. Als sie den Namen aussprach, wurde es ihr heiß.
»Den Verbrecher zieht es an den Ort der Tat zurück«, ging es ihr durch den Sinn.
Aber sie wollte ja gar nicht dorthin. Sie hatte es nur so gesagt. Danach spürte sie aber doch, dass sich ihre Gedanken nur mit Patrick beschäftigten.
Gewiss hatte sie ihre Kusine Martina beneidet um alles, was sie besaß, aber den kleinen Jungen hatte sie gern gehabt. Er war ein so fröhliches Kind, und sie war immer ganz stolz gewesen, wenn er bewundert wurde, wenn sie mit ihm spazieren fuhr.
Wie hatte sie sich nur von Joschi zu diesem schrecklichen Unterfangen überreden lassen können? Es war ihr doch klar gewesen, was er beabsichtigte. Nein, es gab keine Entschuldigung für sie. Sie hatte sich diese nur eingeredet, weil sie so maßlos verliebt in ihn gewesen war, und weil sie ihn nicht verlieren wollte.
Nun staunte sie über sich selbst, dass sie es fertigbrachte, ihm zu entfliehen und sie empfand sogar einen gewissen Triumph, dass sie ihn um das Geld gebracht hatte.
Aber was wollte sie eigentlich tun? Konnte sie irgendwo unterschlüpfen, wo er sie nicht finden würde?
»In dieser Stadt sucht er mich bestimmt nicht«, ging es ihr durch den Sinn. Aber sicher war sie dort auch nicht. »Ob man schon in Erfahrung gebracht hatte, wohin Patrick gehörte?«, überlegte sie weiter.
Ihr Gewissen peinigte sie. Das Gute in ihr regte sich. Vielleicht konnte sie in Erfahrung bringen, wo sich Patrick befand. Wahrscheinlich würde man in der Zeitung darüber schreiben.
»Was mache ich nun mit Ihnen«, sagte der Mann am Steuer. »Ich bin gleich am Ziel. Meine Familie erwartet mich. Ich bin Vertreter müssen Sie wissen. Morgen früh muss ich wieder raus. Ich fürchte auch, dass es meine Frau nicht gern sehen würde, dass ich ein junges Mädchen mitnehme, obwohl sie weiß Gott unbesorgt sein kann. Aber Sie verstehen das sicher. Frauen machen sich ihre eigenen Gedanken, wenn man dauernd unterwegs ist. Auch wenn man nicht mehr der jüngste ist.«
»Ich verstehe das alles«, sagte Lilly leise. »Sie waren sehr nett. Ich möchte Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten.«
»Da ist ein ganz solider Gasthof«, sagte der hilfsbereite Mann. »Ich werde Ihnen das Geld für die Übernachtung geben.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, wehrte sie ab. »So viel habe ich schon noch.«
»Aber machen Sie bloß nicht die Dummheit, jetzt noch ein anderes Auto anzuhalten«, ermahnte er sie. »Es ist fast Mitternacht. Man könnte gar zu leicht auf den Gedanken kommen, dass Sie ein Abenteuer suchen. Haben Sie Angehörige?«
Lilly nickte. Sie dachte nicht nur an Martina, sie dachte jetzt vor allem an ihre Mutter. Niemals würde diese erfahren, dass auch sie den Namen Runk in Verruf gebracht hatte. Erst jetzt, da sie Joschis Einfluss entflohen war, wurde ihr bewusst, in welche schreckliche Bedrängnis sie sich und andere gebracht hatte.
Lieber Gott, er hatte sie mit Engelszungen beredet und ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Dabei hatte er auch sie belogen und betrogen.
Was er wohl für ein Gesicht machen würde, wenn er den Koffer nicht mehr vorfand und sie auch nicht?
»So, da wären wir«, sagte ihr freundlicher Helfer. »Da brennt ja auch noch Licht. Man kennt mich dort. Sie sind mir doch nicht böse, wenn ich vermeiden möchte, dass ich in ein falsches Licht gerate. Die Menschen haben so viele Vorurteile. Sie denken immer nur das Schlechte.«
Oder auch nicht, ging es Lilly durch den Sinn, während ihre Gedanken wieder zu Martina wanderten. Sie hatte ihr vertraut. Sie hatte nie das Schlechte gedacht. Sie hatte sie sogar vor Joschi gewarnt.
Was würde dieser brave, freundliche Mann wohl sagen, wenn er wüsste, dass er eine niederträchtige Kindesentführerin mitgenommen hatte? Konnte man ihr das schlechte Gewissen nicht vom Gesicht ablesen?
»Ich danke Ihnen herzlich«, sagte sie leise, als sie ausstieg.
»Nichts zu danken. Brauche ich Ihnen wirklich nicht auszuhelfen?«
Wenn er wüsste, wie viel Geld sich in diesem Koffer befindet, dachte sie, und wie ich dazu gekommen bin, wäre er bestimmt nicht mehr so freundlich. Sie schämte sich entsetzlich unter seinem besorgten Blick.
Er wartete, bis sie die Tür des Gasthofes geöffnet hatte. Zitternd lehnte sie an der Mauer, unschlüssig, ob sie hier wirklich übernachten sollte.
Da trat ein junger Mann aus einem Raum, ihm folgte ein Polizist in Uniform.
Lilly war starr vor Schrecken. Alles um sie begann sich zu drehen. Rote Funken tanzten vor ihren Augen.
»Hoppla, wen haben wir denn da noch zu so später Stunde«, sagte eine Männerstimme, die so klang als würde sie aus ganz weiter Ferne kommen.
Lilly versuchte noch einmal die Augen zu öffnen, aber sie sah nur verschwommen die Uniform, und dann sank sie ohnmächtig zu Boden.
»Entweder ist sie meilenweit gelaufen, dass sie ganz erschöpft ist«, stellte der junge Mann erschrocken fest. »Die Schuhe sehen danach aus. – Oder – du hast ihr solchen Schrecken eingejagt, Schorsch.«
»Dann müsste sie ja was auf dem Kerbholz haben«, stellte der junge Polizist fest. »Aber so sieht sie nicht aus. Hast du ein Zimmer frei, Luis?« Und als der andere nickte, fuhr er fort: »Dann bringen wir sie hinauf und ich sage Dr. Bollmann Bescheid.«
Luis Olberg, der junge Gastwirt, winkte ab, als sein Freund Schorsch ihm helfen wollte.
»So ein Fliegengewicht schaffe ich schon allein. Nimm du den »Koffer«, sagte er. »Sonst hatte sie wohl nichts bei sich. Schau doch mal draußen nach. Eine Frau ohne Handtasche, das gibt’s doch gar nicht.«
Aber eine Handtasche war nirgends zu finden. »Dann öffne doch im Namen des Gesetzes mal den Koffer«, meinte Luis Olberg.
»Ich bin nicht im Dienst«, erwiderte der junge Mann zögernd.
»Na, wenn er verschlossen ist, lassen wir es. Aber man sollte doch wissen, mit wem man es zu tun hat.«
Er bettete die Bewusstlose in einem Gästezimmer auf das Bett, als ihn ein ächzender Laut herumfahren ließ.
»Allmächtiger«, rief sein Freund Schorsch aus. »Sieh dir das an! Das Madel geht mitten in der Nacht mit einem Vermögen spazieren. Kein Kleid, keine Wäsche, nur Geld!«
»Komisch«, brummte Luis Olberg. »Dabei sieht sie so brav aus. Das sieht doch sehr nach einer kriminellen Sache aus.« Er starrte die Geldbündel an. »Wie viel ist es?«
»Beinahe Hunderttausend«, brummte Schorsch. »Da werde ich vorsichtshalber mal den Chef in Bewegung setzen.«
*
Müde, hungrig und durstig waren die Kinder von ihrem Ausflug nach Sophienlust heimgekehrt.
Obgleich alles zu ihrer Stärkung bereitstand, hatte Dominik erst noch wichtigeres zu tun. Er wollte endlich das Baby sehen. Das war ihm noch wichtiger als die Fellmann-Kinder.
Für die eigene Familie war Dominik zwar gegen jeden weiteren Zuwachs, aber sonst hatte er kleine Kinder sehr gern.
»Wasch dir erst die Hände, bevor du ihn anfasst«, ermahnte ihn seine Mutter. »Du klebst ja förmlich.«
»Er ist niedlich«, stellte Dominik fest. »Können wir ihn behalten?«
»Das muss sich erst herausstellen.«
»Ich würde ihn nicht mehr hergeben, wenn er schon eine solche Rabenmutter hat.«
»Wir wissen ja noch gar nicht, ob er eine Rabenmutter hat«, meinte Denise. »Aber jetzt wasch dir bitte die Hände, Nick.«
Er tat es in Blitzgeschwindigkeit und war gleich wieder da. »Wenn es keine Rabenmutter war, dann war es eben ein Rabenvater«, fuhr er in seinen Gedankengängen fort. »Wer sonst?«
Denise kannte ihren Sohn zur Genüge um zu wissen, dass er sich damit nun eingehendst befassen würde.
»Es ist einfach eine Gemeinheit, findest du nicht? Wenn ihn nun Claudia und Edith nicht gefunden hätten, sondern jemand, der Kinder umbringt?«
»Sie haben ihn aber glücklicherweise gefunden«, dämpfte Denise seine rege Fantasie. »Bist du nicht hungrig, Nick?«
Dominik beugte sich zu dem Kleinen hinab. »Du hast ein Mordsglück gehabt, Baby«, stellte er fest. »Ausgerechnet an den schönsten Platz der Welt bist du gekommen. Wenn sie dich nun in den Wald gelegt hätten, wo Schlangen und wilde Tiere sind.«
»Bei uns gibt es keine wilden Tiere, Nick.«
»Aber im Wald hätte man ihn nicht finden können«, meinte er unwillig. »Und dann wäre er verhungert.«
»Nick!«, schallte es über den Gutshof, »nun komm doch endlich.«
Er warf noch einen langen Blick auf das Baby. »Ein richtiges Biest muss das sein, die so ’nen niedlichen kleinen Jungen aussetzt«, stellte er noch empört fest, dann stampfte er davon.
Eine warme Welle durchflutete Denise, als sie ihm nachblickte. Mochte er auch manchmal schwierig sein, er hatte ein weiches Herz. Hätte sie ihn jedoch zehn Minuten später gesehen, wären ihr daran gelinde Zweifel gekommen. Die erste Begegnung zwischen Dominik von Wellentin und Cornelia Fellmann verlief weit weniger freundlich.
Nick war entschlossen gewesen, keinen Zwist aufkommen zu lassen, als er Cornelia und Michael begrüßte, aber schon die ersten Worte Cornelias stachelten seinen Jähzorn an.
»Wenn du denkst, du bist was Besseres als wir«, sagte sie herablassend, »täuschst du dich. Unsere Eltern zahlen nämlich eine Masse Geld für uns.«
»Na und?«, fauchte er sie an. »Andere zahlen auch, bloß hier wird nicht darüber geredet.« Er schnaufte hörbar. »Und das eine sage ich dir gleich: wenn du Rosi blöd anredest, kriegst du von mir eine geschmiert.«
»Nick«, rief Carola verweisend, »du sollst nicht streiten.«
»Ich will nicht streiten«, verwahrte er sich, »aber die braucht sich nicht so aufzuspielen.«
Demonstrativ setzte er sich neben Rosi nieder. »Na, hab ich’s ihr gegeben?«, raunte er ihr zu.
Rosi lächelte verschüchtert. Sie fürchtete mit Recht, dass Cornelia ihren Zorn nun an ihr auslassen würde. Augenblicklich wagte sie es zwar nicht, weil Frau Rennert in den Essraum gekommen war, aber sie schoss schon wütende Blicke zu ihr herüber.
»Sei doch nicht so«, raunte Michael seiner Schwester zu. »Rosi tut dir doch gar nichts.«
Aber seine einlenkenden Worte fanden bei Cornelia kein Gehör. Sie war noch lange nicht bereit, ihre feindselige Haltung aufzugeben.
*
Während der Abend in Sophienlust, dank Frau Rennerts Autorität, ohne weitere Zwischenfälle verlief, und der kleine Patrick in einem Kinderbett oben friedlich schlief, gerieten seine Eltern langsam in einen Panikzustand.
Joachim Diering hatte Lillys Mutter aufgesucht, war aber auf empörte Abweisung gestoßen, als er ihre Tochter in Zusammenhang mit Patricks Entführung brachte. Sie bejammerte schluchzend das ungewisse Schicksal Lillys und ereiferte sich darüber, dass man sie nicht längst schon unterrichtet hatte.
Joachim Diering wagte kaum, seiner verzweifelten Frau unter die Augen zu treten.
Da erreichte sie die Nachricht, dass man Joseph Novac an der Grenze festgenommen hatte, er aber weder im Besitz des Lösegeldes für Patrick gewesen sei, noch in Begleitung von Lilly gewesen wäre. Novacs Behauptung, dass er Lilly den Wagen abgekauft hätte, sei nicht zu widerlegen gewesen. Zudem hatte er beteuert, weder sie, noch das Kind in letzter Zeit gesehen zu haben.
Martina Diering war einem Nervenzusammenbruch nahe. Es war begreiflich, dass sie sich das Schlimmste ausmalte, und auch ihr Mann war zutiefst deprimiert.
»Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Liebes«, sagte Joachim Diering zu seiner Frau, aber seinen Worten fehlte die Überzeugungskraft.
Die Minuten schlichen dahin. Wieder brach eine Nacht herein, vor der beide sich fürchteten. Qualvolles Schweigen lastete in dem Haus, bis das Läuten des Telefons die Stille wieder zerriss.
Joachim Dierings Hand zitterte, als er den Hörer aufnahm. »Gebe es Gott«, hörte ihn Martina nach Sekunden aufstöhnen.
Mit fahlem, verstörtem Gesicht lehnte er an der Wand. »So sprich doch«, schrie sie auf. »Was ist?«
»Man hat vor zwei Tagen einen kleinen Jungen in einer süddeutschen Stadt gefunden, dessen Beschreibung auf Patrick zutreffen könnte. Er ist in einem Kinderheim untergebracht worden. Gut Sophienlust heißt es.«
»Es muss Pat sein«, flüsterte sie. »Er muss es sein, Jo!«
»Er war allein. Man hat ihn in einem fremden Kinderwagen gefunden.«
Angst und Zweifel drückten sich in seinen Worten aus. Seine Frau starrte ihn blicklos an.
»Und Lilly?«
Er zuckte resigniert die Schultern. »Von Lilly keine Spur«, murmelte er verlegen.
»Wir müssen hinfahren, Jo. Sofort. Wir müssen uns überzeugen, ob es Pat ist. Er kann doch nicht sprechen. Er kann doch nicht sagen, ob er unser Sohn ist. Was hatte er an?«
Das hatte man ihm nicht gesagt. Und als er nachfragen wollte, konnte man ihm nur die Auskunft geben, dass die Babykleidung ladenneu gewesen sei.
Als sie in die düstere, regnerische Nacht hineinfuhren, hatten sie nur eine vage Hoffnung, ihr Kind wiederzufinden.
*
Als Lilly aus ihrer langen Bewusstlosigkeit erwachte, sah sie verschwommen zwei Männergesichter. Ein junges und ein faltiges.
»Ich glaube, sie kommt jetzt zu sich«, hörte sie eine Stimme.
Sie wollte die Stimme nicht hören. Sie wünschte sich, wieder in Bewusstlosigkeit zu versinken und möglichst nicht mehr zu erwachen. Aber zwei Hände umfassten ihre Schultern und schüttelten sie, und wieder drang die Stimme an ihr Ohr.
»Aufwachen!«
Es klang freundlich, nicht böse. Sie blinzelte. Das helle Licht des Tages blendete sie.
»Wer sind Sie?«, tönte es an ihr Ohr.
Ihre Lippen pressten sich aufeinander. Ihre Augen schlossen sich wieder.
»Wer sind Sie?«
»Ich weiß nicht«, murmelte sie.
»Erinnern Sie sich. Wie sind Sie hierhergekommen?«
Schlagartig erinnerte sie sich. Der freundliche Mann, der sie mit dem Wagen mitgenommen hatte, hatte sie vor dem Gasthof abgesetzt, und dann hatte sie die Uniform eines Polizisten gesehen.
Von den beiden Männern, die an ihrem Bett standen, trug keiner eine Uniform.
»Ich bin Arzt«, sagte der ältere, und sie öffnete wieder langsam die Augen. »Dr. Bollmann.«
»Wie lange bin ich schon hier?«, fragte sie leise.
»Genau vierunddreißig Stunden«, sagte nun der jüngere. »Es ist jetzt zehn Uhr morgens.«
»Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin«, stieß sie trotzig hervor.
»Aber vielleicht können Sie sich erinnern, wie Sie zu einem Koffer mit so viel kommen«, fuhr Luis Olberg energisch fort.
»Achtundneunzigtausend«, wiederholte sie mechanisch. Joschi hatte gesagt, er hätte fünfzigtausend von Joachim Diering bekommen.
»Mein Kopf tut weh«, flüsterte sie.
»Sie wird Hunger haben und Durst«, stellte Luis Olberg fest.
Seine Miene verriet Mitgefühl. Lilly warf ihm einen raschen Seitenblick zu. Er war ein sympathischer junger Mann. Ein Durchschnittstyp, aber Energie und Zuverlässigkeit standen ihm ins Gesicht geschrieben.
»Man erwartet einige Auskünfte von dem Fräuleinchen«, ließ Dr. Bollmann vernehmen. »Und ich muss Krankenbesuche machen.«
»Ich werde schon aufpassen, dass sie nicht ausreißt«, erklärte Luis Olberg.
Lilly wurde blass. Suchend blickte sie sich im Zimmer um. Der Koffer war nirgends zu sehen.
»Das Geld ist gut verwahrt«, stellte Luis Olberg fest.
Beklommen blickte Lilly an sich herab. Sie trug ein Nachthemd, das ihr nicht gehörte, und plötzlich erinnerte sie sich, dass sie all ihre Sachen in dem Gasthof zurückgelassen hatte. Auch ihre Handtasche mit den Ausweispapieren.
»Das Nachthemd gehört meiner Schwester. Sie wird Ihnen jetzt auch das Frühstück bringen«, sagte der junge Mann unverändert freundlich. »Ist es nicht besser für Sie, wenn Sie uns wenigstens sagen, wer Sie sind?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte sie wieder bockig. Sie musste einen Ausweg finden. Sie musste von hier entkommen, auch ohne das Geld. So gescheit war Lilly nicht, dass sie alle Folgen ihres Handelns voraussehen konnte. Ihre Mutter würde ihr schon helfen, daran klammerte sie sich.
Aber jetzt hatte sie wirklich Hunger und eine Weile konnte sie wohl noch Gedächtnisschwund vorschützen, bis sie eine Möglichkeit gefunden hatte, an ihre Kleider heranzukommen.
Ob man Joschi bereits aufgespürt hatte, überlegte sie weiter. Aber sie war sich fast sicher, dass er sie nicht verraten würde, um seine eigene Haut zu retten.
Ein junges, frisches Mädchen erschien, beladen mit einem Tablett. Verlockende Düfte stiegen in Lillys Nase. Das Mädchen betrachtete sie ein wenig argwöhnisch, lächelte dann aber freundlich.
»Ich bin Margit Olberg«, stellte sie sich vor, »die Schwester von Luis.«
»Ist das der junge Mann?«, erkundigte sich Lilly neugierig. »Sind Sie die Besitzer des Gasthofes?«
Margit Olberg nickte. »Die Eltern haben sich zur Ruhe gesetzt. Sie sind nimmer zurechtgekommen mit der modernen Zeit, mit der Musikbox und so. Aber man muss heute den Gästen schon etwas bieten, damit sie nicht alle zur Konkurrenz laufen.«
Lilly blickte sich in dem freundlichen Gastzimmer um. Moderne Möbel, luftige Gardinen, hübsche Bilder an den Wänden.
»Es scheint Ihnen zu gelingen, es den Gästen gemütlich zu machen«, stellte sie fest.
»O ja, wir sind zufrieden«, meinte Margit Olberg. »Der Luis ist ja auch tüchtig. Da kann es gar nicht schiefgehen. Woher kommen Sie denn und wie sind Sie ausgerechnet hierhergekommen? Wir haben doch gar keine Bahnstation.«
Es klang harmlos, aber Lilly war wachsam. Nein, über sich wollte sie nichts sagen.
»Ich weiß nichts mehr«, erwiderte sie wieder. »Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern.«
Und der nette alte Herr wird hoffentlich auch weiterhin aus Angst um seinen Ruf schweigen, hoffte sie.
»Sie können uns ruhig vertrauen«, fuhr Margit fort, mit keiner Miene verratend, dass Luis und Schorsch, der Polizist Georg Händle, mit dem sie befreundet war, sie beauftragt hatten, die Fremde auszuhorchen.
Wem kann ich schon noch vertrauen, dachte Lilly niedergeschlagen, und mir kann erst recht keiner vertrauen. Pat – es wird ihm doch um Gottes willen nichts geschehen sein! Wenn sie doch nur Gewissheit hätte.
»Könnte ich vielleicht eine Zeitung bekommen?«, fragte sie leise.
»Sicher doch«, erwiderte Margit.
*
»Sie will eine Zeitung«, sagte sie wenig später zu ihrem Bruder. »Vermutlich will sie nachschauen, ob sie gesucht wird. Hast du was gelesen, Luis?«
»So genau habe ich noch nie eine Zeitung studiert«, brummte er, »aber kein Sterbenswörtchen steht drin von einem vermissten Mädchen und auch nichts von einem Diebstahl. – Es ist alles sehr merkwürdig. Sie sieht nicht wie eine Verbrecherin aus.«
»Es gibt Frauen, die ein Engelsgesicht haben und Menschen umbringen«, meinte sie skeptisch.
»Aber doch nicht sie«, entgegnete er rasch. »Nie und nimmer. Und von einem Raubmord hätte bestimmt etwas in der Zeitung gestanden, oder wir hätten es im Radio gehört. Die einzige Meldung, die heute von der Kriminalpolizei durchgegeben wurde, war, dass ein neun Monate alter kleiner Junge vermisst wird.«
Er hatte die Nachrichten wirklich sehr aufmerksam verfolgt, aber mit dem Kind brachte er die Fremde nicht in Zusammenhang.
»Sie sagt nichts«, meinte Margit. »Hoffentlich kommt jetzt der Kommissar aus der Stadt bald. Mag sie dir auch gefallen«, fuhr sie anzüglich fort, »ich möchte nicht, dass unser Gasthof in Verruf kommt.«
Luis Olberg drehte sich auf dem Absatz um. »Ich werde ihr die Zeitung bringen und mit ihr reden«, brummte er.
»Lass dich nicht einwickeln. Wenn ich auch alles glaube, aber dass sie das Gedächtnis verloren hat, scheint mir doch sehr unwahrscheinlich.«
Er murmelte noch etwas Unverständliches, dann stieg er die Treppe hinauf.
Lilly errötete, als er eintrat. »Na, hat es geschmeckt?«, erkundigte er sich freundlich. »Hier ist die Zeitung.«
»Es hat sehr gut geschmeckt«, erwiderte sie. »Vielen Dank. Sie sind sehr nett, dabei habe ich nicht einmal Geld bei mir, um die Rechnung zu bezahlen.«
Seine Augenbrauen schoben sich zusammen. »Einen ganzen Koffer voll. Achtundneunzigtausend«, knurrte er. »Machen wir uns doch nichts vor.«
Lilly schämte sich, als sie in diese ehrlichen Augen blickte, aber zu ihrem Selbstschutz beschloss sie weiterzulügen.
»Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Koffer gekommen bin«, murmelte sie.
»Na, wenn Sie es mir nicht erzählen wollen – der Kommissar wird bald hier sein. Er ist ein scharfer. Er bekommt schon heraus, was er will.«
Ihr Herz sank tiefer. Sie sah keine Möglichkeit zu entkommen. Ängstlich blickte sie sich um.
»Wenn Sie Ihre Kleider suchen und ausreißen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Ich habe mein Wort gegeben, dass Sie hierbleiben. Ich helfe Ihnen gern, aber meine Existenz setze ich Ihretwegen nicht aufs Spiel«, erklärte er energisch. »In der Zeitung steht übrigens nichts von Ihnen.«
Ein Beben durchlief ihren Körper. Alles wurde ihr schlagartig bewusst. Ihr ganzes Leben hatte sie sich verscherzt wegen Joschi, diesem Halunken. Nie wieder konnte sie einem anständigen Mann gerade in die Augen blicken.
»Wenn ich Ihnen nun alles sage«, flüsterte sie mit zitternder Stimme, »verstehen werden Sie es ja doch nicht – aber nun ist doch alles egal.«
»Selbst wenn man was angestellt hat, zur Umkehr ist es nie zu spät. Man kann sich bemühen, ein Unrecht gutzumachen. Sie sind doch keine Verbrecherin. Sie sind vielleicht auf die schiefe Bahn gekommen – eines Mannes wegen vielleicht?«
Sie nickte und dann stürmten Tränen aus ihren Augen und erst, als sie sich unter seinem tröstlichen Zuspruch beruhigt hatte, begann sie stockend zu erzählen.
*
Die ganze Nacht waren Joachim und Martina Diering gefahren. Seine Nerven waren so angespannt, dass er die Müdigkeit gar nicht spürte, die seine Glieder und auch sein Denken lähmte. Martina saß zusammengekauert neben ihm. Ihn am Steuer abzulösen, war sie unfähig.
»Wir müssen bald dort sein, Liebes«, versuchte er sie aufzumuntern. »Jetzt ist es sieben Uhr.«
Mit einer zärtlichen Bewegung streichelte sie seine Wange. »Du musst ja zu Tode erschöpft sein, Jo«, flüsterte sie. »Wenn nun alles vergeblich war.«
»Dann werden wir weitersuchen, bis wir unser Kind gefunden haben«, stellte er fest. »Und hoffentlich finden wir ihn lebend«, dachte er weiter.
»Da ist eine Raststätte«, stellte er mechanisch fest. »Wir können uns ein wenig frisch machen und einen Espresso trinken. Ich habe es nötig und du wohl auch. Wir können uns auch erkundigen, wo wir abbiegen müssen. Es kann nicht mehr weit sein.«
Er sprach sich selbst Mut zu. Die Fahrt war ihm endlos vorgekommen.
Zu seiner Erleichterung erfuhr er, dass es wirklich nicht mehr weit war. Bei der nächsten Ausfahrt mussten sie die Autobahn verlassen.
»Können wir denn so früh am Morgen dort schon erscheinen?«, meinte Martina beklommen.
»In einem Kinderheim beginnt der Tag früh. Das weiß ich noch aus meiner Kindheit. Ich habe solche Heime oft genug kennen gelernt und den Betrieb auch. Freiwillig würde ich meine Kinder niemals dorthin geben. Sie haben alle so pompöse Namen und es steckt nichts dahinter.«
»Aber wenn das Gut Sophienlust ist«, sagte Martina, aus dem Fenster blickend und talabwärts deutend, dann sieht es sehr anheimelnd aus. Ich bete zu Gott, dass wir unseren Jungen dort finden.«
Bald würden sie es wissen. Sein Herz klopfte dumpf in seiner Brust. Er fürchtete, dass Martina vollends zusammenbrechen würde, wenn sie einem Truglicht nachgejagt waren.
Und er war auch nicht weit davon entfernt.
Als sie in die Seitenstraße einbogen, kam ihnen ein roter Kleinbus entgegen. Joachim Diering musste anhalten, damit er auf der schmalen Straße in seinem schweren Wagen vorbeikam.
Neugierige Kinderaugen blickten aus den Fenstern. Auch der Bus hielt einen Augenblick an. Ein junger Mann beugte sich heraus.
»Dieser Weg führt nach Gut Sophienlust«, sagte er.
»Dorthin wollen wir«, erwiderte Joachim Diering mit belegter Stimme.
»Was die wohl wollen?«, meinte Dominik zu Rosi, die neben ihm saß. »So früh am Morgen hat Tante Rennert gar nicht gerne Besuch.«
Ihn selbst bewegte wieder einmal brennende Neugier. Fremde Leute kamen mit einem großen Wagen und er musste in die Schule, bevor er in Erfahrung bringen konnte, was sie hierherführte.
»Vielleicht wollen sie ein Kind besuchen«, meinte Rosi. »Oder eines holen.«
»Besuchen? Das glaube ich nicht. Unsere Kinder haben keine Eltern, außer Cornelia und Michael, und die Fellmanns waren’s nicht. Und holen? Nein, wen sollten sie denn holen?«
»Vielleicht das Baby«, wisperte sie.
»Das geben wir nicht mehr her«, stellte er geschwind fest. »Das ist viel zu niedlich.«
»Wenn es aber die Eltern sind?«, überlegte sie laut.
»Eltern, die einen so großen Wagen haben – bestimmt ist er sehr teuer, haben es doch nicht nötig, ihr Kind auszusetzen«, brummte er.
»Und wenn doch, dann sollten sie sich schämen.«
Währenddessen waren die Dierings schon vor dem Gutshaus angelangt. Neugierig scharten sich die kleineren Kinder gleich um den Wagen. Schwester Gretli mahnte sie freundlich zur Zurückhaltung.
»Mein Name ist Diering«, sagte er leise. »Wir kommen wegen des Findelkindes. Wir wollen uns überzeugen, ob es sich um unseren Sohn handeln könnte.«
Schwester Gretli riss die Augen auf. »Ich hole gleich Frau Rennert«, stotterte sie.
*
Frau Rennert kam nicht sofort. Als sie aus Schwester Gritlis Mund die Kunde vernommen hatte, rief sie zuerst in Schoeneich an, um Denise von Schoenecker zu verständigen.
»Die Eltern?«, fragte diese verblüfft. »Dann scheint es also doch eine Entführung gewesen zu sein. Lieber Himmel, wir sind gleich drüben.«
Frau Rennert waltete gewissenhaft ihres Amtes. Bevor Frau von Schoenecker nicht selbst anwesend war, wollte sie den Dierings keinen Zutritt zu dem Kind gestatten.
»Seien Sie doch nicht so unbarmherzig«, flehte Martina Diering. »Wir sind die ganze Nacht gefahren, um unseren Sohn zu finden. Er ist entführt worden. Verstehen Sie doch. Wir haben Lösegeld bezahlt, ihn aber nicht zurückbekommen.«
Diese Frau log nicht. Frau Rennert besaß eine gute Menschenkenntnis. Sie fieberte dem Augenblick entgegen, ihr Kind in die Arme zu schließen – aber wenn es nun nicht ihr Kind war?
Alles hatte Frau Rennert in einem bewegten, an Erfahrungen und auch Enttäuschungen reichen Leben erlebt. Verzweifelten hatte sie geholfen, Zuversichtlichen hatte sie alle Hoffnungen rauben müssen. Vor ihr standen ein Mann und eine Frau, die ihre ganze Hoffnung auf den Augenblick setzten, ein verlorenes Kind, ihr Kind, wiederzufinden.
Frau von Schoenecker wird gleich hier sein«, versprach sie. »Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich allein nicht entscheiden kann.«
»Sie brauchen doch nichts zu entscheiden«, begehrte Martina auf. »Sie brauchen uns nur das Kind zu zeigen.«
Da fuhr auch schon der Wagen der Schoeneckers vor. Genau sieben Minuten hatten sie gebraucht.
Für Denise bedurfte es nur eines Blickes, um alles in den beiden Gesichtern zu lesen.
»Meine Frau ist sehr erregt«, sagte Joachim Diering heiser. »Ich flehe zu Gott, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird.«
»Bitte, folgen Sie mir«, sagte Denise von Schoenecker zu Martina Diering, während ihr Mann zurückblieb.
Mitfühlend blickte er seiner zierlichen Frau hinterher, die hin und her schwankte. »Hoffentlich ist es keine Enttäuschung«, dachte er voller Sorge um sie.
Martina Diering sank an dem Kinderbettchen nieder. Tränen überströmten ihr Gesicht, während sich ihr gellender Aufschrei von den Lippen rang: »Pat – es ist Pat! Jo, es ist unser Kind!«
Aber durch den Schrei wurde Patrick aus seinem Schlummer geweckt und begann jammervoll zu weinen. Dieses freundliche kleine Kind, das bisher immer nur gelacht hatte, war nicht zu beruhigen.
Denise nahm ihn empor und redete mit leiser, schmeichelnder Stimme auf ihn ein.
»Er erkennt uns nicht mehr«, schluchzte Martina Diering verzweifelt. »Ja, er erkennt uns nicht.«
»Du musst dich beruhigen, Liebes«, tröstete er sie, noch immer erschüttert. »Er hat sich erschrocken. – Ja, es ist unser Sohn – Gott sei es gedankt. Und Ihnen auch tausend Dank, Frau von Schoenecker.«
»Sie sind erschöpft«, stellte Denise leise fest. »Ich werde ein Zimmer für Sie bereitstellen lassen. Ruhen Sie sich aus. Ihr Kind ist gut aufgehoben, das kann ich Ihnen versichern. Nun wissen wir auch endlich, wie du heißt, kleiner Mann«, versuchte sie sich über ihre Ergriffenheit hinwegzuretten. »Wir nannten ihn Dadi.«
Hilflos streckte Martina Diering die Arme nach ihrem Kind aus, aber Patrick klammerte sich an Denise.
»Bedenken Sie bitte, dass er aus tiefstem Schlaf geschreckt wurde«, sagte diese beschwichtigend. »Später wird er wieder lachen und zu Ihnen kommen. Sie haben Ihr Kind wieder.«
»Wir haben unser Kind wieder«, wiederholte Joachim Diering andächtig. »Du brauchst dich nicht mehr zu sorgen, Martina. Pat ist gesund.«
»Aber er erkennt mich nicht mehr«, weinte sie auf.
»Ihre Gattin muss sich beruhigen, Herr Diering«, murmelte Denise. »Es war wohl zu viel für sie.«
Martina war nicht mehr fähig, einen Schritt zu gehen. So müde Joachim Diering auch war, trug er sie auf seinen Armen zu dem Zimmer, das Lena ihnen anwies.
»Danke«, wiederholte er immer wieder gedankenlos. »Danke.«
*
»Es scheint eine recht unheilvolle Geschichte zu sein«, meinte Denise nachdenklich zu ihrem Mann. »Das Kind wurde entführt. Soviel steht ja wohl fest.«
»Wir werden alles erfahren, Denise«, stellte er bedächtig fest. Er betrachtete das Autokennzeichen. »Sie müssen die ganze Nacht gefahren sein«, überlegte er.
»Und sind am Ende Ihrer Kräfte«, nickte sie. »Nun, sie können jetzt ausruhen. Ich möchte nicht wissen, welche Höllenqualen sie ausgestanden haben. Wenn ich mir vorstelle, dass man uns Henrik entführen würde …«, sie brach ab, und starrte vor sich hin.
»Stell dir nichts vor, Denise«, meinte er beruhigend. »Wer sollte ihn entführen? Alle lieben ihn, und wir lassen ihn nicht aus den Augen. In Sophienlust finden Kinder Zuflucht. Entführt wurde noch keines.«
»Na, nun hat er sich ja wieder beruhigt, der Kleine«, stellte sie lächelnd fest, als Henrik und Patrick ein kindliches Zwiegespräch begannen, das aus »baba, dada, hoho«, und fröhlichen Kreischen bestand.
»Er hat seine Eltern wieder«, meinte Denise sinnend, »und wenn sie sich beruhigt haben, wird alles schnell vergessen sein.«
»Für ihn schon – aber für sie?«, überlegte er. »Es muss ein entsetzlicher Schock gewesen sein.«
*
Für Luis Olberg war es auch ein ziemlicher Schock, als Lilly ihm schluchzend die ganze Wahrheit gestanden hatte.
»Ja, sind Sie denn von einem Teufel verhext gewesen?«, entfuhr es ihm.
»So etwas ähnliches war es wohl schon«, flüsterte sie. »Aber jetzt interessiert mich nur noch, was aus Pat geworden ist. Ich werde meine Strafe bekommen und verbüßen. Mir geschieht ganz recht, aber das Kind muss so rasch wie möglich wieder zu seinen Eltern. Sonst finde ich keine Ruhe.«
Minuten drückenden Schweigens vergingen. Plötzlich schlug sich Luis Olberg an die Stirn.
»Heute Morgen haben sie im Rundfunk eine Suchmeldung gebracht. Es handelt sich um einen kleinen Jungen, neun Monate alt. Wäre es nicht das Beste, Sie würden die Eltern verständigen, in welcher Stadt Sie das Kind zurückgelassen haben? Mädchen – was haben Sie da angestellt.«
»Ich kann nicht mit Martina sprechen«, stöhnte sie. »Ich kann ihnen nie mehr unter die Augen treten.«
»So was mag ich«, knurrte er. »Sich diese Suppe einzubrocken, waren Sie nicht zu feige. Aber jetzt jammern Sie, anstatt zu handeln. Nun, das Geld wäre da. Sie hatten doch die Absicht es zurückzubringen?«
Er war sich dessen nicht sicher, aber er wollte ihr eine Brücke bauen. Irgendwie tat sie ihm trotz allem leid. Jung und dumm, wie sie war. Das kam eben davon, wenn die Mädchen an den falschen Mann gerieten. Wie viel Unglück war daraus schon entstanden!«
Lilly überlegte. Hatte sie wirklich nur einen Augenblick daran gedacht, das Geld zurückzugeben? Es war eine Kurzschlusshandlung gewesen, als sie den Koffer an sich nahm und mit ihm in der Nacht verschwand. Gedacht hatte sie wohl gar nichts anderes, als sich an Joschi zu rächen, weil er sie belogen hatte.
Das wurde ihr jetzt erst richtig bewusst. Luis Olberg wies ihr in seiner Ruhe und Besonnenheit den Weg, aus diesem Dilemma herauszukommen.
»Ja, ich wollte das Geld zurückbringen«, erwiderte sie leise.
»Ehrlich?«, fragte er eindringlich.
Sie errötete. »In jener Nacht wusste ich eigentlich gar nicht, was ich wollte. Ich dachte, nun würde er mich sitzenlassen und mit dem Geld türmen und alles bliebe dann an mir hängen.«
»Wenn das wirklich ein so übler Bursche ist, haben Sie einen ganz hübschen Mut entwickelt«, bemerkte er. »Womit ich allerdings nicht sagen will, dass dies eine Entschuldigung für Ihr Verhalten ist. Was würden Sie empfinden, wenn man Ihnen Ihr Kind nehmen würde? Aber«, – er machte eine Pause, »das geht einem wohl erst auf, wenn man Mutter ist. – So, da kommt unser Kommissar. Nun erzählen Sie dem die Geschichte noch einmal.«
»Muss ich das?«, fragte sie niedergeschlagen.
»Das kann Ihnen niemand abnehmen«, erwiderte er rau. »Aber vielleicht können wir erreichen, dass man Sie wieder auf freien Fuß setzt, sofern nicht schon eine Anzeige gegen Sie vorliegt. Jetzt nehmen Sie mal Ihren Verstand zusammen und verheddern Sie sich nicht, Sie törichtes Mädchen.«
*
»Ich möchte zu gern wissen, was in Sophienlust los ist«, meinte Dominik in der Pause zu Rosi. »Glaubst du wirklich, dass es die Eltern von dem Baby waren?«
Es ging ihm nicht aus dem Sinn und es beschäftigte ihn sogar stärker als die Tatsache, dass Cornelia sich im Unterricht als kläglicher Versager erwiesen hatte, während Rosi, das Schicksal wollte es wohl so, einen ganz besonders guten Tag hatte.
Cornelia stand abseits, schmollte und warf ihnen beleidigte Blicke zu. Niemand kümmerte sich um sie. Wenn einer hier so hochnäsig tat, war er erst mal abgemeldet.
Die Dorfkinder mochten das noch weniger als die Kinder von Sophienlust. Nur Kati, die immer versöhnliche, zeigte sich mitfühlend und machte einen Annäherungsversuch.
»Warum bist du so abweisend, Cornelia?«, fragte sie geradeaus. »Wenn du nett zu den Kindern bist, sind sie es auch.«
»Pah, diese schmutzigen Dorfgören. Es ist gemein von meinen Eltern, dass sie uns hierher geschickt haben.«
»Du bist die Erste, die das sagt«, stellte Kati nachdenklich fest. »Alle anderen sind glücklich, dass sie in Sophienlust sein dürfen, und Michael gefällt es auch schon ganz gut.«
»Wenn der nur genug zu essen bekommt, dann ist er schon zufrieden«, murrte Cornelia. »Geh doch zu den andern. Ich brauche keinen.«
Und schon drehte sie sich um und lief aus dem Schulhof. Lehrer Brodmann hatte es aber bemerkt und holte sie zurück.
»Du kannst hier nicht machen, was du willst, Cornelia«, erklärte er streng. »Jetzt ist Schulzeit. Da kannst du nicht einfach davonlaufen.«
Sie entschloss sich zum passiven Widerstand. Irgendwann würde sich schon eine Gelegenheit bieten, bei der sie entwischen konnte. Sie hatte es sich fest vorgenommen und wäre es auch nur, um den anderen einen Riesenschrecken einzujagen.
»Man kann einfach nicht mit ihr reden«, raunte Kati Dominik zu.
»Dann lass sie doch links liegen«, erklärte er gleichmütig. »Einmal wird sie schon von selbst kommen. Wenn bloß die Schule erst zu Ende wäre. Wer weiß, was in Sophienlust wieder los ist.«
Er konnte sich nicht konzentrieren, gab völlig falsche Antworten, und Cornelia kicherte hinter seinem Rücken boshaft.
Was ihn aber am meisten in Zorn versetzte, war der Umstand, dass sie ihm später, als die Stunde zu Ende war, ein Bein stellte. Dominik war Auseinandersetzungen durchaus nicht abgeneigt, aber Hinterhältigkeiten vertrug er gar nicht.
Dabei war er recht schmerzhaft auf das Knie gefallen und hatte sich auch noch den Kopf angestoßen. Im Augenblick spürte er noch keinen Schmerz. Wuterfüllt drehte er sich um und gab ihr mit voller Kraft eine Ohrfeige.
»Dominik«, sagte Lehrer Brodmann mahnend, »benimmt man sich so einem Mädchen gegenüber?«
»Stellt ein Mädchen einem so hinterhältig ein Bein?«, fragte Dominik aufsässig.
Cornelia war erst ganz verdutzt gewesen, jetzt begann sie zu weinen und schimpfte wild auf Dominik.
»Sie hat angefangen«, verteidigte Rosi ihren Freund.
»Du falsches Biest«, schrie Cornelia sie an. »Ich mag mit euch allen nichts zu tun haben.«
Dominik war plötzlich ganz still geworden und fasste sich an den Kopf. Er taumelte leicht, als er das Klassenzimmer verlassen wollte.
Rosi kümmerte sich nicht mehr um Cornelia. Auch Kati kam herbei. »Tut es weh?«, fragte sie ängstlich.
»Mir ist schlecht«, murmelte Dominik. »Ganz schlecht.«
Mit flammenden Augen drehte sich Rosi zu Cornelia um. Plötzlich hatte sie ihre Scheu verloren und hatte auch keine Angst mehr vor der anderen.
»Wenn ihm was passiert ist, dann kannst du was erleben«, zischte sie.
Kati wurde heute von Irene von Wellentin abgeholt. Sie wollten den Tag in Schoeneich verbringen, weil Hubert von Wellentin durch wichtige Konferenzen festgehalten wurde.
»Was ist mit Nick?«, fragte sie entsetzt, als Lehrer Brodmann den Jungen stützte.
»Cornelia hat ihm den Fuß gestellt, und er hat sich den Kopf angestoßen«, erklärte Katy empört. »Nun ist ihm schlecht.«
»Er tut doch nur so«, mischte sich Cornelia ein.
»Dominik tut nie so«, fuhr Rosi sie an. »Du bist gemein, richtig gemein. Alles war schön, bis du gekommen bist.«
»Omi«, flüsterte Dominik leise, »mir ist wirklich schlecht.«
Der Chauffeur sprang auf Irene von Wellentins Zuruf herbei, und hob Nick in den Wagen, während die anderen Kinder zum Schulbus geführt wurden.
»Mutti soll sich nur nicht aufregen«, flüsterte Dominik, dann wurde er plötzlich ohnmächtig.
»Oh, Mutti«, schluchzte Kati auf und klammerte sich an Irene von Wellentin. »Was ist nun?«
»Sofort zu Dr. Wolfram«, ordnete sie mit zitternder Stimme an.
*
Joachim und Martina Diering hatten tatsächlich ein paar Stunden geschlafen. Die Natur verlangte ihr Recht. Die Angst war von ihnen genommen. Ihr Kind lebte. Die quälende Aufregung war verebbt.
Aufgeregte Kinderstimmen rissen sie aus dem Schlummer. Hell schien die Sonne in ihr Zimmer.
»Wo sind wir denn?«, fragte Martina noch immer leicht verwirrt, als die Hand ihres Mannes sanft über ihr Gesicht strich.
»Auf Gut Sophienlust, mein Liebling. Erinnere dich.«
»Pat ist gefunden«, seufzte sie glücklich auf. »Unser Kind – Jo – es wird alles gut. Aber was ist da draußen los?«
Er trat ans Fenster. »Es sind die Kinder. Sie kommen scheinbar aus der Schule. Aber irgendwas scheint passiert zu sein. Frau von Schoenecker ist aufgeregt. Sie fährt eben mit ihrem Mann weg.«
»Ich möchte Pat sehen, ihn im Arm halten«, flehte sie. Etwas anderes bewegte sie im Augenblick nicht.
Es war gut, dass sie kamen und sie sich selbst um ihr Kind kümmern konnte, denn Carola war mit Henrik beschäftigt, der seinen Eltern nachjammerte und Frau Rennert schien auch ihre Geduld und Ruhe verloren zu haben.
»Ihr kommt jetzt mit und erzählt mir alles ausführlich«, sagte sie sehr streng. »Oh, Frau Diering – haben Sie sich erholt?«, wandte sie sich an die junge Frau. »Dann könnten Sie Patrick wohl selbst füttern.«
Nichts konnte Martina willkommener sein, wenn sie auch nicht ahnte, dass unerfreuliche Tatsachen Frau Rennert sehr beschäftigten, als die Sorge um die Allerkleinsten.
»Lach mit ihm«, raunte Joachim Diering seiner Frau ins Ohr. »Weine nicht wieder, Liebes, wenn es auch Freudentränen sind.«
»Pat«, sagte sie mit weicher, zärtlicher Stimme, »mein süßer kleiner Pat.«
Lauschend hob er den Kopf und blickte sie mit strahlenden Augen an. Seine Ärmchen streckten sich ihr nun von selbst entgegen.
»Dadada, mamama«, jauchzte er, und sie hob ihn empor und drückte ihn an sich.
»Wo ist denn unser kleiner Schatz?«, fragte nun auch Joachim Diering gerührt und wurde ebenfalls mit einem jauchzenden Lachen begrüßt.
Ihr Glück war augenblicklich vollkommen. »Jetzt bekommt unser Spatz sein Breichen«, sagte Martina, »und dann fahren wir wieder heim.«
Aber so rasch sollte das nicht gehen.
*
»Du hast Dominik also ein Bein gestellt, und er ist heftig auf den Kopf gefallen«, stellte Frau Rennert aufgebracht fest.
»Nein«, log Cornelia, »das hat er bloß gesagt.«
»Ich habe es aber gesehen«, beharrte Rosi. »Nik hat ihr noch eine Ohrfeige gegeben, aber dann ist ihm schlecht geworden, und Frau von Wellentin hat ihn zu Dr. Wolfram gebracht.«
Michael kam näher. »Du hast das wirklich getan, Nele?«, fragte er empört.
Sie presste verstockt die Lippen aufeinander. »Ich sage gar nichts mehr«, stieß sie dann hervor. »Mir glaubt ja doch keiner.«
»Weil du lügst«, schleuderte ihr Rosi ins Gesicht. »Du hast schon früher immer die Schuld auf andere geschoben. Hoffentlich schicken sie dich wieder weg.«
»Rosi, gib Ruhe«, sagte Frau Rennert mahnend. »Geht jetzt in den Esssaal. Mit dir, Cornelia, wird Frau von Schoenecker später sprechen.«
Wenn sie es sich auch nicht eingestehen wollte, so hatte Cornelia nun doch Angst bekommen. Die Kinder wichen alle von ihr zurück und sahen sie verächtlich und vorwurfsvoll an.
Dann kamen Sascha und Andrea. »Wo ist Mutti?«, fragte der Junge.
»Wo ist Nick?«, fragte Andrea, »und Vati ist auch nicht da.«
»Nick hat sich verletzt«, erklärte Frau Rennert. »Sie sind bei Dr. Wolfram.«
»Wie hat er sich verletzt?«, fragte Andrea entgeistert.
»Cornelia hat ihm ein Bein gestellt«, mischte sich Toni ein, der eben aus dem Waschraum kam.
»Die Neue?«, fragte Sascha, der mit seinen fast sechzehn Jahren ein langaufgeschossener Junge war. »Na, die werde ich mir kaufen.«
»Gar nichts wirst du, Sascha«, fiel ihm Frau Rennert ins Wort. »Das überlässt du deinen Eltern.«
Michael schlich sich heran. »Mir tut er leid«, flüsterte er bedrückt. »Nele ist einfach ungerecht. Und dabei habe ich heute Habakuk beigebracht, Nele zu sagen. Muss ich nun auch wieder weg?«
»Warum?«, fragte Frau Rennert.
»Na, Nele werdet ihr doch sicher nicht behalten wollen. Und ich verstehe das auch. Mutti wird sehr traurig sein. Ich finde es schön hier.«
»Du kannst ja nichts dafür, wenn sie so niederträchtig ist«, meinte Sascha. »Ich mag jetzt nichts essen, Tante Rennert. Ich muss erst wissen, wie es Dominik geht.«
Er nahm sich alles sehr zu Herzen. Er war empfindsam und warmherzig, ein Junge, der jedem Streit am liebsten aus dem Wege ging. Aber wenn seine Geschwister angegriffen wurden, konnte er zornig werden.
»Wo ist sie?«, raunte er Rosi zu.
»Auf ihrem Zimmer«, flüsterte sie zurück.
So schnell konnte sie gar nicht schauen, wie Sascha verschwand und sicher war es gut so, denn er kam eben noch zur rechten Zeit ins Zimmer, als Cornelia aus dem Fenster steigen wollte.
Mit ein paar schnellen Schritten war er bei ihr und packte sie bei den Schultern.
Er schüttelte sie so wild, dass ihr Kopf hin und her flog. »Feige bist du also auch noch«, knirschte er. »Davonstehlen willst du dich. Na ja, wenn man hinterhältig Beine stellt, muss man ja mit so was rechnen. Was bildest du dir eigentlich ein? Glaubst du, du bist was Besseres, als die anderen? Glaubst du, dir werden ein Leben lang Extrawürste gebraten? Du widerst mich an, und ich kann nur zu gut verstehen, dass deine Eltern dich loswerden wollten.«
Cornelia war wie erstarrt. So hatte noch niemand mit ihr gesprochen. Zumindest war es ihr noch nie so zu Herzen gegangen. Dieser große Junge, der sie um mehr als einen viertel Meter überragte, war so außer sich vor Zorn, dass sie nicht den leisesten Widerspruch wagte.
»Ich wollte doch nicht, dass er auf den Kopf fällt«, murmelte sie kleinlaut. »Ich wollte es nicht.«
»Sascha«, Carola war eingetreten. Sie hatte seine zornige Stimme gehört. »Deinen Eltern würde es nicht gefallen, wenn du dich zum Richter aufschwingst«, sagte sie mahnend. »Cornelia hat etwas Unrechtes getan und wird es einsehen.«
»Hoffentlich«, knurrte Sascha, dann warf er ihr einen vernichtenden Blick zu.
*
»Es ist eine leichte Gehirnerschütterung«, beruhigte Bert Wolfram Denise von Schoenecker. »Gott sei Dank nur das. Ein paar Zentimeter höher und es hätte die Schläfe getroffen.«
Denise beugte sich über ihren Sohn. »Nick, mein kleiner Nick«, flüsterte sie.
Der Junge schlug die Augen auf. »Du sollst dich doch nicht aufregen, Mutti«, murmelte er. »Ich bin halt blöd gefallen.«
Er wusste wenigstens, was vor sich gegangen war. Sein Geist war nicht getrübt, ihm war nur noch ein wenig schwindlig.
»Warum bin ich nicht in Schoeneich?«, fragte er leise.
»Weil Omi und Kati dich vorsichtshalber gleich zu Dr. Wolfram gebracht haben«, erwiderte Denise liebevoll. »Vati ist auch hier.«
»Ich möchte nach Hause«, flüsterte er. »Nicht nach Sophienlust, nach Schoeneich.«
Er sprach nicht von Cornelia, aber Denise spürte, dass es mit dieser zusammenhing, dass er nicht nach Sophienlust wollte. Zärtlich schmiegte er seine Wange an ihre Hand.
»Wir fahren doch nach Schoeneich?«, fragte er drängend.
Konnten so ungezogene, unberechenbare Kinder tatsächlich ihr ganzes Fundament, das auf Verstehen und Gleichberechtigung aufgebaut worden war, ins Wanken bringen? Denise versetzte es einen Stich.
»Natürlich fahren wir nach Schoeneich«, erwiderte sie sanft. »Omi und Kati wollen doch den Tag mit uns verbringen. Aber du musst leider noch ein paar Tage im Bett bleiben, Nick.«
»Mir ist auch so«, meinte er kleinlaut. »Dann kam der andere Gedanke, der ihn heute den ganzen Vormittag beschäftigt hatte.
»Was ist mit dem Baby, Mutti?«
Sie war so auf ihn konzentriert, dass sie seine Frage zuerst gar nicht richtig verstand.
»Du meinst Patrick?«, fragte sie dann.
»Er heißt Patrick? Wisst ihr es bestimmt?«
»Seine Eltern sind gekommen. Sie sind sehr glücklich, ihn wiedergefunden zu haben.«
»Dann waren sie es doch«, flüsterte er. »Sind sie auch wirklich gut mit ihm?«
Was ihn nur alles beschäftigte, obgleich sein Kopf schmerzen musste.
»Du kannst unbesorgt sein, Nick«, beruhigte sie ihn.
»Ich möchte sie aber kennen lernen, wenn wir ihn schon nicht behalten können.« Das klang schon wieder ein wenig nach seinem alten Eigensinn.
»Nun fahren wir erst mal heim«, sagte sie.
Bert Wolfram, der Alexander eingehend über Nicks Zustand informiert hatte, erschien wieder im Behandlungszimmer.
»Na, Nick, geht es wieder besser?«, fragte er freundlich.
»So lala«, murmelte der Junge. Vergeblich warteten sie darauf, dass er eine Anschuldigung gegen Cornelia hervorbringen würde. Darüber schwieg er sich aus, oder hatte der Sturz gar die Erinnerung an diesen Augenblick ausgelöscht? Das war durchaus möglich.
Alexander trug ihn zum Wagen. Er brachte sie nach Schoeneich, dann fuhr er noch einmal nach Sophienlust, um Sascha, Andrea und Henrik zu holen und ein paar Worte mit Frau Rennert zu wechseln.
Cornelia befand sich auf ihrem Zimmer. Nach Frau Rennerts Ansicht begann sie endlich einmal nachzudenken. Ob es jedoch von Dauer sein würde, konnte man noch nicht sagen. Jedenfalls war man nun halbwegs beruhigt, dass die Folgen für Dominik nicht schlimmerer Natur gewesen waren.
Besorgt erkundigten sich auch die Dierings, denen der Zwischenfall nun auch zu Ohren gekommen war, nach Dominiks Befinden. Liebenswürdig bat Alexander von Schoenecker sie um ihren Besuch in Schoeneich.
»Es dürfte doch recht strapaziös für Sie sein, wenn Sie gleich heute zurückführen«, meinte er. »Darf ich Sie im Namen meiner Frau bitten unsere Gäste zu sein? Nick möchte Sie brennend gern kennen lernen. Er hat an Patricks Schicksal großen Anteil genommen.«
Dieser Bitte konnten sie sich nicht verschließen. Zudem fühlten sie sich auch aus Dankbarkeit verpflichtet, sich in irgendeiner Weise noch erkenntlich zu zeigen. Doch darüber wollte Joachim Diering später noch mit den Schoeneckers sprechen.
*
Nicht ahnend, dass für den kleinen Patrick alles wieder in bester Ordnung war, machte Lilly sich noch immer Sorgen um ihn.
Reuevoll hatte sie auch dem Kommissar alles gestanden. »Ich wollte dem Kind nicht schaden«, beteuerte sie immer wieder. »Ich würde so etwas nie wieder tun.«
Konnte man ihr glauben? Nun, jedenfalls wollte man ihr die Chance geben, zum Auffinden des kleinen Patrick beizutragen. In Begleitung des Polizisten Georg Händle sollte sie zu der Stelle fahren, an der sie Patrick zurückgelassen hatte.
Inzwischen hatte sich der Kommissar telefonisch davon überzeugt, dass das Kind dort aufgefunden worden war, aber er behielt das noch für sich, um zu prüfen, ob Lillys Reue anhielt.
Zu aller Überraschung erbot sich Luis Olberg, sie zu begleiten. Margit Olberg war das nur recht, denn sie war überhaupt skeptisch.
Ein Mädchen, dass sich mit einem solchen Ganoven einließ und das Kind ihrer eigenen Kusine entführte, konnte nicht viel taugen, sagte sie sich. Wahrscheinlich war sie raffiniert genug, alle hinters Licht zu führen und dann bei der erstbesten Gelegenheit auszureißen.
Da war es nur gut, wenn zwei handfeste Burschen in der Nähe waren, die solches zu verhindern wussten. Und gar so weit weg war es nicht, dass Luis und Schorsch nicht am gleichen Abend zurück sein konnten.
Auf der Fahrt sprach Lilly kaum ein Wort. Immer wieder dachte sie darüber nach, wie leichtsinnig sie sich ihr Leben ruiniert hatte. Gab es wirklich einen neuen Anfang, wie Luis Olberg ihr einzureden versucht hatte? Würde Martina ihr verzeihen?
Sie wusste nicht, was Luis und Schorsch längst wussten. Sie sollte alle Stationen ihres unbegreiflichen Handelns noch einmal durchleben, damit ihr ganz bewusst wurde, was sie da getan hatte.
Nur mühsam konnte sie sich erinnern, in welcher Straße, vor welchem Geschäft sie Patrick in den Kinderwagen gesetzt hatte.
»Hier war es«, sagte sie plötzlich. »Hier, vor einem Juweliergeschäft. Der Wagen war dunkelblau.«
Sie starrte mit leeren Augen zu der Stelle, dann brach sie plötzlich in Tränen aus.
»Er hat gelacht«, schluchzte sie. »Er jauchzte, als ich ihn in den Wagen setzte. Ich hörte es noch, als ich davonging.«
Die beiden Männer sagten nichts. Schweigen war zwischen ihnen, bis Lilly erneut begann.
»Wie dumm war ich, wie entsetzlich dumm und gewissenlos. Es wird mich mein Leben lang verfolgen.«
»Es wird Sie hoffentlich zur Vernunft gebracht haben«, brummte Luis. »Nun beruhigen Sie sich. Patrick ist gefunden. Wir fahren jetzt nach Gut Sophienlust, wo man ihn aufgenommen hat.«
»Dort soll ich hin?«, fragte sie entsetzt. »Ich soll den Leuten, die ihn aufgenommen haben, gegenübertreten? Können Sie mir das nicht ersparen?«
»Nein«, erwiderte Luis streng. »Wollten Sie sich nicht überzeugen, dass Patrick nichts geschehen ist? Jetzt haben Sie Gelegenheit dazu.«
»Sie verachten mich«, flüsterte sie. »Es ist ja auch verständlich.«
»Ich bin zwar kein Pfarrer«, brummte Luis, »und Schorsch ist kein Richter, aber man muss jedem Menschen, der ehrlich bereut, eine Chance geben. Das ist meine Ansicht. Eigentlich müssen Sie dankbar sein, dass alles einen solchen Verlauf genommen hat. Und etwas haben Sie schließlich auch dazu beigetragen.«
Dann aber kam für Lilly der dramatische Augenblick, in dem sie ihrer Kusine Martina Diering gegenübertreten musste. Es geschah so unvorbereitet, dass beide sich wie versteinert anblickten.
»Martina«, rang es sich tonlos von ihren Lippen.
Wortlos blickte die junge Frau sie an, als wolle sie den Grund ihrer Seele erforschen.
Lilly zitterte am ganzen Körper, als Joachim Diering mit seinem Sohn auf dem Arm aus der Tür des Gutshauses trat.
Lilly brach in ein hysterisches Weinen aus, als sie das Kind erblickte, das eben noch mit seinem Vater gelacht hatte, nun aber auch zu weinen begann.
»Was hast du dir bei allem gedacht?«, fragte Joachim Diering heiser. »Mit Lügenmärchen wirst du jetzt wohl hoffentlich nicht kommen?«
Lilly schüttelte den Kopf. »Ich bin froh, dass es Pat gut geht«, stöhnte sie. »Das Geld ist in Sicherheit. Ich habe es ihm fortgenommen.« Sie stammelte ungereimtes Zeug und Luis Olberg sah den Zeitpunkt als gekommen, sich einzumischen.
»Vielleicht geben Sie Frau Rank Gelegenheit, alles zu erklären«, meinte er besonnen. »Sie bereut alles ehrlich. Sie hat alles gestanden. Wenn Sie jetzt Strafanzeige gegen sie erstatten wollen, wird sie sich vor Gericht dafür verantworten. Das Geld – abgesehen von zweitausend Euro, die dieser Kerl an sich gebracht hat, steht zu Ihrer sofortigen Verfügung.«
»Geld – Strafanzeige«, murmelte Joachim Diering. »Wir haben unseren Sohn wohlbehalten wieder. Lilly wird es mit sich und ihrem Gewissen ausmachen müssen, wie sie damit fertig wird. Wir wollen keinen Skandal, und wir werden ihr auch nicht das Leben verbauen, wenn sie guten Willens ist. Wahrscheinlich wird es sie noch lange genug verfolgen, wie schlimm alles hätte ausgehen können.« Er wandte sich an seine Frau. »Bist du auch meiner Ansicht, Martina?«
Sie nickte mechanisch. »Ich hatte dich doch so sehr vor ihm gewarnt, Lilly«, flüsterte sie. »Und du wusstest doch, was Pat für Jo und mich bedeutet.«
»Verzeih mir«, bat Lilly mit zitternder Stimme. »Ich schäme mich so entsetzlich.«
»So leid es mir tut«, mischte sich jetzt Georg Händle ein, »aber rechtlich muss noch manches geklärt werden. Ich kann nicht unverrichteter Dinge vor meinem Vorgesetzten erscheinen. Darf ich Sie bitten, Herr Diering, eine schriftliche Erklärung über Ihre Entschlüsse abzugeben?«
*
Michael war böse auf seine Schwester. Genauso böse wie die anderen Kinder auch. Aber Nele war nun mal seine Schwester. So schlich er sich in ihr Zimmer, entschlossen, ihr eindringlich ins Gewissen zu reden.
Nele lag auf ihrem Bett und starrte zur Decke. Sie rührte sich nicht, als er sie ansprach.
Es war für einen kleinen Jungen auch nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Michael wanderte im Zimmer hin und her und trat dann schließlich ans Fenster.
Seine Augen weiteten sich, sein Mund öffnete sich und klappte wieder zu.
»Da ist ein Polizist«, stieß er entsetzt hervor. »Ob er deinetwegen hier ist, Nele. Was hast du bloß angestellt? Vati und Mutti werden traurig sein.«
Ein Polizist? Darüber erschrak auch Nele zutiefst. Sie sprang auf und stolperte zum Fenster. Ihr Gesicht war kalkweiß und unverhohlene Angst zeichnete sich auf ihren Zügen ab.
»Wenn der Dominik nun tot ist«, äußerte sich Michael zutiefst besorgt, »wenn sie nun darum hier sind?«
»Nein, nein«, schrie Cornelia, »ich habe es doch nicht gewollt. Ich kann doch nichts dafür, dass er so dumm gefallen ist.«
»Ob sie dir das glauben?«, überlegte Michael mit kindlicher Brutalität, die sich die Folgen nicht vorstellen konnte.
Früher hatte sich für Cornelia die Vorstellung von einem Kinderheim immer mit der von einem Erziehungsheim gedeckt, wo jene Kinder hinkamen, die sich etwas zuschulden hatten kommen lassen.
Nun hatte sie Sophienlust kennen gelernt und gesehen, wie herrlich es in einem solchen Heim sein konnte, wenn sie es auch nicht hatte eingestehen wollen.
Aber sie hatte etwas angestellt, was böse Folgen hatte. Wenn man sie nun in ein Erziehungsheim brachte, in so eine Anstalt, deren Fenster vergittert waren, die von hohen grauen Mauern umgeben war? Ihre Eltern waren einmal mit ihnen an einer solchen vorbeigekommen und hatten ihnen erklärt, wie es da zuging, Cornelia schlug ihre Hände vor das Gesicht und begann kläglich zu weinen.
»Sei ruhig«, warnte Michael sie. »Ich werde mal horchen, was mit Dominik los ist, und wenn sie dich wegbringen wollen, dann reißen wir beide aus. Ich lasse dich schon nicht im Stich, Nele. Ich bin ja dein Bruder«, versicherte er. »Versteck dich inzwischen lieber draußen in dem großen Wandschrank. Ich mache ihn dann zu, und keiner wird denken, dass du drin bist. Nur ganz still musst du sein.«
Schnell überzeugte er sich, dass niemand in Sichtweite war, und Cornelia schlüpfte rasch in den Schrank. Sie fürchtete sich zwar schrecklich in der Dunkelheit, aber aus Furcht, entdeckt zu werden, kauerte sie sich ganz still in eine Ecke. Sie hörte, wie sich der Schlüssel drehte und Michael leise davonschlich. Die Luft in dem Schrank war schlecht. Es roch nach allem möglichen. Reinigungsmittel wurden darin aufbewahrt, Besen und Schrubber und alles, was die Mädchen so zur Pflege der Räume brauchten.
Cornelia wurde übel. Sie wagte nicht mehr, Luft zu holen. Währenddessen lief Michael hinunter, aber er kam nicht weit.
Schwester Gretli fing ihn ab. »Wir haben Spielstunde«, stellte sie fest. »Cornelia wollen wir heute mal in Ruhe lassen, aber du wirst dich doch nicht drücken wollen, Michael?«
»Nein, ich will mich nicht drücken«, erwiderte er gehorsam. »Warum ist denn der Polizist da?«
Schwester Gretli zuckte die Schultern. »Ich weiß es auch nicht, aber das braucht uns ja nicht zu interessieren.«
»Weißt du, wie es Dominik geht, Schwester Gretli?«, fragte Michael darauf schüchtern und dachte dabei an Cornelia, die in ihrem Verlies saß, und der er doch helfen wollte.
»Nein, das weiß ich auch nicht«, erklärte Schwester Gretli wahrheitsgemäß.
Michaels Herz sank ganz tief. Wie sollte er nur Nele helfen, wenn er dauernd unter Aufsicht stand? Aber machte er nicht alles nur noch schlimmer, wenn er jetzt auch ausriss?
Wenn er doch nur jemanden hätte, den er einweihen könnte. Aber ob Toni den Mund halten würde?
Er war mit seinen Gedanken in der Zeichenstunde nicht bei der Sache. Zwar wurde er nicht gerügt, aber er hatte immer das Gefühl, dass alle Blicke auf ihn ruhten.
Die Minuten gingen dahin. Seine Gedanken waren bei Nele. Sie würde sich wohl ganz schön fürchten in dem dunklen Schrank und auf ihre Befreiung warten.
Was sollte er nur tun? Tante Rennert alles sagen?
»Weißt du, wie es Nick geht?«, raunte er Toni zu.
Der kaute an seinem Stift. »Bestimmt ganz schlecht. Sie haben Sascha und Andrea ja auch weggeholt«, vermutete er. »Sie sind bei der Zeichenstunde sonst immer dabei.«
»Weißt du, warum der Polizist gekommen ist?«, fragte Michael nach einer Weile.
»Ist ein Polizist da?«, fragte Toni neugierig zurück.
»Was habt ihr denn dauernd zu reden?«, erkundigte sich Wolfgang Rennert freundlich. Da kam Carola hereingestürzt.
»Michael, komm mal her«, rief sie. »Wo ist deine Schwester?«
Michael machte ein schuldbewusstes Gesicht. »Sag ich nicht«, erwiderte er aber standhaft.
»Warum willst du es nicht sagen?«, fragte sie, ihn mit sich ziehend.
Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Damit der Polizist sie nicht mitnimmt?«, stieß er hervor. »Sie ist doch meine Schwester. Ja, wenn sie auch böse ist, aber dass Nick stirbt, hatte sie ganz bestimmt nicht gewollt.«
Carola sah ihn verwirrt an. »Nick stirbt doch nicht. Es geht ihm schon viel besser, und was redest du da von dem Polizisten?«
»Will er Nele nicht holen?«, erkundigte er sich zaghaft.
»Er ist doch wegen des kleinen Patrick Diering da«, erwiderte sie verwirrt.
»Dann wird Nele nicht bestraft?«, vergewisserte er sich noch.
»Wenn sie ein bisschen nachdenkt, wird sie schon gestraft genug sein«, erklärte Carola.
Aber Nele konnte gar nicht mehr nachdenken. Sie war wahrhaftig gestraft genug, denn als Michael Carola endlich zu ihrem Versteck führte, fanden sie sie ohnmächtig.
»Ein Unglück kommt bei uns doch wahrhaftig nie allein«, ächzte Frau Rennert, als man sie herbeirief. »Wer ist denn auf die Idee gekommen, Cornelia in diesen Schrank zu stecken? Sie hätte ja ersticken können.«
»Ich«, sagte Michael kleinlaut und Tränen purzelten ihm aus den Augen. »Ich dachte doch, der Polizist will sie holen.«
»Mit euch macht man was mit«, war Frau Rennerts Kommentar. »Aber heute werden wir Frau von Schoenecker damit mal nicht belasten. Sie hat wahrhaftig Aufregung genug gehabt. Das hier nehme ich mal auf meine Kappe. Ruf Dr. Wolfram an, Carola!«
*
Nun wussten die Dierings die ganze Geschichte. Lilly war zwar nicht in der Lage gewesen, sie noch ein drittes Mal zu erzählen, aber das hatte Luis Olberg besorgt.
»Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie die Angelegenheit so energisch in die Hand genommen haben, Herr Olberg«, erklärte Joachim Diering verbindlich. »Wie können wir uns Ihnen erkenntlich zeigen?«
»Ich habe doch gar nichts weiter gemacht, als dem Mädchen ins Gewissen geredet«, stellte er fest. »Geben Sie ihr die Möglichkeit, sich selbst und allen zu beweisen, dass sie zur Einsicht gekommen ist und tief bereut, was sie getan hat. Glücklicherweise ist ja nichts passiert.«
»Wir haben kein Interesse daran, dass der Name Rank die Skandalblätter füllt«, äußerte sich Joachim Diering, »und an dem Geld liegt mir auch nichts. – Lilly ist mittellos. Wir werden ihr eine Starthilfe geben müssen, damit sie nicht wieder auf falsche Pfade gelangt.«
Luis Olberg sah ihn offen an. »Sie kann bei mir arbeiten und beweisen, dass sie auch ohne Starthilfe vorwärtskommt. Leicht werde ich es ihr nicht machen, aber belohnt braucht sie wohl auch nicht gerade zu werden. Hier«, – er blickte sich um und machte eine umfassende Handbewegung, »hier wäre Ihr Geld doch nutzbringend angelegt. Ich muss sagen, dass mich dieses Heim sehr beeindruckt. Es ist ja unwahrscheinlich, was den Kindern hier geboten wird.«
»Vor allem, wie viel Liebe und Verständnis sie finden«, meinte nun Martina Diering gedankenvoll. »Wahrscheinlich würde auch ich jetzt manches härter beurteilen, wenn ich nicht erlebt hätte, was mit Güte und Liebe erreicht werden kann. Vielleicht habe ich zu viel an mein eigenes Glück gedacht und dabei vergessen, dass auch andere sich nach Liebe sehnen. Dass das Schicksal solche Sehnsucht manchmal in falsche Bahnen lenkt, muss man wohl verstehen lernen. – Wenn Lilly nun aber nicht einsichtig sein wird!«, fügte sie beklommen hinzu. »Ich meine, was ihre Zukunft betrifft.«
»Ich glaube, das können Sie beruhigt mir überlassen. Sie wird vor allem heilfroh sein, wenn sie nicht hinter Gitter muss.«
»Und jener Joschi? Wenn er nun wieder ihren Weg kreuzt? Er wird nicht gerade gut auf sie zu sprechen sein. Es stimmt mich besorgt.«
Er fand es rührend, dass sie solcher Gedanken fähig war. Immerhin war Lilly es gewesen, die sich des Kindes bemächtigt und es seinem Elternhaus entführt hatte.
»Warum sollte er sie ausgerechnet bei mir suchen?«, meinte er zuversichtlich. »Aber jetzt muss ich Lilly erst noch fragen, ob sie mit meinem Vorschlag einverstanden ist.«
»Werden Sie uns gestatten, dass wir Ihnen für Ihre freundliche Unterstützung wenigstens einen kleinen finanziellen Beitrag zukommen lassen?«, mischte sich Joachim Diering ein. »Da Sie uns eine große Sorge abnehmen, wäre dies doch gerechtfertigt.«
Luis Olberg zögerte. So gut war er finanziell auch nicht gestellt, dass er sich noch eine weitere bezahlte Kraft leisten konnte, aber es widersprach seinem Charakter, ein solches Angebot anzunehmen.
»Nun, wenn Sie Lilly ein monatliches Taschengeld zukommen lassen wollen, kann ich nicht nein sagen«, erklärte er zögernd. »Aber wenn Sie gestatten, werde ich es ihr erst aushändigen, wenn sie wirklich guten Willen zeigt. Und vor allem müssen wir uns überzeugen, ob sie bei mir arbeiten will.«
Lilly war über diesen Vorschlag anfangs sehr verblüfft, aber für sie bedeutete er Rettung in höchster Not. Wohin hätte sie sich sonst wenden sollen? An ihre Mutter, um mit bitteren Vorwürfen überhäuft zu werden?
Von Tür zu Tür gehen und um eine Stellung bitten, wo sie doch kaum über eine solide Berufsgrundlage verfügte?
Nachdenklich sah sie Luis Olberg an. »Was wird Ihre Schwester dazu sagen?«, fragte sie kleinlaut.
»Margit ist in Ordnung«, erklärte er. »Sie wird sich damit abfinden. Aber bei uns herrscht Ordnung«, fügte er energisch hinzu.
*
Nun war Lilly wieder in Begleitung von Luis und Schorsch abgefahren, und die Dierings konnten sich endlich mit ihrem kleinen Sohn auf den Weg nach Schoeneich machen.
Die schreckensvollen Tage und Nächte waren vergessen. Glücklich hielt Martina ihren kleinen Patrick im Arm, und immer wieder warf Joachim Diering einen dankbaren Blick auf seinen Sohn.
Sein Glück, seine Ehe war gerettet. Gütige Menschen hatten sein Kind beschützt und gepflegt. Gott war ihnen gnädig gewesen.
»Vielleicht beginnt nun auch für Lilly ein nützliches Leben«, äußerte er sich sinnend. »Dieser junge Mann machte einen sehr guten Eindruck.«
»Sie hätte vom Regen auch in die Traufe geraten können«, sagte Martina beklommen.
In Schoeneich wurden sie bereits erwartet. Dominik hatte geschlafen und seine gesunde Konstitution hatte den Schock bereits überwunden. Zwar schmerzte der Kopf noch, aber seine Neugierde konnte er doch nun endlich befriedigen.
Es war ihm eine große Beruhigung, dass Patrick liebevolle Eltern hatte, und er fand es schrecklich aufregend, dass dieser kleine Junge schon ein solches Abenteuer erlebt hatte.
Aber aufregen sollte er sich nicht und so verschwieg man ihm auch vorerst noch, was inzwischen mit Cornelia geschehen war.
Erst anderntags, als die Dierings sich schon auf der Heimreise befanden, brachte Denise es ihm schonend bei. Er zeigte keine Schadenfreude.
»Ich muss gerecht sein, Mutti«, stellte er fest. »Sie hat mir das Bein gestellt, das stimmt. Dass ich so blöd hingefallen bin, war nicht ihre Schuld. Ich habe ihr eine Ohrfeige gegeben und damit waren wir eigentlich quitt. Warum hat sie gedacht, dass die Polizei sie holen wird?«
»Weil sie ein schlechtes Gewissen hatte.«
»Ich finde es von Michael aber doch nett, dass er sie nicht in Stich lassen wollte.«
Dass diese brüderliche Verbundenheit allerdings fast dazu geführt hätte, dass Cornelia in dem Schrank erstickt war, verheimlichte man ihm doch.
»Ist sie nun netter?«, erkundigte sich Dominik argwöhnisch.
»Sie ist sehr bedrückt«, erwiderte Denise.
»Sie geht in sich«, mischte sich Alexander von Schoenecker ein.
Dominik zeigte sich außerordentlich tolerant. »Weißt du, Mutti, so ganz kann man ihr auch nicht alles übel nehmen. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch recht ekelhaft wäre, wenn ihr mich einfach in ein Heim stecken würdet.«
»Ihre Eltern taten es aber, damit sie sich anpassen lernen und ihren Hochmut verlieren«, erklärte ihm Denise.
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«, fragte er nachdenklich. »Man macht manches ganz anders, wenn man weiß, worum es geht.«
»Hört, hört«, lächelte Alexander von Schoenecker. »Unser gescheiter Sohn!«
»So gescheit bin ich nun auch wieder nicht. Aber wir haben eigentlich doch schon eine ganze Menge mitgemacht, und die Kinder sind alle verschieden, das haben wir doch auch schon erlebt. Es wäre ja auch grässlich langweilig, wenn alle gleich wären.«
»Wir können doch so manches von den Kindern lernen«, meinte Alexander schmunzelnd zu seiner Frau, als sie in ihrem gemütlichen Wohnraum beisammensaßen. »Das waren wieder aufregende Tage, Liebes. Nun wird es wohl ein Weilchen wieder im Trott gehen.«
Aber ganz einfach gestalteten sich auch die kommenden Tage nicht. War Cornelia erst renitent und boshaft gewesen, so schien sie jetzt in Melancholie zu versinken, und mehr als einmal fühlte sich Frau Rennert versucht, ihre Eltern davon zu unterrichten. Schließlich hatte man gehofft, dass die Kinder lernen sich anzupassen, dabei sollten sie aber fröhliche, aufgeschlossene Kinder werden. Es war nicht der Sinn der Sache, dass das Gegenteil erreicht wurde.
Was Michael betraf, zeigte er sich jetzt allerdings doppelt zugänglich. Mit Toni verband ihn eine innige Zuneigung, die ihn darüber hinwegtröstete, dass Nele immer verschlossener wurde.
Die Woche verging, bis Dominik erstmals wieder in Sophienlust erschien. Sofort verschwand Cornelia in ihrem Zimmer.
»Warum rückt sie denn aus?«, fragte Dominik. »Ich tue ihr doch nichts. Ist doch wieder alles in Ordnung.«
Für ihn war es das schon, aber für Cornelia noch lange nicht.
Während der entsetzlichen Minuten in dem dunklen Schrank, als die Luft immer dünner wurde und sie so richtig das Fürchten lernte, waren ihr viele Gedanken gekommen. Und als sie dann wieder aus der Ohnmacht aufwachte und alle lieb und freundlich zu ihr waren, hatte sie ganz besonders stark empfunden, wie ungerecht sie selbst gewesen war.
Es gab noch vieles zurechtzubiegen, bevor sie wieder richtig lachen konnte. Da war Rosi, die manchmal scheu versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen, da war Sascha, der sie an jenem Tag so sehr zusammengeschimpft hatte, und nun kam Dominik, dem gegenüber sie sich noch immer schuldig fühlte.
Sie erinnerte sich auch ganz genau daran, wie oft sie früher ihre Lehrer geärgert hatte, wie oft ihre Mutti in die Schule gehen musste, um sich deren Klagen anzuhören.
Cornelia saß am Fensterbrett und blickte in den Park. Die Sonne lockte, die Hunde bellten und von weither vernahm sie das Lachen der Kinder. Sicher waren sie bei den Ponies.
Habakuks Kreischen klang zu ihr empor. Er schnatterte mal wieder seinen ganzen Wortschatz herunter, wohl weil niemand da war, der sich mit ihm beschäftigte.
Gar zu gern wollte sie sich auch mal mit dem Papagei unterhalten, sie traute sich nur nicht recht. Aber wenn jetzt niemand da war – ob sie es dann mal wagen konnte?
Ganz leise ging sie die Treppe hinab. In der Küche sang Magda laut und falsch. Sonst war alles ruhig.
Verstohlen schlich sich Cornelia in den Wintergarten, wo Habakuks großer Vogelbauer stand. Auch ein beleuchtetes Aquarium war dort zu finden, in dem sich schillernde Fischlein tummelten.
»Tag«, kreischte Habakuk, als sie an seinen Bauer trat. »Schönes Wetter heute!«
Jedes Wort konnte man deutlich verstehen. Cornelia staunte nur so. Nun lachte er auch noch, und es klang genauso wie Magdas raues Lachen.
»Schöner Habakuk«, lobte er sich selbst.
»Ja, du bist ein schöner Habakuk«, wiederholte sie leise.
»Nick, wo bist du? Wo steckt der Schlingel wieder? Donnerwetter, Donnerwetter! Wo ist das Baby? Rrrosi – kommst du her?« Er rollte das R, legte den Kopf schief und betrachtete Cornelia dann aus seinen wachsamen Knopfaugen.
»Sag doch auch mal Nele«, tönte plötzlich eine Stimme durch den Raum. Mit verschränkten Armen kam Dominik näher.
»Sag Nele, Habakuk«, forderte er den Papagei auf.
»Nick, du Schlingel, wo hast du gesteckt?«, kreischte der.
»Siehst du, Nele, er sagt Schlingel zu mir«, bemerkte Dominik. »Wollen wir uns wieder vertragen?«
Staunend sah sie ihn an. »Du bist mir nicht mehr böse?«, fragte sie leise.
»Böser Habakuk«, tönte es aus dem Bauer. »Guter Habakuk. Nele – Nele, Nele, Nele.«
»Jetzt hat er’s«, meinte Dominik zufrieden. »Nun wird er es dauernd sagen. Komm doch mit raus. Es ist so schönes Wetter. Reiten darf ich noch nicht, aber wir können doch mal zum See gehen und die jungen Enten anschauen. Magst du nicht?«
Und ob sie mochte. Sie konnte es nur immer noch nicht glauben, dass Dominik das erste Wort gesagt hatte.
»Ich hatte ja solche Angst«, flüsterte sie. »Ich dachte, du wärst tot.«
»So schnell stirbt man nicht«, meinte Dominik gleichmütig. »Ich bin schon öfter mal hingefallen. Außerdem habe ich dir ja eine geschmiert.«
»Das war nur richtig«, meinte Cornelia einsichtig.
»Nein, es war nicht richtig. Ein Junge darf kein Mädchen schlagen.«
»Aber man darf auch kein Bein stellen«, murmelte sie. »Früher habe ich es oft gemacht, aber es ist nie was passiert.«
»Na ja, reden wir nicht mehr darüber«, meinte Dominik gutmütig. »Wirst du dich jetzt auch mit den anderen vertragen? Vor allem mit Rosi?«
»Wenn sie mag«, meinte Cornelia zweifelnd.
»Suchen wir sie mal«, schlug Dominik vor. »Dann kann sie mit uns zum See gehen und dort rauchen wir die Friedenspfeife.«
»Rauchen?«, fragte Cornelia entsetzt.
»Doch nicht richtig, nur so symbolisch –. Ach, ich kann dieses dämliche Wort nie richtig aussprechen. Kannst du es?«
Cornelia schüttelte den Kopf. Dominik war höchst befriedigt, dass sie es auch nicht wusste.
»Wenn wir erst einmal in die Oberschule gehen, lernen wir es schon«, meinte er.
Rosi fanden sie nicht. Man hatte sie aus dem Kreise der spielenden Kinder geholt. Warum wusste noch niemand. Sie erfuhren es erst später. Rosis Vater war gestorben.
*
Sterben war etwas, was ein Kind schwer begreifen konnte. Rosi nickte nur, als Denise es ihr mit liebevollen Worten erklärte. Sie hatte nur eine Angst.
»Ich möchte so gern hierbleiben«, flüsterte sie. »Wird Mutti mich nun holen?«
Darüber war noch keine Entscheidung gefallen. Frau Winzer hatte nur kurz mitgeteilt, dass sie persönlich kommen würde, um alles zu regeln, sobald sie all die Formalitäten hinter sich gebracht hätte.
»Ich weiß noch nicht, was deine Mutter entscheidet, Rosi«, meinte Denise von Schoenecker behutsam. »Nun hätte sie doch Zeit für dich.«
»Ich möchte aber hierbleiben«, beharrte Rosi. »Ich will nicht wieder allein sein.«
Denise blickte ihr nachdenklich nach. »Sie hatte niemals Sehnsucht nach ihrer Mutter gezeigt, war das nicht unnatürlich?«, überlegte sie. »Was machen solche Mütter nur falsch, dass ihre Kinder lieber unter Fremden waren?«
Cornelia bemerkte, wie bedrückt Rosi in ihr Zimmer schlich. »Bist du sehr traurig?«, fragte sie leise, nachdem sie sich dazu durchgerungen hatte, ihr zu folgen.
Nick hatte ihr heute gezeigt, wie man es machen konnte, um eine Brücke zu schlagen.
Rosi sah sie geistesabwesend an. »Ich bin traurig, wenn ich von Sophienlust weg muss«, flüsterte sie.
»Willst du nicht zu deiner Mutti?«, wunderte sich Cornelia.
Rosi schüttelte heftig den Kopf. »Warum redest du mit mir?«, fragte sie dann erstaunt.
Cornelia errötete. »Mit Nick habe ich mich auch vertragen. Ich möchte nie mehr mit jemand böse sein. Ich gebe auch nie mehr an.«
»Früher habe ich auch angegeben«, gestand Rosi ein. »Hier habe ich so viel gelernt. Nun kommt Tammy sicher bald zurück und ich habe mich so darauf gefreut. Sie bleibt doch auch ganz freiwillig hier, wo sie so schrecklich reich ist.«
Von Tammy hatte Cornelia schon manches gehört, aber bockig, wie sie gewesen war, hatte sie kein großes Interesse an diesem Mädchen gezeigt.
»Tammy hat gesagt, dass Geld überhaupt nichts wert ist, wenn man kein richtiges Zuhause hat«, fuhr Rosi fort. »Und neulich hat sie geschrieben, dass sie sich schon wieder sehr auf Sophienlust freut.«
»Wo ist sie denn jetzt?«, erkundigte sich Cornelia.
»Nur mal in Wolkenstein bei Natascha, weil die Tante Viola ein Kind bekommen hat.«
Von ihren Sorgen war Rosi einstweilen abgelenkt. Sie erzählte Cornelia von Natascha und Tammy und von dem wunderschönen Aufsatz, den Tammy einmal über Sophienlust geschrieben und für den sie eine Auszeichnung bekommen hatte.
»Von allen Kindern wird ein Tagebuch geführt«, erklärte sie wichtig.
»Steht da auch drin, was man angestellt hat?«, erkundigte sich Cornelia besorgt.
»Ich glaube, bloß das Gute«, stellte Rosi sinnend fest. »Sonst würde es ja ein ganz dickes Buch. Angestellt hat jeder mal was. Aber Tammys Aufsatz ist gedruckt worden, sogar in den Zeitungen.«
»Ob ich den auch lesen darf?«, fragte Cornelia.
»Na klar, frag doch mal Tante Rennert.«
Sie lächelten sich schüchtern an. »Du wirst schon noch einsehen, wie schön Sophienlust ist, Nele«, meinte Rosi dann versöhnlich.
Davon war Cornelia nun schon fast überzeugt, und sie wurde es noch mehr, als sie später Tammys wunderschönen Aufsatz las, in dem eigentlich alles stand, was über Sophienlust zu sagen war.
»Hier wird nicht gefragt: Wer bist du? Woher kommst du, was besitzt du? Hier wird die Tür aufgetan und es heißt: Willkommen.«
Leise wiederholte Cornelia jedes Wort. Sehr, sehr reich sollte Tammy sein. Noch viel reicher als Dominik und dennoch schrieb sie solche Worte.
Sie musste es gleich Michael erzählen. »Ich weiß das schon lange«, erklärte er zu ihrem Erstaunen. »Mir ist es auch ganz wurscht, wo sie alle herkommen, Hauptsache, wir verstehen uns alle. Bist du nun nicht mehr bockig, Nele? Hast du dich auch mit Rosi vertragen?«
»Sie möchte gar nicht mehr zu ihrer Mutti zurück«, murmelte sie. »Willst du denn auch nicht mehr zu Mutti und Vati zurück, Michael?«
»Doch. Aber jetzt bin ich erst mal gerne hier.«
*
»Ich bin gerne hier«, sagte auch Lilly zu Margit Olberg, als diese sie überraschend freundlich fragte, wie es ihr denn so gefalle.
»Wirklich?«, fragte Margit gedehnt. »Sie sind doch solche Arbeit gar nicht gewöhnt.«
»Ganz hübsch anpacken musste sie schon, aber Lilly betrachtete es nicht so als Strafe, wie Margit dies erwartet hatte. Sie war dankbar, dass man ihr noch einmal eine Chance gegeben hatte.
Luis Ilberg war freundlich, aber auch sehr bestimmt. Er zeigte ihr auch mit keiner Miene, dass er gerührt war, wie eifrig sie ihren Pflichten nachkam.
Lilly hatte eine Menge dazugelernt. Die ersten Tage hatte sie noch Angst gehabt, dass sie sich falsche Hoffnungen machte, aber dann hatte Georg Händle, der nette Schorsch, ihr die gute Nachricht bringen können, dass es kein Verfahren gegen sie geben würde. Wie von einem schweren Druck befreit, ging sie nun doppelt freudig ihrer Arbeit nach. Joachim und Martina Diering hatten Wort gehalten. Sie hatten es sich nicht anders überlegt, wie sie noch immer gefürchtet hatte.
»Würden Sie bitte heute auf den Markt fahren, Lilly?«, fragte Margit. »Wir bekommen Gäste. Gleich drei – und da ist es besser, wenn ich im Hause bin.«
Dass man ihr sogar Geld anvertraute und den Wagen, machte Lilly glücklich. Ihre Wangen färbten sich rosig.
»Gern – natürlich«, stammelte sie verwirrt.
»Da ist die Liste«, sagte Margit. »Fahren Sie vorsichtig. Es ist eine alte Kiste. Und wenn Sie fertig sind, können Sie Luis vom Bahnhof abholen. Er kommt mit dem Zwölfuhrzug.«
Ganz frei von Argwohn war Margit noch immer nicht. Aber Luis hatte es so gewollt, damit Lilly wieder Selbstbewusstsein bekam. Wenn sie mit dem Auto und dem Geld durchbrannte, musste er es verantworten. Allzu viel würden sie dabei ja nicht verlieren, dachte Margit optimistisch. Höchstens Luis seinen Glauben an die hübsche Lilly. Manchmal fühlte sie sich sogar versucht, ihm das zu wünschen, aber dann schalt sie sich wieder zu misstrauisch.
Zu beklagen brauchte sie sich wirklich nicht. Lilly hatte sich viel anstelliger gezeigt, als sie es erwartet hatte und sie tat sogar manches, was man gar nicht von ihr verlangte.
Lilly war noch keine zehn Minuten fort, als bereits der erste Gast eintraf. Ein sehr charmanter junger Mann, wie Margit feststellen musste, der sie beiläufig informierte, dass ihn Geschäfte hierher verschlagen hätten, bevor sie sich noch Gedanken darüber machen konnte.
»Sie werden den Betrieb doch nicht ganz allein aufrechterhalten?«, fragte er liebenswürdig.
Von Betrieb konnte man zu dieser vormittäglich ruhigen Stunde zwar nicht sprechen, aber Margit fand es sehr nett von ihm, so teilnahmsvoll zu sein.
Solch ein Mann war Margit Olberg noch nicht begegnet. Dagegen war Schorsch ein richtiger Bauer und selbst Luis konnte ihm nicht das Wasser reichen.
Erfreut, sich mit ihm unterhalten zu können, erzählte sie bereitwillig, dass sie den Gasthof zusammen mit ihrem Bruder leite, und dass sie auch noch eine Hilfe hätten, die aber gerade zum Markt gefahren sei.
»Hoffentlich eine tüchtige Hilfe«, meinte er.
»Sie arbeitet sich ein.« Mehr sagte Margit jedoch nicht, denn es wurde ihr plötzlich bewusst, dass es wohl doch zu weit führte, mit einem gänzlich Fremden so vertraut zu sprechen. Aber sie wies ihm doch das schönste Gästezimmer zu. Danach wurde sie abgelenkt, weil die anderen Gäste eintrafen.
Währenddessen tätigte Lilly gewissenhaft ihre Einkäufe und erreichte gerade noch rechtzeitig den Bahnhof, um Luis abzuholen.
Sie wunderte sich, dass er sie so strahlend begrüßte. »Hallo, das ist aber eine Überraschung«, sagte er mit einem erleichterten Seufzer. Sie ahnte nicht, dass er bis zu dieser Sekunde befürchtet hatte, weder sie, noch sein altes Auto wiederzusehen.
»Ihre Schwester hat mich zum Markt geschickt«, erklärte Lilly errötend. »Ich habe es gerade noch geschafft.«
»Das ist fein. Ich habe einen Mordshunger«, erwiderte er. Dann sprach er ermunternd auf den alten Wagen ein, der nicht anspringen wollte.
»Nächste Woche bekommen wir einen neuen«, erzählte er. »Der hat wirklich ausgedient, aber nach Hause wird er uns wohl noch bringen. Hoffentlich«, fügte er mit einem Stoßseufzer hinzu.
Aber unterwegs bockte er wieder mitten auf der Landstraße, er nutzte die Gelegenheit, ein paar persönliche Worte mit Lilly zu wechseln.
»Ist es Ihnen schon über, auf dem Lande zu leben?«, fragte er, während er sich mühte, den Motor wieder in Gang zu bringen.
»Nein«, erwiderte sie verlegen.
»Ich hatte nicht gedacht, dass Sie meinen Vorschlag annehmen«, bemerkte er nachdenklich. »Die Dierings hätten Ihnen sicher auch eine Chance gegeben.«
»Ich hätte sie nicht annehmen können«, erwiderte sie stockend. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Olberg. Es gibt nicht viele Menschen, die so großmütig sind.«
»Machen Sie mich bloß nicht verlegen«, brummte er. »Na, nun macht er es ja noch mal. Man darf nur die Geduld nicht verlieren. Mit den Maschinen so wenig, wie mit den Menschen. Jeder hat seine Mucken.«
Sie betrachtete ihn unauffällig. Er hatte keine Launen. Er blieb sich immer gleich. Sein Leben verlief in festumrissenen Bahnen. Neugierig und zugleich ein wenig bange hatte sie während dieser Tage darauf gewartet, dass irgendwann mal ein Mädchen auftauchte, mit dem er vertraut war, aber sie hatte umsonst gewartet.
»Der Luis hat ganz bestimmte Vorstellungen von einer Frau«, hatte Margit gestern erst gesagt, und es hatte wie eine Warnung geklungen.
Lilly dachte jetzt wieder darüber nach. Es musste gut sein, einen solchen Mann zu haben, bei dem man sich so sicher und geborgen fühlen konnte, aber eine solche Chance hatte sie sich wohl für alle Zeiten verscherzt. Es stimmte sie traurig.
»Haben Sie diesen Kerl eigentlich geliebt?«, fragte Luis, als ahne er ihre Gedanken.
»Eingebildet habe ich es mir wohl«, flüsterte sie. »Er hat mich eingewickelt. Blind und taub war ich. Aber dafür werde ich ja mein Leben lang bezahlen.«
»Doch nicht gleich ein ganzes Leben lang«, stellte er gutmütig fest. Eine leise Hoffnung keimte in ihr, aber diese sollte rasch erlöschen, als sie den Jägerhof erreichten.
Margit begrüßte ihren Bruder freudig, Lilly mit einem langen gedankenvollen Blick. Gemeinsam trugen sie die Taschen in die Küche.
Luis nahm seine Schwester schnell beiseite. »Na, noch immer skeptisch?«, fragte er leise. »Du hast doch gedacht, sie brennt durch.«
»Dann habe ich eben falsch gedacht«, erwiderte sie. »Aber ich bin fair genug, es einzugestehen. Übrigens sind die Gäste schon da.«
Auch einige Durchreisende fanden sich jetzt in der Gaststube ein. Lilly hatte keine Zeit sich zu erfrischen. Sie musste der Bedienung zur Hand gehen.
»Darf ich um die Speisekarte bitten«, sagte eine einschmeichelnde Stimme, als sie eben eine Bestellung aufgenommen hatte.
Lilly glaubte, der Boden müsse sich unter ihren Füßen auftun, als sie in Joschis spöttische Miene blickte.
Nur mit aller Mühe gelang es ihr, die Fassung zu bewahren. Mit zitternder Hand, sich von Margit beobachtet fühlend, legte sie die Karte vor ihn hin.
»Ich habe lange gebraucht, dich zu finden«, zischte er. »Ich muss dich nachher sofort sprechen. Und mach ja keine Zicken, Kätzchen, sonst drehe ich dir deinen hübschen Hals um.«
Lilly rannte fast in die Küche. Sie musste sich am Tisch festhalten, so elend war ihr.
Mein Leben lang wird er mich verfolgen, ging es ihr durch den Sinn. Nirgendwo werde ich Ruhe finden.
»Wo sind Sie denn bloß mit Ihren Gedanken, Lilly?«, fragte Margit, die am Herd stand. »Hat unser schicker junger Logiergast Sie aus der Fassung gebracht?«
Er hatte also die Dreistigkeit besessen, sich hier einzumieten. Und er würde sie peinigen, das ahnte sie. Wahrscheinlich glaubte er, dass sie noch im Besitz des Geldes war.
Genau das glaubte Joseph Kovac, da er nichts, aber auch gar nichts in den Zeitungen gelesen hatte, was dagegen sprach. Und er hatte alle Zeitungen genauestens studiert.
Durch einen Zufall war er auf Lillys Spur gekommen, und zwar ausgerechnet durch jenen freundlichen alten Herrn, der sie in jener Nacht mitgenommen hatte und der in angeregter Stimmung unter Geschäftskollegen dieses harmlose kleine Abenteuer in einer Gastwirtschaft erzählte.
Raffiniert wie Joschi Kovac war, hatte er ihn daraufhin ausgehorcht, ihm warnend Beispiele aufzählend, was einem Autofahrer alles passieren konnte, wenn er Anhalter mitnahm.
Jetzt triumphierte er. Er war ein Hasardeur. Er glaubte an sein Glück, und es schien ihm hold zu sein.
Lilly aber hatte nur einen Gedanken. Sie musste weg von hier, weg von Luis, weg von Margit, deren Vertrauen sie nicht missbrauchen durfte, aber vor allem weg, weit weg von diesem Mann, mit dem das Unglück in ihr Leben gekommen war.
Wie sie ihren Pflichten in diesen Stunden gerecht werden konnte, wusste sie später nicht mehr zu sagen. Sie wusste, dass Joschi nur auf den Augenblick lauerte, sie in die Zange zu nehmen. Aber so weit wollte sie es gar nicht erst kommen lassen.
All seinen wirklich bestechenden Charme einsetzend, auf den schon so viele Menschen hereingefallen waren, unterhielt er sich jetzt mit Margit und Luis Olberg, und um die Situation noch makaberer zu machen, war auch Schorsch erschienen und setzte sich zu ihnen.
Lilly konnte es von der Durchreiche aus beobachten. Sie holte tief Luft und fasste einen Entschluss.
»Ich bin gleich zurück«, sagte sie zu der Spülerin, die gar nicht von ihrer Arbeit aufblickte. So, wie sie war, im einfachen Hauskleid, schlich sich Lilly über den Hof, wieder einmal auf der Flucht.
Doch diesmal war es helllichter Tag und jeden Augenblick musste sie eine Entdeckung fürchten.
Diesmal hatte sie wirklich kein Geld und sie hatte noch weniger ein Ziel als damals. Blindlings lief sie am Bach entlang dem Wald zu wie ein gehetztes Wild, das nun keinerlei Chancen mehr hatte.
*
»Ich werde doch mal nach Lilly sehen«, sagte Luis Olberg. »Ich glaube, sie ist noch nicht zum Essen gekommen.«
Joseph Kovac nützte seine Abwesenheit zu einer raschen Frage an Margit.
»Ein recht kränkliches Ding scheint die Kleine zu sein. Ist sie Ihnen denn wirklich eine Hilfe?«, meinte er scheinheilig.
»Sie hat Pech gehabt und da haben wir sie aufgenommen«, bemerkte Margit beiläufig.
»Lilly ist weg«, rief da ihr Bruder erregt. »Sie ist tatsächlich weg.« Seine Miene drückte Fassungslosigkeit aus.
»Ich habe es dir ja immer gesagt«, meinte Margit wegwerfend.
Joseph Kovacs Gesicht verzerrte sich, aber das bemerkte niemand. Sollte ihm Lilly ein zweites Mal entkommen? Er war wütend auf sich, dass er sie aus den Augen gelassen hatte. Aber so schnell gab er nicht auf.
»Nun, Sie haben doch die Polizei im Hause«, meinte er lässig. »Wenn sie etwas auf dem Kerbholz hat, fangen Sie sie doch wieder ein.«
»Wie kommen Sie darauf, dass sie etwas auf dem Kerbholz hat?«, fragte Luis Olberg gereizt.
»Entschuldigung, es war nur so ein Gedanke. Ich habe jetzt auch eine Verabredung. Sie wird schon wiederkommen«, warf er gleichmütig hin. »Bis später dann.«
»Der Typ gefällt mir nicht«, knurrte Georg Händle hinter ihm her.
»Du bist nur eifersüchtig«, neckte ihn Margit. »Ein sehr charmanter Mann, finde ich.«
»Zu charmant«, grunzte Schorsch.
»Habt ihr nichts anderes im Kopf?«, fauchte Luis sie an. »Lilly ist weg.«
»Na, vielleicht hat sie ein Rendezvous mit unserem charmanten Gast«, meinte Margit anzüglich. »Sie war vorhin ganz weg.« Ihre Stirn legte sich in Falten. »Ja, wenn ich es mir recht überlege, kann nur er der Grund gewesen sein, dass sie so verstört war.«
»Verstört war sie?«, fragte Luis erregt. »Warum sagst du das jetzt erst?«
»So viel habe ich mir nun auch wieder nicht dabei gedacht«, stellte sie kleinlaut fest. »Ja, jetzt kommt es mir auch komisch vor, dass sie fortgelaufen sein soll. Heute Vormittag hätte sie doch eine weitaus bessere Gelegenheit dazu gehabt.«
»Dieser Kerl«, knirschte Luis. »Es muss dieser Kerl sein, der sie in die Geschichte hineingeritten hat. Und wir haben einen Polizisten am Tisch sitzen, der untätig zusieht.«
»Nun werde mal nicht ungerecht«, ereiferte sich Margit, um Schorsch in Schutz zu nehmen. Sie fühlte sich nicht frei von Schuldbewusstsein, denn sie hatte sich von dem galanten Getue sehr beeindrucken lassen.
»Genug des Redens. Wir müssen sie finden«, murmelte Luis. »Sie bringt es fertig, sich etwas anzutun.«
»Konrad nennt sich der Mann«, sinnierte Schorsch. »Hast du dir seine Papiere zeigen lassen, Margit?«
Niedergeschlagen musste sie eingestehen, dass sie dies versäumt hatte.
»Dich hat er ja auch chloroformiert«, stellte Luis daraufhin wütend fest. »Und ich habe mich auch noch von ihm beschwatzen lassen. Los, Schorsch, walte du deines Amtes, ich mache mich auf die Suche nach Lilly.«
Aber Stunden später kam er ohne sie erschöpft zurück, und auch von Joschi Kovac war nicht die kleinste Spur gefunden worden. Er hatte allerdings ein Auto. Lilly nicht, und Luis Olberg wurde von den sorgenvollsten Gedanken gepeinigt.
*
Das Leben ist sinnlos, dachte Lilly, während sie auf wunden Füßen vorwärtswankte. Man kann seiner Strafe nicht entkommen. Irgendwie ereilt sie jeden.
Aber sich jetzt feige aus dem Leben schleichen, um Luis Olberg auch noch ins Gerede zu bringen? In einem kleinen Ort war das ganz anders als in einer großen Stadt. Da kümmerte sich jeder um jeden. Er hatte ihr den Weg in eine neue Zukunft weisen wollen, und sie war ihm dankbar dafür gewesen. Sollte sie jetzt kapitulieren?
Diese und andere Gedanken kamen und gingen, während sie immer weiter durch den Wald lief, der kein Ende zu nehmen schien.
Und dann stand sie doch plötzlich auf einer Straße und wurde von dem grellen Licht eines Scheinwerfers erfasst, dass sie völlig verstört und wie versteinert stehen blieb.
Bremsen kreischten. Kurz vor ihm kam der Wagen zum Stehen. Sie hatte keine Kraft mehr zu entfliehen.
»Zum Teufel, Mädchen«, sagte eine tiefe Stimme, »können Sie sich nicht etwas Besseres einfallen lassen, als mir beinahe ins Auto zu laufen?«
»Schimpf sie nicht, Onkel Hubert«, sagte da eine helle Mädchenstimme aus dem Wagen heraus. »Schau doch, wie sie aussieht.«
Hemmungsloses Schluchzen schüttelte Lilly. Es war nicht Joschi, wie sie in einer Wahnvorstellung gefürchtet hatte, es waren fremden Menschen.
»Bitte, bitte, nehmen Sie mich ein Stück mit«, flehte sie. »Nur zum nächsten Polizeirevier. Ich will nicht mehr – ich will nicht mehr«, fügte sie mit versagender Stimme hinzu.
Mit sanfter Gewalt wurde sie in den Wagen geschoben. Verschwommen sah sie ein junges Mädchengesicht, spürte eine leichte Hand.
»Haben Sie keine Angst«, sagte die helle Stimme tröstend. »Ich heiße Tammy. – Bitte, Onkel Hubert, nimm sie mit nach Sophienlust.«
Ein leiser Aufschrei kam von Lillys Lippen. »Sophienlust«, flüsterte sie. »Sophienlust! Ich träume. Das kann nur ein Traum sein.«
Der Wagen glitt dahin, doch Lilly meinte, auf Wolken geradewegs in den Himmel zu schweben. Sie war gar nicht mehr auf dieser Welt, glaubte sie. Und wie aus weiter Ferne hörte sie, wie die tiefe Männerstimme sagte: »Sie scheint Sophienlust zu kennen.« Es klang verwundert.
Gott straft mich nicht, ging es durch Lillys Sinn. Er hat mir einen Schutzengel gesandt, der mich nach Sophienlust bringt. Pat – Martina – wie durch einen Schleier sah sie die Gesichter und dann nur noch eines. »Luis«, hauchte sie, dann sank ihr Kopf müde zurück.
»Du hast gehört, sie will zur Polizei, Tammy«, sagte Hubert von Wellentin nachdenklich.
»Sie ist todmüde, Onkel Hubert. Sie hat Angst. Sie brauchte Hilfe.«
»Ihr Weltverbesserer«, brummte er. »Die alten wie die jungen – Sophienlust scheint euch ein Himmelreich zu sein.«
»Dir nicht auch, Onkel Hubert?«, fragte Tammy. »Ist es nicht wundervoll zu wissen, dass es ein solches Himmelreich auf Erden gibt, wohin man sich flüchten kann, wo man geborgen und zufrieden ist.«
»In Wolkenstein hat es dir doch auch gefallen«, gab er brummig zurück, um seine tiefe Rührung zu verbergen. »Sie wollten dich doch gar nicht weglassen.«
»Es gibt sicher viele schöne Orte auf der Welt«, flüsterte sie, »aber kein zweites Sophienlust.«
»Ich sehe es schon noch kommen, dass du deinen Jack überreden wirst, sich dort auch noch niederzulassen. Dann werden wir noch ganz international.«
Tammy lächelte in sich hinein. »Vielleicht hast du mal eine Stellung für Jack, wenn er so weit ist.«
»Das bringst du fertig, Tammy«, murmelte er. »Mit dir haben wir uns was eingehandelt. Eines Tages kaufst du uns alle auf.«
Sie lachte leise. »Du weißt genau, dass ich das nie versuchen würde. Sophienlust bleibt ewig so, wie es die Urgroßmama Wellentin bestimmt hat.«
»Aber vergiss nicht hinzuzufügen: Was Denise daraus gemacht hat!«
Ein Weilchen war Schweigen zwischen ihnen. »Es ist doch gut, dass wir so spät von Wolkenstein weggefahren sind«, sagte Tammy dann. »Wir sollten sie finden.«
»Diesmal ist es wenigstens ein erwachsener Findling«, äußerte er sich.
Durch diese glückliche Fügung kam Lilly Rank zum zweiten Mal nach Gut Sophienlust.
Tammy, von allen sehnlichst erwartet, wurde umdrängt. Frau Rennert aber starrte verblüfft in das zerkratzte und verschmutzte Gesicht der Fremden.
»Die kenne ich doch«, stöhnte sie. »Das ist Lilly Rank. Guter Gott, was steht uns nun wieder bevor.«
Doch jetzt war später Abend. Lilly war unfähig eine Erklärung abzugeben, und Hubert von Wellentin, von Frau Rennert rasch informiert, in welchem Zustand sie Lilly Rank kennen gelernt hatte, war auch dafür, dass man sie erst einmal ausschlafen ließ, bevor man etwas unternahm.
Die Kinder waren schon viel zu lange aufgeblieben, aber in Sophienlust machte man eben Ausnahmen, wenn jemand erwartet wurde, und Tammy war von allen sehnsüchtig erwartet worden.
Man musste ja auch noch erfahren, wie es Nataschas Tante Viola und ihrer kleinen Tochter ging, und ob Natascha bald einmal wieder zu Besuch kommen würde.
Nur Cornelia und Michael, die Tammy noch nicht persönlich kannten, hielten sich ein bisschen zurück.
Schließlich musste Frau Rennert doch ein Machtwort sprechen, das allerdings nicht für Tammy und Carola galt, die sich noch zu ihnen in den Wohnraum setzten.
Tammy erzählte, wie Lilly ihnen vor den Wagen getaumelt war. Frau Rennert konnte dazu nur den Kopf schütteln.
»Es ist doch zu eigenartig«, meinte sie, »wie das Schicksal immer wieder spielt. Mehr als hundert Kilometer von uns entfernt, kommt ihr des Weges, um ein Mädchen aufzugreifen, das Sophienlust bestimmt nicht wiedersehen wollte.«
Doch in dieser Prognose sollte sie sich sehr getäuscht haben. Lilly lag in einem weichen Bett, gebadet und in ein sauberes Nachthemd gehüllt und dachte: Ich bin in Sophienlust. Hierher wird er nicht kommen. Hier kann mir nichts geschehen. Diese Menschen sind voller Güte. Vielleicht darf ich bei ihnen bleiben. Ja, – sie werden mich nicht wegschicken, wenn ich ihnen alles erzähle. Frau von Schoenecker hat damals gesagt, dass für jeden Platz ist, der Hilfe braucht.
Und weit von Sophienlust entfernt jagte ein Wagen in entgegengesetzter Richtung durch die Nacht. Joseph Kovac hatte es aufgegeben, nach Lilly zu suchen, als er die Sirene eines Streifenwagens gehört hatte.
Alle möglichen Gedanken gingen ihm durch den Sinn. Vielleicht hatte sie nur einen günstigen Augenblick abgepasst, um diesen Polizisten über seine Identität aufzuklären. War sie fähig gewesen, mit dem Geld zu entkommen, musste er sie auch dessen fähig halten.
Aber wenn sie das Geld noch besaß, hatte sie es doch nicht nötig, so schwere Arbeiten zu verrichten, in einer Gastwirtschaft zu dienen und als Küchenhilfe einzuspringen? Er konnte sich keinen Reim darauf machen.
Er hatte es ihr nicht zugetraut. Er hatte gedacht, dass sie vorerst irgendwo unterschlüpfen wollte und genau genommen, hatte er auch nicht erwartet, sie dort zu finden.
Wenn dieser Polizist nun seine Autokennzeichen notiert hatte? Ein wacher Bursche war er schon gewesen.
Er sah in den Rückspiegel. Scheinwerfer folgten ihm. Er vergrößerte das Tempo. Er holte aus dem Wagen heraus, was er nur konnte, aber der andere Wagen blieb ihm auf den Fersen, und dann packte ihn höllische Angst, als er wieder Sirenengeheul vernahm.
Er versuchte, in einem schmalen Seitenweg zu entkommen, schaffte aber die scharfe Kurve nicht. Sein Wagen geriet ins Schlingern, stieß irgendwo an, und dann war nur Getöse um ihn. Ein stechender Schmerz durchfuhr seinen Körper, aber denken konnte er nichts mehr. Finstere Nacht hüllte ihn ein.
»Entweder total übergeschnappt oder betrunken«, sagte eine Stimme wenig später. »Hat der Kerl denn nicht gesehen, dass hier Geschwindigkeitesbegrenzung ist? Na, viel wird da nicht mehr zu machen sein.«
Joseph Kovac, genannt Joschi, war tot, bevor noch der Krankenwagen an der Unglücksstelle eintraf.
Luis Olberg und seine Schwester Margit erfuhren es bereits am nächsten Morgen von Schorsch.
Für Luis Olberg war es die Bestätigung, dass es sich um den Mann gehandelt hatte, den Lilly fürchtete. Er war tot, aber Lilly blieb verschwunden, obgleich sie nun keine Angst mehr vor ihm zu haben brauchte.
Niemand konnte ihm auch nur den kleinsten Hinweis geben, wo sie geblieben sein könnte.
So wortkarg und verschlossen hatte Margit ihren Bruder noch nie erlebt, wie an diesem Tag und den folgenden.
»Du brauchst dir doch keine Vorwürfe zu machen, versuchte sie ihn zu trösten, aber ihre Worte verhallten ungehört.
Trotz aller Widersprüche, die in diesem Mädchen waren, hatte er sie gern gehabt. Er hatte das Vertrauen in sie gesetzt, dass sie durchhalten würde, was sie sich vorgenommen hatte. Er machte ihr auch keinen Vorwurf, weil er wusste, dass schreckliche Angst sie zur Flucht bewegt hatte. Aber was nützte es ihm, diese Entschuldigungen für sie zu finden, wenn er nicht wusste, ob sie überhaupt noch lebte. Er hatte sich mit dem Mann, der an allem schuld war, angeregt unterhalten, während sie vielleicht eine letzte, verzweifelte Hoffnung auf seine Hilfe gesetzt hatte.
*
Lilly sah erbärmlich aus, als sie am nächsten Morgen in einem Kleid von Tammy Denise von Schoenecker gegenübersaß.
Mit zitternder Stimme und gequältem Blick erzählte sie ihre Geschichte.
»Sie brauchen sich doch nicht zu sorgen, Frau Rank«, meinte Denise beschwichtigend. »Von den Dierings brauchen Sie nichts zu fürchten. Hier sind Sie erst einmal in Sicherheit. Es wird doch wohl gelingen, diesen Kovac hinter Schloss und Riegel zu bringen.«
»Gestatten Sie mir, hierzubleiben?«, fragte Lilly niedergeschlagen. »Ich wage nicht, den Olbergs wieder unter die Augen zu treten«, flüsterte sie.
Denise sah das junge Mädchen nachdenklich an. Ihren Worten – und sie schenkte diesen bedenkenlos Glauben, war zu entnehmen, dass sie sich sehr bemüht hatte, ein neues, ehrliches Leben zu beginnen. Sie litt auch jetzt noch darunter, dass sie sich dazu hatte verleiten lassen, den kleinen Pat zu entführen. Irregeleitete Liebe war zu so vielem fähig. Immer wieder hatte sie es erfahren. Vielerlei Schicksale waren ihr in den Jahren in Sophienlust bekanntgeworden. Dicke Bücher würde sie eines Tages füllen. Schon jetzt schwollen die Akten an, die einmal Zeugnis davon geben würden, wie viel Kinder, aber auch wie viel Erwachsene, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, hier Zuflucht fanden.
Und auch andere, die Fehler in ihrem Leben gemacht hatten, ohne dabei straffällig zu werden, waren durch Sophienlust zu neuen Erkenntnissen gekommen und hatten ihrem Leben eine andere Wendung gegeben. Allen voran Hubert von Wellentin, dem es bestimmt gewesen war, Lilly im rechten Augenblick zu finden.
In aller Frühe hatte er sich schon nach seinem Schützling erkundigt und Denise Hilfe zugesichert, falls sie Schwierigkeiten bekommen sollte.
Durch ihn erfuhr sie auch, während sie noch mit Lilly sprach, welch schreckliches Ende Joschi Kavocs gefunden hatte.
Denise überlegte, ob Lilly wirklich ganz über diese unheilvolle Verliebtheit hinweg sei, bevor sie es ihr schonend sagte.
Lilly blickte sie aus leergeweinten Augen an. »Er ist tot«, sagte sie tonlos.
Sein Tod setzte ihren Qualen ein Ende – er konnte ihr neue Zuversicht bringen.
»Vielleicht möchten Sie die Olbergs jetzt informieren, wo Sie sich aufhalten?«, fragte Denise sanft.
Lilly blickte vor sich hin. »Es ist wohl besser, wenn ich ihren Weg nicht mehr kreuze«, murmelte sie. »Wenn ich hier arbeiten kann, wenn Sie mir diese Möglichkeit geben, wäre es besser für mich.«
»Sie wird ihre Gründe haben«, dachte Denise und drang nicht weiter in sie. Noch immer war sie unfertig, mit sich nicht selbst im reinen. Wo anders konnte sie dies besser erlernen als hier, wo sie nicht allein mit ihrem Schicksal war, das ganz gewiss nicht leicht war.
»Ich habe viel gelernt«, sagte Lilly schüchtern. »Ich kann in der Küche helfen und bei der Hausarbeit. Es wird mir nichts zu viel werden. Sie werden Ihr Entgegenkommen nicht bereuen, Frau von Schoenecker. Ich werde noch lange brauchen, bis ich mich von dieser Vergangenheit befreit habe, wenn es mir überhaupt gelingt.«
Helfende Hände konnte man hier immer brauchen. Niemand sah sie misstrauisch an. Jedermann empfand Mitleid mit ihr, wenn man in ihr schmales, ernstes Gesicht blickte.
»Ich kenne sie doch«, raunte Michael seiner Schwester zu, als er sie zum ersten Mal erblickte. »Sie war doch damals mit dem Polizisten da. Ob sie was angestellt hat?«
Cornelia wollte an diesen Tag gar nicht gern erinnert werden. »Es geht uns doch nichts an«, meinte sie. »Sie sieht traurig aus.«
Cornelia war nicht mehr traurig. Sie war auch nicht mehr aufsässig und ungerecht. Sie vertrug sich mit allen, nur Sascha ging sie immer noch aus dem Wege.
Aber für Tammy schwärmte sie genauso wie Rosi. Tammy war ihr noch viel mehr Vorbild als Carola. Carola war schließlich ein Waisenkind gewesen, das froh sein konnte, in Sophienlust eine Heimat zu finden, aber Tammy war ganz freiwillig hier und teilte alles mit ihnen, obgleich sie so ungeheuer reich war, wie Dominik erzählte.
Sie wollte nicht in ein vornehmes Internat. Sie fuhr lieber mit Sascha und den anderen in das Gymnasium in die Stadt, und sie brachte glänzende Zeugnisse mit.
Auch das konnte Cornelia nur bewundern, denn sie hatte doch immer gedacht, dass man gar nichts zu lernen brauchte, wenn die Eltern Geld hatten.
Rosis Mutter war eines Tages gekommen, und dieser Stunde hatte das Kind mit Hangen und Bangen entgegengesehen.
Aber Frau Winzer schien recht erleichtert, dass Rosi selbst verlangte, in Sophienlust zu bleiben, und für die nächste Zeit hörten sie gar nichts mehr von ihr. Rosi fragte nicht danach. Sie vermisste ihre Mutter nicht. Sie hatte alles, was sie sich wünschte.
Es versetzte sie nicht einmal in Erschrecken, als sie erfuhr, dass ihre Mutter sich wieder verheiraten wolle und dass es ihr lieber wäre, wenn Rosi auch weiterhin in Sophienlust bleiben würde.
»Ein Stiefvater kann auch sehr nett sein, das siehst du doch bei Herrn von Schoenecker«, meinte Cornelia nachdenklich.
»Das ist doch kein Stiefvater«, meinte Rosi, »das ist ein richtiger Vati und er hat Kinder überhaupt gern.«
*
Mit all diesen Kindern war Lilly vertraut geworden. Sie tat ihnen jeden Gefallen und ganz besonders glücklich war sie, wenn sie den kleinen Henrik betreuen durfte, und Claudia Brachmann und Edith Wolfram ihr auch Stefan und Petra anvertrauten.
Ein paar Wochen waren nun schon ins Land gegangen und sie hatte ihren Eifer und ihren guten Willen viele Male unter Beweis gestellt. Über sich und auch über Luis Olberg sprach sie nur manchmal mit Tammy, die eine besondere Verpflichtung fühlte, sich Lillys anzunehmen.
»Warum schreibst du den Olbergs wenigstens nicht mal, wo du jetzt bist und was du tust. Sie werden sich vielleicht Sorgen um dich machen?«, meinte Tammy.
»Margit war sowieso immer misstrauisch gegen mich«, erwiderte Lilly bedrückt. Und an Luis wollte sie lieber nicht denken. Es stimmte sie seltsam traurig und schmerzte sogar.
Aber an Martina schrieb sie eines Tages einen langen Brief, in dem sie sich die ganze Last von ihrer Seele schrieb. Es war ein Brief, der zum Ausdruck brachte, dass sie durch eine harte Schule gegangen war und nun versuchte, mit der Vergangenheit ganz ins reine zu kommen, wenn sie gewiss sein durfte, dass Martina und Joachim Diering ihr verziehen hatten.
Sie ahnte nicht, dass Denise von Schoenecker und Martina ständig in Verbindung standen und dass Martina wohlunterrichtet von Lillys Reifeprozess war.
*
»Der Luis wird ja ein richtiger Eigenbrötler«, stellte Georg Händle eines Tages fest. »Ich hoffe doch sehr, dass er zu unserer Hochzeit ein anderes Gesicht machen wird.«
Diese Hochzeit wurde nun schon eifrig geplant. Schorsch hatte sich ganz rasch aufgerafft, weil er Margit solchen Charmeuren wie Joschi Kovac nicht mehr ausgesetzt sehen wollte.
»Sollten wir ihm nicht doch sagen, wo Lilly abgeblieben ist?«, fuhr er nachdenklich fort. »Vielleicht bedrückt ihn das?«
Schorsch hatte es natürlich erfahren, aber Margit war dafür gewesen, es Luis zu verschweigen. Sie hatte auch triftige Gründe dafür angeführt.
»Er war verliebt in sie, aber sie ist doch niemals die richtige Gastwirtsfrau«, hatte sie gemeint. »Und dann denk doch mal an ihre Vergangenheit. Bestimmt wird sie eines Tages rückfällig, bekommt Sehnsucht nach der Stadt, und er wird todunglücklich. Dazu ist mir mein Bruder zu schade. Er wird schon darüber hinwegkommen. Wahrscheinlich hat sie längst einen anderen. Diese niedlichen kleinen Mädchen finden doch immer schnell wieder einen.«
»Sie ist mal einem so halbseidenen Bruder auf den Leim gegangen«, bemerkte er rau. »Du hast dich doch auch im Handumdrehen von seinen schmalzigen Worten einwickeln lassen. Und wer weiß, ob du unter anderen Umständen nicht auch in solche Situation geraten wärest.«
»Willst du mir andichten, dass ich ein Kind entführt hätte?«, empörte sie sich. »Wenn du eine solche Meinung von mir hast, können wir die Hochzeit gleich wieder abblasen, mein Lieber.«
»Man muss das ganz realistisch sehen«, lenkte er ein. »Guck dir doch mal die jungen Mädchen an. Selbst hier bei uns in dem Kaff will eine immer mehr haben als die andere. Lilly war bei reichen Verwandten. Sie hatte sicher noch keine Erfahrung mit Männern. Besonders gescheit ist sie auch nicht, aber von uns kann man wohl auch nicht gerade sagen, dass wir Intelligenzler sind. Man muss doch mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Was haben denn schon die Film- oder Schlagerstars für Grips und verdienen trotzdem einen Haufen Geld. Lilly hätte ja auch Fotomodell oder sonst was werden können. Hübsch genug war sie doch dafür. Aber im Grunde war sie ganz bürgerlich, möchte ich meinen. Sie hat sich doch wirklich Mühe gegeben, euch alles recht zu machen.«
»Was weiß ich denn, ob sie damit nicht nur Luis beeindrucken wollte. Immerhin haben wir einen hübschen, modernen Gasthof und einen angesehenen Namen, – und außerdem, wenn sie Luis wirklich so viel bedeutet hätte, würde er doch mal was gesagt haben.«
Schorsch runzelte die Stirn. »Wo er doch genau wusste, dass du ihr nicht grün warst?«, wandte er ein.
»Ich habe sie jedenfalls gut behandelt«, begehrte sie auf. »Luis soll die Fanny heiraten, dann kommt wenigstens eine Mitgift ins Haus.«
»Aus purer Berechnung willst du ihn verkuppeln?«, meinte Schorsch gereizt. »Warum hast du dann nicht den Westl genommen?«
»Weil ich eben dich liebe, du Esel«, erwiderte sie drastisch.
*
Wenn sie glaubten, dass Luis Lilly vergessen hätte, täuschten sie sich sehr. Nachdem alle Versuche, eine Spur von ihr zu finden vergeblich geblieben waren, hatte er sich an die Dierings gewandt. Leichtgefallen war es ihm nicht. Seinen Stolz hatte er schon, der Luis Olberg, und immerhin musste er ja doch damit rechnen, dass Lilly noch andere Chancen hatte.
Ganz sicher würde sie erfahren haben, dass Kovac tot war und sie nichts mehr zu fürchten brauchte. Wäre ihr selbst etwas geschehen, hätte Luis es bestimmt erfahren.
Das Briefeschreiben war noch nie seine Sache gewesen, und so klang das, was er an Martina Diering schrieb, nachdem er ihre Adresse ausfindig gemacht hatte, reichlich unbeholfen und rührend.
Aber eines Tages kam dann die Antwort, die endlich wieder ein Lächeln auf sein verschlossenes Gesicht zauberte.
Margit war wenig erbaut, als er ihr kurz und bündig erklärte, dass er einen Tag verreisen müsse. Es war erstens nur noch eine Woche bis zu ihrer Hochzeit und zum anderen war das Haus augenblicklich voll belegt, weil in der Nähe ein Viehmarkt stattfand.
Ihre Frage, warum er dann verreisen müsse, überhörte er geflissentlich. So blieb sie eigenen Vermutungen überlassen, und diese stimmten sie nicht sehr fröhlich.
Luis Olberg aber fuhr schon in aller Frühe los und schnurstracks nach Sophienlust.
Auf halbem Wege jedoch verließ ihn der Mut. Hatte er nicht doch zu impulsiv gehandelt, fragte er sich. War Lillys Schweigen nicht ein Beweis, dass sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte, dass vor allem er ihr gar nichts bedeutete? Was erwartete er eigentlich?
Sie hatte sich eine neue Aufgabe gesucht und gefunden, wie Martina Diering ihm mitgeteilt hatte. Und sie hatte auch zu sich selbst gefunden, wie sie durchklingen ließ.
Er machte Rast in einer Gastwirtschaft und überlegte bei einem Glas Bier, ob er doch nicht lieber umkehren sollte. Während er noch vor sich hinsann, nahm an einem großen weiß gedeckten Tisch, der schon vorbereitet war, eine Trauergesellschaft Platz.
Wortfetzen erreichten sein Ohr, ohne dass er jedoch aufmerksam wurde, bis sein Blick auf einen Jungen fiel, der sich still beiseite stahl.
Die freundliche junge Bedienung riss ihn aus seinen Gedankengängen. »Grad haben s’ den Professor Rodeck zu Grabe getragen und beginnt schon das Tauziehen um das Vermögen«, meinte sie kopfschüttelnd. »Der arme Bub kann einem wirklich leid tun. Man könnt narrisch werden mit diesen feinen Leuten. Erst bringen s’ die Ehe auseinander und dann – aber Sie sind ja fremd hier. Entschuldigen’s, aber mir läuft bald die Galle über.«
Luis dachte an Lilly und der Sinn der Worte drang gar nicht in sein Bewusstsein. An dem Tisch schien ein Streit zu entbrennen. Er zahlte rasch und ging.
Was soll’s, dachte er, wenn Lilly mir einen Korb gibt, weiß ich wenigstens Bescheid und brauche mich nicht mehr falschen Hoffnungen hinzugeben.
Ganz kopfscheu machte ihn das Mädchen. Sogar seinen Wagen hatte er nicht abgeschlossen und das passierte dem korrekten Luis sonst nie.
Er setzte sich ans Steuer und gab Gas, und schon bald hatte er die Straße nach Sophienlust erreicht. Er dachte nicht mehr an die Trauergesellschaft, die von einem Begräbnis kommend, zu streiten begonnen hatte, weil er mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt war. So merkte er auch nicht, dass sich hinter seinem Rücken etwas tat, was er bei Gott nicht vermuten konnte.
Sein Herz klopfte dumpf, als er vor dem Gutshaus hielt. Aber starr vor Staunen behielt er die Tür in der Hand, als unter dem Rücksitz ein Kopf auftauchte.
»Allmächtiger«, entfuhr es ihm, als flehende Kinderaugen ihn anblickten. »Wo kommst du denn her?«
Die Augen füllten sich mit Tränen. »Papa ist tot«, stammelt der Junge, »und sie waren alle so schrecklich. Ich wollte nur fort. Ich will Ihnen keinen Ärger machen. Sie können mich ruhig zur Polizei bringen. Ich werde dann schon sagen, dass ich nicht zu ihnen will. Zu keinem. Ich will nur zu meiner Mutti.«
Hilflos stand Luis da, so völlig aus der Fassung gebracht, dass er für den Augenblick Lilly vergessen hatte.
»Wie heißt du denn?«, fragte er und versuchte krampfhaft, sich zu erinnern, was die Bedienung in dem Lokal zu ihm gesagt hatte.
»Robin«, erwiderte der Junge, »Robin Rodeck.«
Dann aber weiteten sich seine Augen, als er plötzlich eine ganze Gruppe Kinder gewahrte, die aus dem Hause kam.
»Wo sind wir denn hier?«, fragte er beklommen.
»In Gut Sophienlust«, erwiderte Luis Olberg mit belegter Stimme. »Wenigstens du scheinst im Augenblick am richtigen Ort zu sein.«
*
Michael hatte den Mann erkannt, wie er damals auch sofort Lilly erkannt hatte.
Er mochte Lilly, weil sie so besonders lieb und freundlich mit ihnen war, und er glaubte, ihr einen Gefallen zu tun, wenn er ihr sagte, dass der Mann gekommen war.
Lilly war in der Küche so beschäftigt, dass sie das Auto hatte gar nicht kommen hören. Sie schrak zusammen, als jemand sie am Ärmel zupfte.
»Lilly«, wisperte Michael, »da ist ein Mann, den du kennst. Er war schon mal mit dir hier.«
Lillys Gesicht hatte in den letzten Wochen eine frische Farbe bekommen, aber jetzt wurde es wieder totenblass.
»Nicht der Polizist, der andere«, raunte Michael.
Luis, dachte Lilly und ihr Herz begann stürmisch zu klopfen. Luis war gekommen. Wie hatte er sie gefunden?
»Lilly«, rief da auch schon Frau Rennert, »komm doch bitte mal her.«
»Wenn du ihm jetzt sagst, dass du nicht mit willst, kann er dich doch auch nicht mitnehmen«, stellte Michael flüsternd fest.
Langsam ging Lilly hinaus. Sie sah Luis bei dem Auto stehen und neben ihm den braunhaarigen Jungen. Ihre Gedanken überstürzten sich. Vielleicht war er rein zufällig hier, um ein Kind herzubringen?
Diesen Jungen hatte sie noch nie gesehen.
»Guten Tag, Lilly«, sagte Luis Olberg heiser. »Geht es Ihnen gut?«
»Ja, danke – sehr gut«, stammelte sie.
»Ich wollte mich davon überzeugen«, murmelte er, »aber nun habe ich sogar noch jemanden mitgebracht.«
»Er kann nichts dafür«, erklärte Robin sofort. »Ich habe mich in sein Auto geschlichen. Es war das einzige Auto, das offen war und keinem von diesen Leuten gehörte.«
Verwirrt blickte Lilly von dem Mann zu dem Jungen. Luis sah schrecklich verlegen aus.
»Könnte ich Sie mal eine halbe Stunde sprechen, Lilly?«, fragte er leise. »Oder haben Sie keine Zeit?«
»Natürlich können Sie mit ihr sprechen, Herr Olberg«, stellte Frau Rennert resolut fest. »Und du, kleiner Ausreißer, erzählst mir mal, wie du auf die Idee gekommen bist.«
Robin Rodeck zuckte mit keiner Wimper. Sein schmales Jungengesicht hatte einen sehr entschlossenen Ausdruck, als er Frau Rennert folgte.
»Ist er ausgerückt?«, erkundigte sich Cornelia bei Luis Olberg.
»Das werdet ihr alles nachher erfahren, denke ich«, brummte er.
»Jetzt müsst ihr in die Schule«, mahnte Tammy und warf Lilly ein aufmunterndes Lächeln zu.
»Sie hätten sich ruhig mal melden können«, begann Luis stockend. »Ich fürchtete schon wunder was Ihnen passiert sein könnte.«
»Und wie haben Sie erfahren, dass ich hier bin?«, fragte Lilly leise.
»Als ich mir gar keinen Rat mehr wusste, habe ich an Frau Diering geschrieben, und sie hat es mir mitgeteilt. Aber vielleicht sind Sie hier so glücklich, dass Sie gar nicht mehr wegwollen. – Meine Güte, ich kann halt nicht so schöne Worte machen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht doch wieder zu uns kommen möchten.«
»Weiß Ihre Schwester, dass Sie hier sind?«, fragte Lilly leise.
»Margit und Schorsch heiraten nächste Woche«, erwiderte er ausweichend. »Ich weiß ja nicht recht, wie ich es sagen soll, Lilly, aber vielleicht sind Sie inzwischen schon zu der Überzeugung gekommen, dass nicht alle Männer Lumpen sind. Ich mag Sie nämlich sehr. Ich habe mich schrecklich um Sie gesorgt.«
Die schlichten Worte trieben ihr die Tränen in die Augen. Er wusste alles von ihr und hatte sie trotzdem gern. Und wie lieb sie ihn hatte, wusste sie schon lange.
»Sie waren sehr gut zu mir hier in Sophienlust«, sagte sie stockend. »Und ich wusste nicht, ob Sie überhaupt noch an mich dachten und ich habe mich doch so geschämt.«
»Davon müssen wir doch nicht immer reden«, brummte er. »Sie wissen ja, wie es bei uns ist. Können Sie sich vorstellen, mich zu heiraten, Lilly?«
Dunkle Glut schoss ihr in die Wangen. »Haben Sie sich das richtig überlegt, Luis?«, stotterte sie.
»Ich schon, Tag und Nacht. – Du hast mir mächtig gefehlt, Mädchen.« Seine Hände streckten sich nach ihr aus und ganz behutsam zog er sie an sich, als er in ihren Augen ein sehnsuchtsvolles Leuchten sah.
»Oh, Luis«, flüsterte Lilly, »gibt es das wirklich? Wirst du es auch nie bereuen?«
Er schüttelte den Kopf. »Wenn ich mir mal was vorgenommen habe, setze ich es auch durch«, sagte er. »Wenigstens gebe ich nicht so rasch auf. Ich hatte nur Angst, dass du nein sagen würdest.«
Sie sagte nicht nein. Mit einem unterdrückten Schluchzen bot sie ihm ihren Mund zu einem langen Kuss, der ein dankbares Versprechen war.
Erst am späten Nachmittag verließen Luis Olberg und Lilly Sophienlust. Luis hatte ein langes Telefongespräch mit seiner Schwester geführt, das zu seiner vollen Zufriedenheit geendet hatte.
»Dein Zimmer wartet schon auf dich, Lilly«, meinte er schmunzelnd. »An Margits Hochzeitstag werden wir Verlobung feiern und mit unserer Heirat werden wir auch nicht lange warten, denke ich.«
Dann hatten sie noch lange mit Denise von Schoenecker gesprochen, aber bei diesem Gespräch ging es auch um Robin Rodeck.
Die Kinder winkten ihnen nach, als sie davonfuhren. Tammy hatte ihnen rasch erklärt, dass es ein ganz großes Glück für Lilly sei, einen solchen Mann zu bekommen.
Und sie hatten ja nun schon wieder etwas, worüber sie sich den Kopf zerbrechen konnten.
»Ein Problem hätten wir wieder einmal zur Zufriedenheit aller Beteiligten bewältigt«, meinte Denise von Schoenecker mit einem nachdenklichen Lächeln. »Aber ein anderes haben wir nun wieder neu unter unserem Dach. Was können wir für Robin tun?«
Sie warf ihrem Mann einen langen Blick zu. »Es wird ein sehr schwieriges Problem werden, mein Liebes«, stellte er fest.
»Kommt Zeit, kommt Rat«, meinte Frau Rennert.
»Aber vorher wahrscheinlich eine geldgierige Verwandtschaft, für die der Junge nur ein Objekt ist.« Alexander von Schoenecker sah es ganz nüchtern.
»Wozu haben wir Onkel Lutz?«, äußerte sich Dominik. »Er ist doch ein prima Rechtsanwalt.«
»Köpfchen hat er schon, unser Sohn«, äußerte sich Alexander von Schoenecker stolz.
»Nun, dann wollen wir mal sehen, was uns die Zukunft beschert«, nickte Denise. »Wir sind ja allerlei gewöhnt.«
»Morgen kommen die Fellmanns«, schweifte Dominik ab. »Nele und Michael wollen aber noch bleiben. Vielleicht sollten wir ihren Eltern lieber sagen, dass sie noch gar nicht so brav sind?«
»Nun, vielleicht können sie auch noch bleiben, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen«, meinte Denise.
»Ich hab’s nämlich gar nicht gern, wenn man sich schon wieder trennen muss, wenn man sich gerade so gut versteht«, murmelte Dominik. Und darin pflichteten ihm auch Sascha und Andrea bei.