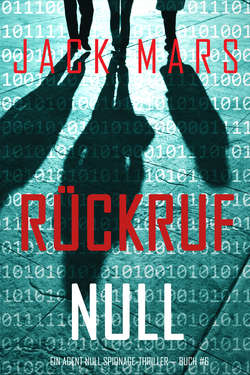Читать книгу Rückruf Null - Джек Марс - Страница 12
KAPITEL FÜNF
ОглавлениеSara inspizierte sich im Badezimmerspiegel, während sie ihren Zopf zurechtzog. Sie hasste ihr Haar. Es war zu lang, sie hatte es seit Monaten nicht mehr schneiden lassen. Die Spitzen waren gespalten. Etwa sechs Wochen zuvor hatte sie es Camilla mit einer Tönung aus der Drogerie rot färben lassen. Auch wenn es ihr damals gefiel, so sah man jetzt ihre hellblonden Wurzeln, die sich an den ersten Zentimetern zeigten. Das sah einfach nicht gut aus.
Sie hasste das dunkelblaue Poloshirt, das sie zur Arbeit tragen musste. Es war ihre eine Nummer zu groß und auf der linken Brust stand “Swift Thrift”. Die Buchstaben waren ausgeblichen, die Ecken vom vielen Waschen zerfranst.
Sie hasste ihre Arbeit beim Secondhandladen, wo es ständig nach Mottenkugeln und abgestandenem Schweiß roch und sie vorgeben musste, nett zu unhöflichen Kunden zu sein. Sie hasste es, dass sie als Sechzehnjährige ohne High School Abschluss nicht mehr als neun Dollar die Stunde verdienen konnte.
Doch sie hatte eine Entscheidung getroffen. Sie war fast unabhängig.
Die Badezimmertür ging plötzlich auf, wurde von der anderen Seite aufgestoßen. Tommy hielt inne, als er sie vor dem Spiegel stehen sah.
„Was zum Teufel, Tommy!” rief Sara. „Ich bin hier drin!”
„Warum hast du die Tür nicht abgeschlossen?” erwiderte er.
„Sie war doch zu, oder nicht?”
„Beeil dich! Ich muss pinkeln!”
„Raus jetzt!” Sie drückte die Tür zu und ließ den älteren Jungen hinter ihr fluchen. Das Leben in einer Wohngemeinschaft war alles andere als glamourös, doch sie hatte sich in dem letzten Jahr, seit sie hier wohnte, daran gewöhnt. Oder war es schon länger? Dreizehn Monate oder so, berechnete sie.
Sie legte etwas Wimperntusche auf und inspizierte sich erneut. Das reicht, dachte sie. Trotz Camillas Bemühungen trug sie nicht gerne viel Makeup. Und außerdem wuchs sie immer noch.
Sie ging gerade rechtzeitig aus dem Bad, das zur Küche hinaus öffnete, um zu sehen, wie Tommy sich von der Spüle abwandte und seinen Hosenstall zumachte.
„Oh Gott”, zuckte sie zusammen, „bitte sag mir, dass du nicht gerade in die Spüle gepinkelt hast.”
„Du hast zu lange gebraucht.”
„Gott, du bist widerlich.” Sie ging auf den alten beigen Kühlschrank zu und nahm eine Flasche Wasser heraus - ganz sicher tränke sie jetzt kein Leitungswasser, so viel stand fest - und als sie ihn wieder schloss, bemerkte sie die Tafel.
Sie zuckte erneut zusammen.
An der Kühlschranktür hing eine magnetische Tafel mit sechs Namen in schwarzer Schrift, alle Mitbewohner. Unter jedem Namen stand eine Nummer. Alle sechs waren für einen Teil der Miete verantwortlich und teilten sich auch die Rechnungen monatlich. Konnten sie ihren Teil nicht zahlen, dann hatten sie drei Monate Zeit, um ihre Schulden zu tilgen, sonst mussten sie ausziehen. Die Nummer unter Saras Namen war die größte.
Die Wohngemeinschaft war wirklich nicht der schlimmste Ort in Jacksonville. Das alte Haus brauchte ein paar Reparaturen, doch es war kein Desaster. Es gab vier Schlafzimmer, drei von ihnen waren von jeweils zwei Personen bewohnt und das vierte wurde als Aufbewahrungs- und Arbeitszimmer benutzt.
Ihr Vermieter, Mr. Nedelmeyer, war ein deutscher Typ, Anfang vierzig, der mehrere Immobilien wie diese in der Jacksonville Innenstadt besaß. Er war ziemlich entspannt, wenn man es sich genau überlegte. Er bestand sogar darauf, dass sie ihn einfach ,Nadel’ nannten, was in Saras Ohren wie ein Name für einen Drogenhändler klang. Doch mit Nadel konnte man einfach umgehen. Es war ihm egal, ob Freunde über Nacht blieben oder ob sie hin und wieder eine Party veranstalteten. Drogen waren ihm egal. Er hatte nur drei Hauptregeln: wirst du verhaftet, dann fliegst du raus. Kannst du nach drei Monaten nicht bezahlen, dann fliegst du raus. Greifst du einen Mitbewohner an, dann bist du draußen.
Während sie da auf die Tafel am Kühlschrank starrte, machte Sara sich um die zweite Regel Sorgen. Doch dann hörte sie eine Stimme in ihrem Ohr, die sie über Regel drei beunruhigte.
„Was ist denn los kleines Mädchen? Hast du Angst wegen der großen Nummer da unter deinem Namen?” Tommy lachte, als ob er einen tollen Witz erzählt hätte. Er war neunzehn, schlaksig und knöchern und hatte auf beiden Armen Tätowierungen. Er und seine Freundin Jo teilten sich eines der Schlafzimmer. Keiner von ihnen arbeitete. Tommys Eltern schickten ihm jeden Monat Geld, mehr als genug, um ihre Ausgaben in der Wohngemeinschaft zu decken. Den Rest gaben sie für Kokain aus.
Tommy hielt sich für einen knallharten Typen. Doch er war nur ein Vorstadtkind in den Ferien.
Sara drehte sich langsam um. Der ältere Junge war fast dreißig Zentimeter größer als sie und stand nur ein paar Zentimeter von ihr entfernt. „Ich glaube”, sagte sie langsam, „du solltest ein paar Zentimeter zurücktreten.”
„Ansonsten?” grinste er bösartig. „Willst du mich schlagen?”
„Natürlich nicht. Das wäre gegen die Regeln.” Sie lächelte unschuldig. „Aber weißt du, kürzlich nahm ich ein kleines Video auf. Du und Jo, wie ihr Kokain vom Kaffeetisch geschnupft habt.”
Ein verängstigter Blick huschte über Tommys Gesicht, doch er blieb hart. „Na und? Nadel ist das egal.”
„Das hast du recht, ihm ist das egal.” Sara flüsterte weiter. „Aber Thomas Howell, der bei Binder & Associates arbeitet? Dem ist das vielleicht nicht egal.” Sie lehnte ihren Kopf zur Seite. „Das ist dein Papa, stimmt’s?”
„Woher...?” Tommy schüttelte seinen Kopf. „Das würdest du nicht wagen.”
„Vielleicht nicht. Liegt ganz an dir.” Sie ging an ihm vorbei, rempelte ihn rau mit ihrer Schulter dabei an. „Hör auf, in die Spüle zu pinkeln. Das ist widerlich.” Dann ging sie nach oben.
Sara hatte Virginia mehr als ein Jahr zuvor als eine verängstigte, naive Fünfzehnjährige verlassen. Nur wenig mehr als ein Jahr war vergangen, doch sie hatte sich verändert. Im Bus von Alexandria nach Jacksonville hatte sie sich zwei Regeln auferlegt. Die erste Regel besagte, dass sie niemanden um nichts bitten würde, am wenigsten ihren Vater. Und sie hielt sich daran. Maya half ihr hin und wieder ein wenig aus und Sara war dankbar - doch sie bat nie darum.
Die zweite Regel bestand darin, dass sie sich von niemandem etwas sagen ließe. Sie hatte schon zu viel mitgemacht. Sie hatte Dinge gesehen, über die sie niemals sprechen könnte. Dinge, die sie Nachts immer noch nicht schlafen ließen. Dinge, die sich ein Typ wie Tommy niemals vorstellen könnte. Sie war nicht wie andere Teenager, voller Angst. Sie hatte ihre eigene Vergangenheit überwunden.
Oben angelangt öffnete sie die Tür zum Schlafzimmer, das sie und Camilla teilten. Es war wie ein Zimmer im Studentenwohnheim eingerichtet: zwei Doppelbetten, die an entgegengesetzten Wänden standen, mit einem Gang und einem geteilten Nachttisch dazwischen. Sie hatten eine kleine Kommode und einen Schrank, den sie ebenfalls teilten. Ihre Mitbewohnerin lag noch im Bett. Sie lag wach auf dem Rücken und scrollte durch die sozialen Netzwerke auf ihrem Handy.
„Hey”, gähnte sie, als Sara eintrat. Camilla war achtzehn und zum Glück sehr angenehm. Sie war die erste Freundin, die Sara in Florida gewann. Es war ihre Internetanzeige für eine Mitbewohnerin, die Sara überhaupt hierher gebracht hatte. Sie verstanden sich gut. Camilla brachte ihr sogar bei, zu fahren. Sie brachte ihr bei, wie man Wimperntusche auflegte und welche Kleidung ihrem schmalen Körper gut stand. Sara hatte eine Menge neues Vokabular und Angewohnheiten von ihr gelernt. Fast wie eine große Schwester.
Fast wie eine große Schwester, die dich nicht mit einem Mann alleine lässt, den du nicht aushältst.
„Hey du. Steh auf, es ist schon fast zehn.” Sara nahm ihre Handtasche vom Nachttisch und schaute nach, ob sie alles hatte, was sie brauchte.
„Es wurde gestern Nacht bei mir spät.” Camilla arbeitete als Bedienung und Barkeeper bei einem Fischrestaurant. „Aber schau mal, ich hab das Bündel hier bekommen.” Sie zeigte ihr ein dickes Bündel Bargeld, das Trinkgeld der letzten Nacht.
„Toll”, murmelte Sarah, „ich muss zur Arbeit.”
„Cool. Ich habe heute Abend frei. Soll ich dir wieder das Haar machen? Sieht ein bisschen zerzaust aus.”
„Ja, ich weiß, sieht Scheiße aus”, erwiderte Sara verärgert.
„Aua, feindlich.” Camilla zog die Stirn in Falten. „Wer hat dir denn die Laune versauert?”
„Tut mir leid. War nur Tommy, der sich wie ein Esel benimmt.”
„Vergiss den Typen. Das ist doch ein Angeber.”
„Ich weiß”, seufzte Sara und rieb sich über ihr Gesicht. „OK. Ich gehe zur Maloche.”
„Wart mal. Du bist ganz schön nervös. Willst du ein Pillchen?”
Sara schüttelte ihren Kopf. „Nein, ist schon in Ordnung.” Sie ging zwei Schritte auf die Tür zu. „Scheiß drauf, her damit.”
Camilla grinste und setzte sich im Bett auf. Sie griff nach ihrer eigenen Tasche und zog zwei Dinge heraus - eine orangefarbene Rezeptflasche ohne Etikette und einen kleinen Plastikzylinder mit einer roten Kappe. Sie schüttelte eine längliche, blaue Xanax aus der Flasche, ließ sie in die Tablettenmühle fallen, drehte die rote Kappe fest zu und zerdrückte dabei die Tablette zu Pulver. „Hand her.”
Sara streckte ihre rechte Hand aus, mit der Innenfläche nach unten, und Camilla schüttelte das Puder auf die fleischige Brücke zwischen ihrem Daumen und Zeigefinger. Sara hielt ihre Hand an ihr Gesicht, verschloss ein Nasenloch und schniefte.
„Gutes Mädchen.” Camilla schlug ihr sanft auf den Hintern. „Jetzt aber raus hier, bevor du noch zu spät kommst. Bis heute Abend.”
Sara machte das Friedenszeichen, als sie die Tür hinter sich schloss. Sie konnte das bittere Puder in ihrer Kehle schmecken. Es dauerte nicht lang, bis es wirkte, doch sie wusste, dass eine Tablette sie kaum durch den halben Tag brächte.
Draußen war es selbst für Oktober noch sehr heiß, so wie die Spätsommer, die sie manchmal in Virginia hatten. Doch sie gewöhnte sich an das Wetter. Sie mochte den Sonnenschein, der fast das ganze Jahr währte, es gefiel ihr, so nah am Strand zu sein. Das Leben war nicht immer toll, doch es war viel besser, als es vor zwei Sommern war.
Sara war kaum aus der Tür, als ihr Handy in ihrer Tasche klingelte. Sie wusste schon, wer es war, eine der wenigen Personen, die sie überhaupt anrief.
„Hi!” antwortete sie, während sie lief.
„Hallo.” Mayas Stimme klang leise, angestrengt. Sara bemerkte gleich, dass es ihr wegen irgendetwas nicht gut ging. „Hast du eine Minute Zeit?”
„Äh, ein paar. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit.” Sara blickte um sich. Sie lebte in keinem schlechten Viertel, doch es wurde ein wenig rauer, als sie sich dem Secondhandladen annäherte. Sie hatte niemals selbst ein Problem gehabt, doch sie achtete immer aufmerksam auf ihr Umfeld und hielt den Kopf beim Gehen erhoben. Ein Mädchen, das durch ihr Telefon abgelenkt war, konnte ein mögliches Ziel sein. „Was gibt’s?”
„Ich, äh...” Maya zögerte. Es war sehr ungewöhnlich, dass sie verdrossen war und sich zögerlich verhielt. „Ich habe gestern Abend Papa gesehen.”
Sara hielt an, aber sagte nichts. Ihr Magen zog sich instinktiv zusammen, als ob sie sich auf einen Schlag vorbereitete.
„Es... lief nicht gut.” Maya seufzte. „Ich habe ihn zum Schluss angeschrien und bin rausgerannt -”
„Warum erzählst du mir das?” wollte Sara wissen.
„Was?”
„Du weißt, dass ich ihn nicht sehen will. Dass ich nichts von ihm hören will. Ich will nicht mal an ihn denken. Also warum erzählst du mir das?”
„Ich dachte, du wolltest es vielleicht wissen.”
„Nein”, sagte Sara nachdrücklich. „Du hattest eine schlechte Erfahrung und du willst mit jemandem darüber sprechen, von dem du annimmst, dass er dich versteht. Es interessiert mich nicht. Ich bin mit dem durch. OK?”
„Ja”, seufzte Maya. „Ich glaube, ich auch.”
Sara zögerte einen Moment. Sie hatte ihre Schwester nie so geschlagen gehört. Doch sie beharrte auf ihrer Position. „Gut. Mach mit deinem Leben weiter. Wie läuft es in der Akademie?”
„Da läuft’s super”, antwortete Maya, „ich bin die Klassenbeste.”
„Natürlich bist du das. Du bist brillant.” Sara lächelte, als sie weiterging. Doch gleichzeitig bemerkte sie Bewegung auf dem Bürgersteig in der Nähe ihrer Füße. Ein Schatten, der sich lang in der Morgensonne hinzog, hielt mit ihr Schritt. Jemand lief nicht weit hinter ihr.
Du bist paranoid. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie einen Fußgänger für einen Verfolger hielt. Es war eine bedauerliche Nachfolge ihrer Erlebnisse. Trotzdem ging sie langsamer, als sie sich der nächsten Kreuzung annäherte, um die Straße zu überqueren.
„Aber ernsthaft”, sagte Maya durch das Telefon. „Geht es dir gut?”
„Oh, ja.” Sara hielt inne und wartete auf die Ampel. Der Schatten tat das gleiche. „Mir geht’s gut.” Sie hätte sich umdrehen können, um ihn anzusehen, ihn wissen lassen, dass sie es bemerkt hatte, doch sie hielt ihre Augen nach vorn gerichtet und wartete, bis die Ampel auf grün schaltete, um herauszufinden, ob er folgen würde.
„Gut. Das freut mich. Ich versuche, dir in den nächsten Wochen was zu schicken.”
„Das musst du nicht tun”, sagte ihr Sara. Dann schaltete die Ampel um. Sie ging schnell über die Straße.
„Ich weiß, dass ich das nicht muss. Ich will es. Also, ich lasse dich jetzt zur Arbeit gehen.”
Ich habe morgen frei.” Sara erreichte die andere Straßenseite und ging weiter. Der Schatten hielt mit ihr mit. „Sprechen wir dann?”
„Unbedingt. Hab dich lieb.”
„Ich dich auch.” Sara legte auf und steckte das Handy wieder in ihre Tasche. Dann bog sie ohne Vorwarnung abrupt nach links ab und joggte ein paar Schritte, nur um aus seinem Blickfeld zu gelangen. Sie drehte sich um, verschränkte ihre Arme vor ihrer Brust und legte einen ernsthaften Gesichtsausdruck auf, als ihr Verfolger hinter ihr um die Ecke kam.
Er rutschte fast zum Halt, als er sah, wie sie da stand und auf ihn wartete.
„Für einen angeblichen Geheimagenten machst du das wirklich beschissen”, sagte sie ihm. „Ich rieche dein Aftershave.”
Agent Todd Strickland grinste. „Schön dich zu sehen, Sara.”
Sie erwiderte nicht sein Lächeln. „Kontrollierst mich immer noch, wie ich bemerke.”
„Was? Nein. Ich war nur in der Gegend, auf einem Einsatz.” Er zuckte mit den Schultern. „Ich sah dich auf der Straße, da wollte ich Hallo sagen.”
„Aha”, entgegnete sie ausdruckslos. „Wenn das so ist, dann Hallo. Jetzt muss ich zur Arbeit. Tschüss.” Sie wandte sich um und ging hastig weiter.
„Ich laufe mit dir.” Er joggte, um mit ihr Schritt zu halten.
Sie schnaubte verächtlich. Strickland war für einen CIA Agenten jung, noch nicht einmal dreißig - doch er erinnerte sie auch zu sehr an ihren Vater. Die beiden waren Freunde, schon seit fast zwei Jahren, als Sara und ihre Schwester von den slowakischen Menschenhändlern entführt worden waren. Strickland hatte geholfen, sie zu retten und seitdem hatte er versprochen, dass, egal was geschah, er alles täte, damit die beiden Mädchen in Sicherheit wären.
Anscheinend bedeutete das, CIA Taktiken anzuwenden, um sich über Saras Aufenthaltsort zu informieren.
„Dir geht’s also gut?” fragte er sie.
„Ja. Super. Jetzt geh weg.”
Doch er ging weiter neben ihr her. „Nervt der Typ in deinem Haus dich weiter?”
„Oh Gott”, stöhnte sie. „Was, hast du das Haus verwanzt?”
„Ich will doch nur sicherstellen, dass es dir gut geht -”
Sie wandte sich zu ihm um. „Du bist nicht mein Vater. Wir sind nicht mal befreundet. Vor langer Zeit, da warst du vielleicht ein... ich weiß nicht. Ein glorifizierter Babysitter. Aber jetzt erscheinst du mehr wie ein verdammter Stalker.” Sie hatte gewusst, dass er sie schon seit einiger Zeit verfolgte. Dies war nicht das erste Mal, dass er plötzlich in Florida auftauchte. „Ich will dich nicht hier. Ich will nicht an dieses Leben erinnert werden. Wie wär’s, wenn du mir einfach sagst, was du von mir willst, und dann können wir wieder getrennte Wege gehen?”
Strickland reagierte kaum auf den Ausbruch. „Ich will, dass du in Sicherheit bist”, sagte er ruhig. „Und wenn ich ehrlich bin, dann will ich, dass du mit den Drogen aufhörst.”
Saras Augen verengten sich und ihr Mund fiel ihr ein wenig auf. „Was glaubst du eigentlich, wer du bist?”
„Jemand, der sich kümmert. Wenn dein Vater das wüsste, bräche es ihm das Herz.”
Wenn er es wüsste? „Oh, du meinst, du überbringst ihm keine wöchentlichen Berichte?”
Strickland schüttelte seinen Kopf. „Habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen.”
„Du verfolgst mich also nur aus einem unangebrachten Pflichtgefühl?”
Der junge Agent lächelte traurig und schüttelte seinen Kopf. „Ob es dir gefällt oder nicht, es gibt immer noch eine Menge Leute, die sich an Agent Null erinnern. Ich hoffe, dass es niemals dazu kommt, dass du mir dankst, dass ich auf dich aufpasse. Doch bis dahin werde ich es weiter tun.”
„Ja, das kann ich mir vorstellen.” Sie blickte direkt nach oben, blinzelte in den hellen Himmel. „Was ist es, ein Satellit? Überwachst du mich so?” Sara streckte eine Hand über ihren Kopf und zeigte den Wolken ihren Mittelfinger. „Hier ist ein Foto für dich. Schick es meinem Vater als Weihnachtskarte.” Dann drehte sie sich um und begann, zu gehen.
„Sara”, rief er hinter ihr her. „Die Drogen?”
Verdammt, warum haut der nicht ab? Sie wandte sich an. „Ich hab ein bisschen Gras geraucht. Was macht das schon? Ist praktisch legal hier.”
„Aha. Und das Xanax?”
Das Xanax. Ihre erste Frage war, wie wusste er darüber Bescheid? Die zweite, die ihr durch den Kopf ging, warum funktionierte es noch nicht? Doch sie kannte die Antwort auf die Letztere schon. Ihr Körper hatte sich zu sehr an eine Tablette gewöhnt. Sie reichte nicht mehr aus.
„Und das Kokain?”
Dann lachte sie ihn aus, ein bitteres, beißendes Lachen. „Hör auf damit. Versuche nicht, mich dazu zu bringen, mich wie eine kriminelle Gestörte zu fühlen, nur weil ich etwas ein oder zwei Mal auf einer Party ausprobiert habe.”
„Ein oder zwei Mal, was? Habt ihr diese Partys jede Nacht?”
Sara spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde. Nicht nur, weil er sie beleidigt hatte, sondern weil er recht hatte. Es hatte mit ein oder zwei Mal auf einer Party angefangen doch wurde schnell zu einer Angewohnheit nach der Arbeit. Etwas Kleines, um die Nerven zu beruhigen. Aber das würde sie jetzt nicht zugeben.
„Für dich muss es so einfach sein” , sagte sie. „Du stehst da, ein sauberer Pfadfinder, Army Ranger. CIA Agent. Es muss dir so leicht fallen, über jemanden wie mich zu urteilen. Du sagst, dass du weißt, was ich durchgemacht habe. Doch du verstehst es nicht. Du kannst es nicht.”
Strickland nickte langsam. Er starrte sie direkt mit diesen Augen an, die sie vielleicht charmant gefunden hätte, wenn es jemand anderes als er gewesen wäre. „Ja, ich schätze, du hast recht. Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, mit siebzehn emanzipiert zu sein -”
„Ich war fünfzehn”, berichtigte ihn Sara.
„Und ich war siebzehn. Aber das wusstest du nicht von mir, oder?”
Sie wusste es nicht. Doch sie gab ihm nicht die Gunst einer Reaktion.
„Ich bin direkt zur Army gegangen. Viele Staaten erlauben das. Zwei Tage vor meinem achtzehnten Geburtstag tötete ich zum ersten Mal jemanden. Das ist das Komische am Militär. Die nennen es nicht ,Mord’, wenn du jemanden umbringst.”
Sara biss sich auf die Lippe. Sie wusste, wie es war, jemanden zu töten. Es war ein Söldner mit dem geheimen Einsatzteam, das sich die Division nannte. Er hätte sie getötet, sie und ihre Schwester, also schoss Sara ihn in den Hals. Und obwohl die Alpträume sie immer noch plagten, hatte sie es niemals als einen Mord bezeichnet.
„Es gab eine Zeit, während der ich vier verschiedene Medikamente einnahm”, erzählte Strickland ihr. „Für PTBS. Angstzustände. Depressionen. Ich habe alle überdosiert. Es war so viel einfacher, taub zu sein, vorzugeben, dass alles was ich tat, jemand anderem geschah.”