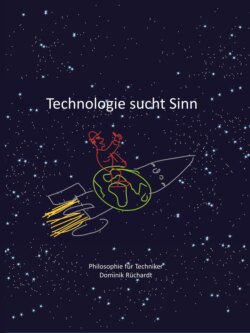Читать книгу Technologie sucht Sinn - Dominik Rüchardt - Страница 8
Erkenntnis
ОглавлениеDie Schöpfungsgeschichte und die Erkenntnis
Nicht umsonst ist der Biblische Sündenfall, aufgrund dessen Adam und Eva aus dem Paradies geworfen wurden, der Wunsch nach Erkenntnis. Das paradiesische Leben war frei davon, es war vielmehr ein einfaches Hinnehmen dessen, was ist. Adam hätte das wohl genügt, doch Eva wollte nicht leben wie die Tiere, sie wollte mehr.
Die Fähigkeit zur Erkenntnis hat die Menschheit in tiefste Zweifel gestürzt, zu wüstesten Utopien geführt, Arroganz und Streit ausgelöst und Unterdrückung begründet. Andererseits ist sie der Kern von Kreativität und Fortschritt, von schöpferischem Denken und Weisheit.
Wahrnehmung der Wahrheit?
Die große Frage ist, ob Wahrgenommenes wahr ist. Oder natürlich, ob Wahrheit überhaupt existiert. Und wenn, wie sie erkannt wird. Das ist immer eine große Streitfrage gewesen.
Ein Kernproblem ist die Tatsache, dass Wahrnehmung ja immer subjektiv ist, also das Objekt der Wahrnehmung mit eingeschränkten Mitteln betrachtet.
Die Frage, ob ein Ding ein Ding ist, oder erst durch die Benennung zum Ding wird, oder gar erst durch die Betrachtung, spielt dabei eine zentrale Bedeutung. Sie scheint müßig zu sein, andererseits lehrt uns die Quantenmechanik das Gegenteil. Auf die Idee, dass ein Teilchen seinen Zustand erst durch die Beobachtung bekommt, wäre Heisenberg ohne die Denkschule der Philosophie möglicherweise gar nicht erst gekommen.
Die Philosophen der Antike haben sich in dem, was sie Erkenntnis nannten, gerne auf die reine Theorie zurückgezogen und die sinnliche Wahrnehmung (sehen, hören, fühlen etc., auch alles messbare) stets als ungenau herabgestuft, womit sie im Prinzip recht hatten. Platos Ideenlehre verfolgte genau diesen Ansatz.
Auch Jahrtausende später sagt John Locke (1632-1704) beispielsweise: „Unser Wissen ist nur insofern ein reales, als zwischen unseren Ideen und der Realität der Dinge Übereinstimmung herrscht.“
René Descartes gibt mit „Ich denke, also bin ich“ ein Erkenntnispostulat. Die Erkenntnis des eigenen Seins begründet sich aus genau diesem. Über die Existenz der Anderen sagt es allerdings nichts aus.
Die Erkenntnistheorie unterscheidet dabei zwischen dem „Idealismus“ und dem „Empirismus“. Man kann es ein wenig sehen wie theoretische und experimentelle Physik. Die Experimentelle erzeugt Ergebnisse, die dazugehörige physikalische Lehre entsteht aber erst aus der Theorie, wenn die Ergebnisse in formale Modelle überführt sind, die aus sich heraus stimmig sind. Ohne diesen theoretischen Unterbau ist das Experiment nichts als ein nettes Spiel.
Hier wird aber auch deutlich, dass die Wahrheit, die durch die Erkenntnis entsteht, immer abhängig ist von dem Theoriemodell, in dem sie erzeugt wird. Fällt das weg, ist auch die Wahrheit weg. Lange Zeit hat sich die Geschichte dafür mit der „Demonstrativen Erkenntnis“ beholfen: der göttlichen Wahrheit. Letztendlich ist das aber auch nichts anderes als eine nicht hinterfragte Hypothese. In der Mathematik würde man sagen, ein Axiom.
Erkennen ist ein schöpferischer Akt
Wer einmal im Alten Testament geblättert hat, erinnert sich an die häufige Formulierung, Jemand ‚erkannte sein Weib‘. Sie meinten damit: sie erkannten, dass sie zusammen gehören und dass daraus etwas Neues entsteht. Es ist ein schönes Bild. Erkenntnis ist wie die Liebe: sie kommt aus dem Nichts und verändert alles.
Erkenntnis unterscheidet sich nämlich grundsätzlich von „Lernen“ oder auch von „Erfahren“. Erkenntnis ist vielmehr ein rein geistiger Prozess, der das Verständnis der Welt um etwas vorher nicht Dagewesenes erweitert.
Diese Definition ist natürlich insofern heikel, als sie eine persönliche ist. Meine Erkenntnis kann jemand anderes bereits gehabt haben, für mich bleibt sie dennoch Erkenntnis. Diese Unterscheidung betrifft aber nicht die Frage der Erkenntnis an sich, sondern eher die von der Eindeutigkeit des Universums.
Karl Marx machte Erkenntnis zu etwas Mächtigem
Die meiner Ansicht wichtigste Erkenntnis zur Erkenntnis hatte Karl Marx mit dem dialektischen Materialismus.
Bis dahin erzeugte Erkenntnis mehr oder weniger ein tieferes Verständnis der Ordnung der Welt, die aber war von Gott gegeben und unveränderlich.
Marx erklärte: Durch den Akt der Erkenntnis verändert sich die Welt. Denn die Erkenntnis führt zu einer Einflussnahme, die die Zustände verändert.
Revolution und Verantwortung
Das war Revolution. In mehrerlei Hinsicht. Plötzlich konnten Ordnungen aufgebrochen werden, die Welt war gestaltbar und der Mensch ihr Architekt. Das Experiment des Sozialismus als völlig neue Gesellschaftsordnung nahm hier seinen Ausgang. Mit allen Folgen. Ebenso etliche weitere Experimente, die eine neue Weltordnung erzeugen wollten.
Andererseits ist es Verantwortung. Marx dialektischer Materialismus ist es, der uns klar macht, dass wir für unser Handeln selbst verantwortlich sind. Im Sinne der Umwelt, im Sinne der sozialen Auswirkungen unseres Tuns, im Sinne der Auswirkungen auf Leib und Leben anderer.
Marx‘ Erkenntnis war ebenso mächtig wie unbequem. In doppeltem Sinn ein Problem für die die damalige Gesellschaft. Aus heutiger Sicht hatte er in dieser Frage allerdings recht.
Das ist wiederum wichtig für den Berufstand der Techniker, die gerade heute so viel Einfluss auf das Geschehen haben. Die sich andererseits aufgrund ihrer Ausbildung und Neigung meist wenig und wenn dann eher ablehnend mit dem dialektischen Materialismus befassen.
Moral und Entscheidung: Richtig und Falsch
Aus der Sicht des Krokodils ist es richtig, den Menschen zu fressen. Ist es dann richtig, dass das Krokodil existiert? Wenn es nicht richtig ist, warum existiert es dann? Kann etwas Falsches existieren?
Die Entscheidung ist die Bürde des menschlichen Lebens
Die Entscheidung zwischen Richtig und Falsch ist ein urmenschliches Dilemma. Unmittelbar nachdem sie Zugang zu Erkenntnis hatten, sahen sich Adam und Eva mit dieser Frage konfrontiert: „Und sie erkannten, dass sie nackt waren“ bedeutet: Sie erkannten, dass sie auf sich alleine gestellt sind. In allen Entscheidungen. Die Scham überkam sie und sie bedeckten sich – um den Umstand ihrer Zweifel zu verbergen.
In der Tat ist die absolute Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch nicht möglich. Es würde auch kein Tier auf die Idee kommen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Es würde je nach Situation handeln, getrieben von einem Motiv, das da heißt: Hunger, Überleben, Vermehren, … . Es reagiert.
Das Naturrecht sagt: Richtig ist, was möglich ist
Das Tier handelt im Sinne der Philosophie nach dem Naturrecht. Das sagt nichts anderes, als dass es rechtens ist, wenn die einen die andern fressen, weil sie es können. Das Naturrecht gilt zwischen Tieren und zwischen Staaten. Zwischen den Staaten wird es heutzutage durch Verträge eingeschränkt, das Völkerrecht. Das sind, mit den Vereinten Nationen und Einrichtungen wie dem internationalen Strafgerichtshof, allerdings erst Erscheinungen der neuesten Zeit.
Das Tier reagiert, der Mensch agiert
Der Mensch agiert. Er handelt, er macht sich zum Herrscher über andere, zum Richter. Ab diesem Moment ändert sich die Situation schlagartig, denn er erhebt sich über das Naturrecht, erhebt Anspruch auf eine höhere Ordnung und muss in dieser Recht sprechen.
Ethik, Moral und der gesunde Menschenverstand
Dieses Recht leitet sich also aus der Ordnung ab. Nur wer sagt, welche Ordnung gilt? Wer legt sie fest? Was ist mit Fragen, die die Ordnung nicht bedacht hat? Hier kommen Ethik und Moral ins Spiel. Schwierige Begriffe, die immer im Spanungsfeld zwischen guter Lebensführung und Macht gelitten haben.
Lange Zeit leiteten die Menschen die Ordnung von Gott ab. „In Gottes Namen“ zu sprechen brauchte keine weitere Begründung. Der „Gesunde Menschenverstand“ rückte später an diese Stelle, nur ist auch der großzügig interpretierbar, meistens im Sinne dessen, der schneller spricht. Andere nutzen Ideologien. Sozialismus, Kapitalismus, Liberalismus. Was geschieht, wenn wir ‚den freien Kräften des Marktes‘ die Entscheidung zwischen Richtig und Falsch überlassen, können wir derzeit selbst erfahren.
Der Kategorische Imperativ
Kant’s Satz „Jeder soll sein Verhalten danach ausrichten, dass es Grundlage der allgemeinen Rechtsprechung sein könnte“ (er hat es anders formuliert, der Volksmund nennt es: ‚‘Was du nicht willst, das man dir tu das für auch keinem andern zu‘) gilt das das moralisch hervorragendste Maß für Richtig und Falsch. Wohlwissend, dass es kein absolutes Maß gibt, verzichtete Kant einfach darauf und machte eine relative Aussage daraus. Doch auch er ist nicht unumstritten. Nietzsche, der umstrittene Wilde und, auch umstritten, Romantiker, hätte gesagt: Kant ist ein Langweiler. Und er hätte nicht ganz Unrecht. Kreativität und Innovation sind nach dem Kategorischen Imperativ eindeutig im Nachteil.