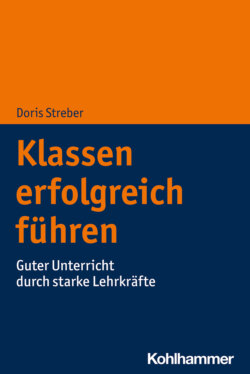Читать книгу Klassen erfolgreich führen - Doris Streber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Exkurs: Pädagogischer Bezug
ОглавлениеDen Begriff des »pädagogischen Bezugs« hat Nohl in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt: »Unter den wenigen Verhältnissen, die uns im Leben gegeben sind, Freundschaft, Liebe, Arbeitsgemeinschaft, ist das Verhältnis zum echten Lehrer vielleicht das grundlegendste, das unser Dasein am stärksten erfüllt und formt. … [es] wird die grundlegende Bedeutung des pädagogischen Bezuges klar« (Nohl & Pallat, 1933, S. 21).
Döring (1992) skizziert mit ausgewählten Nohl-Zitaten die Theorie des pädagogischen Bezugs (S. 92):
• Die Grundlage der Erziehung … ist das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben und seiner Form komme.
• Von Seiten des Zöglings ist konstitutiv, dass er ein unbedingtes Vertrauen dem Erzieher gegenüber hat, dass er von diesem in der Tiefe seiner Person absolut bejaht wird.
• Der Erzieher darf aber nicht vergessen, dass das sich im pädagogischen Bezug manifestierende erzieherische Verhältnis nicht zu erzwingen ist, dass hier irrationale Momente wirksam sind, wie Sympathie und Antipathie, die beide nicht in der Hand haben, und er darf darum nicht gekränkt sein oder es gar den Zögling entgelten lassen, wenn ihm der Bezug nicht gelingt, der Bursche nicht will. Man wird dann versuchen, ihn an jemand anderen zu binden, wenn die Bindung nur überhaupt erfolgt.
• Aber dieser Veränderungs- und Gestaltungswille wird doch gleichzeitig immer gebremst und im Kern veredelt und durch eine bewusste Zurückhaltung vor der Spontanität und dem Eigenwesen des Zöglings. Dieses eigentümliche Gegeneinander und Ineinander von zwei Richtungen der Arbeit macht die pädagogische Haltung aus und gibt dem Erzieher eine eigentümliche Distanz zu seiner Sache wie zu seinem Zögling, deren feinster Ausdruck ein pädagogischer Takt ist, der dem Zögling auch da nicht zu nahe tritt, wo er ihn steigern oder bewahren möchte.
• Und auch der Zögling will bei aller Hingabe an seinen Lehrer im Grunde doch sich, will selber sein und selber machen, schon das kleine Kind im Spiel, und so ist auch von seiner Seite in der Hingabe immer zugleich Selbstbewahrung und Widerstand, und das pädagogische Verhältnis strebt von beiden Seiten dahin, sich überflüssig zu machen und zu lösen.
• Das Verhältnis des Erziehers zum Kind ist immer doppelt bestimmt: von der Liebe zu ihm in seiner Wirklichkeit und von der Liebe zu seinem Ziel, dem Ideal des Kindes, beides aber nun nicht als Getrenntes, sondern als Einheitliches aus diesem Kinde machen, was aus ihm zu machen ist.
Döring (1992) würdigt diesen Denkansatz des Pädagogischen Bezugs in zweifacher Hinsicht: Bis heute hat Gültigkeit sowohl das hier betonte interpersonale Verhältnis als auch der Gedanke, dass Erziehung Emanzipationshilfe zu leisten hat.
Döring (1992) fasst die Kritik an der Theorie des Pädagogischen Bezuges in sieben Punkten zusammen (vgl. S. 93 f.). Hier genügen zusammenfassend folgende Stichpunkte:
1. Gefahr der Isolierung der Ich-Du-Relation zu Lasten der gesellschaftlichen Dimension von Erziehung
2. Ergänzungsbedürftigkeit durch andere Formen der Begegnung des Heranwachsenden mit der Welt
3. Fragwürdigkeit der Prämisse vom Primat der Person gegenüber der Sache
4. Vernachlässigung der Schulklasse und der Schülergruppe
5. Überforderung des Lehrers in Bezug auf seine erzieherische Leistungsfähigkeit
6. Vernachlässigung des emanzipatorischen Aspekts von Erziehung
7. Rechtfertigung des Frontalunterrichts: Nur hier kann der Lehrer die Ich-Du-Ebene für die ganze Klasse verwirklichen.
Döring konstatiert (S. 94): »Damit dürfte deutlich geworden sein, dass die Theorie des Pädagogischen Bezuges vor allem ihres privatistischen Grundcharakters wegen ein für das schulische Lehrerverhalten denkbar ungeeignetes Denkmodell darstellt«.
Kopp (1980, S. 26 f.) geht auf diese Kritik ein: Der pädagogische Bezug sei zu absolut und werde überschätzt. Die Ich-Du-Relation sei zu einseitig, der Sachanspruch trete in den Hintergrund, das Sozialgebilde Klasse und Gruppe werde nicht genügend gesehen. Die Fixierung des Lehrers auf den Schüler überfordere ihn emotional, psychologisch-rational und in Bezug auf seine erzieherischen Möglichkeiten.