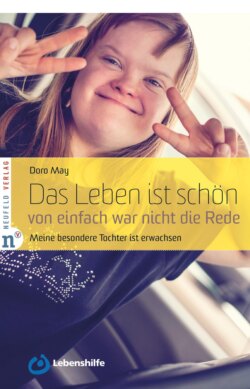Читать книгу Das Leben ist schön, von einfach war nicht die Rede - Doro May - Страница 9
Оглавление2
Das Leben ist endlich
Sicherlich gibt es viele betroffene Mütter und/oder Väter, die sich wünschen, erst einen Tag nach ihrem besonderen Kind sterben zu dürfen. Am liebsten sogar gleichzeitig mit ihm!
Das war jahrelang auch meine Wunschvorstellung.
Es ist nicht so, dass ich mir konkret ausgemalt hätte, wie wir zusammen zu Tode kommen. Ich habe also kein Unfallszenario vor meinem inneren Auge abspulen lassen, obwohl in Anbetracht der Tatsache, dass das Leben lebensgefährlich sein kann, genügend Stoff dazu abrufbar sein dürfte. Es ist vielmehr das Ergebnis, das sich vor meinem inneren Auge abspielt: Unser beider Leben geht zu Ende. Dabei ist es nicht gleichgültig, auf welche Weise, denn natürlich hätte ich gerne einen sanften und weisen Tod. Wir fassen uns an den Händen und gehen gemeinsam den für uns angelegten Weg. Wir erleben einen angenehmen Wechsel; man macht uns den Abschied leicht und wir werden gemeinsam im Drüben empfangen. Unsere Hände lassen sich die ganze Zeit nicht los – erst, wenn wir dort sind, am Ziel angelangt, dann kann ich Tina getrost loslassen. Sie braucht mich nun nicht mehr.
Eine Vorstellung, die beruhigt, sogar glücklich macht. Aber eben nur ein Wunschtraum.
Jetzt weiß ich, dass Tina in fortgeschrittenem Alter in die Seniorenwohnung einzieht. Sie ist gleich neben ihrer jetzigen Wohngruppe und also unter demselben Dach. Tina muss sich nicht großartig umgewöhnen. Die alten Leute von nebenan sind für sie keine Unbekannten. Die jahreszeitlichen Feste wie Sankt Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, die Frühlingsfeier oder das Sommerfest werden mit allen gemeinsam begangen. Kann auch sein, dass Tina eines Tages in ein Wohnheim zieht, das nicht so weit weg ist von unserem Zuhause und dem ihrer großen Schwester. In dem Fall wäre es schön, wenn sie mit ihren Mitbewohnern zusammen alt werden könnte, ohne noch einmal umziehen zu müssen.
Das ist nicht selbstverständlich, weil es lange Zeit durchaus üblich war, dass die Bewohner, wenn sie ins offizielle Rentenalter kommen, den Wohnort wechseln müssen, um in eine Art Pflegewohnheim für behinderte Rentner zu ziehen. Keine angenehme Vorstellung für die alternden Eltern, weil sie nicht in Ruhe sterben können mit der Frage, was eines Tages aus ihren Kindern wird. Die eigene Phantasie spielt einem da so manchen Streich und man sieht sein armes, verlassenes Kind, mittlerweile selbst schon in fortgeschrittenem Alter, alleine in der Stadt umherirren und nach Fixpunkten suchen, die es vielleicht irgendwo schon einmal gesehen hat und denen es eine Bedeutung zuordnen kann. Es ist also für uns Eltern eine sehr grundlegende Frage, wie und wo die von Behinderung betroffenen Menschen im Alter leben werden und ob sie sich in einer neuen Umgebung mit bis dahin unbekannten Betreuern und Pflegern eingewöhnen können. Hier wäre mehr Planungssicherheit für uns Eltern wünschenswert, weil man gerne alles geregelt hätte, bevor das eigene Leben zu Ende geht. Zum Glück haben die Elternräte in der Lebenshilfe dieses Thema wiederholt aufgegriffen, so dass die Bewohner inzwischen immer häufiger bis zu ihrem Tod in ihren Einrichtungen bleiben können.
Eine andere Variante wurde mir erst neulich zugetragen. Auch diese Begebenheit ist wie so viele Geschichten im Zusammenhang mit den von Behinderung Betroffenen ungewöhnlich bis makaber: Manchen Eltern fällt es schwer, ihre besonderen Kinder loszulassen, auch wenn diese längst dem Jugendalter entwachsen sind. Wenn der Lebenspartner eines Tages verstorben ist, kann es sehr schön sein, das Dasein als Witwe oder Witwer mit dem geistig behinderten Sohn oder mit der besonderen Tochter zu teilen, denn Zusammen ist man weniger allein, wie es der Titel eines anrührenden französischen Spielfilms so schön auf den Punkt bringt. So kann es passieren, dass eines Tages ein 60-Jähriger ausgehungert neben seiner toten Mutter hockt und die Welt nicht mehr versteht. Er ist in einem erbarmungswürdigen Zustand, denn schon seit 24 Stunden hat ihn niemand an den Toilettengang erinnert, unter die Dusche gestellt und frisch eingekleidet. Und warum er entgegen sonstiger Gewohnheit absolut nichts zu essen und, weitaus schlimmer, nichts zu trinken bekommt, bleibt ihm völlig unbegreiflich.
So geschehen zu Jahresbeginn – und wie mir der Mann von der Koordinationsstelle der Lebenshilfe aus meinem Wohnort berichtete, sei dieses Szenarium leider gar nicht so einmalig. Nun muss der verstörte 60-Jährige unmittelbar in ein Wohnheim der Lebenshilfe einquartiert werden. Eine absolute Notlage, zu der es keine Alternative gibt. Auch wenn der Mann nicht in die Gruppe passt, wo man für ihn auf die Schnelle notdürftig einen Platz einrichtet – zu Hause kann er nicht bleiben, denn sein bisheriges Zuhause gibt es ab sofort nicht mehr. Die Wohnung, in der er mit seiner Mutter oder dem Vater gelebt hat, wird aufgelöst, die Geschwister, falls welche vorhanden sind, haben Lebensentwürfe, in die sie ihn nicht einbeziehen können oder wollen. Schon gar nicht von jetzt auf gleich.
Erstaunlich, dass sich das etliche Eltern nicht bewusst machen beziehungsweise ihren eigenen Tod konsequent verdrängen. Ihrem längst erwachsenen Kind tun sie damit keinen Gefallen. Man muss ehrlicherweise daraus schließen, dass hier ein gewisser Egoismus zugrunde liegt: Der auf die Betreuung angewiesene Mensch füllt die Lücke der Einsamkeit. Ein hartes Wort – aber der oben geschilderte Ablauf rechtfertigt zumindest im Ansatz diesen Schluss.
Ich kenne Eltern, die dermaßen eng mit ihrem ebenfalls bald im Rentenalter befindlichen Kind verbunden sind, dass die Katastrophe vorprogrammiert ist. Sie haben keinerlei Vorkehrungen getroffen: Weder nimmt der Sohn an Aktivitäten von Gruppen zum Beispiel der Lebenshilfe oder der Caritas teil, noch fährt er mit anderen besonderen Menschen zusammen in Urlaub. Dabei gibt es gerade auf diesem Sektor viele Angebote, die nach Alter, Selbstständigkeitsgrad und Interessen gestaffelt sind. Genau genommen verhindern solche Eltern, dass ihr Sohn/ihre Tochter ein gewisses Maß an Flexibilität entwickeln kann. Ein nicht wieder gut zu machendes Versäumnis – vor allem, wenn ein behinderter Mensch auf sehr feste Abläufe angewiesen ist, wie zum Beispiel Tina. Wenn wir sie niemals mit einer Gruppe hätten reisen lassen, ihr nicht ein Leben in einem Wohnheim zugemutet hätten, wäre sie aufgrund ihres Autismus weitestgehend unbeweglich und fiele bereits jetzt unter das Motto: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Man darf nicht vergessen, dass es vielen Menschen mit Behinderung wie beispielsweise meiner Tochter schon schwer fällt, ein fremdes Haus überhaupt zu betreten …
Ein anderer Aspekt mit denselben möglichen Folgen liegt darin begründet, dass der Betreuer unter Umständen auf das Pflegegeld angewiesen ist. Jahrelang hat er den Angehörigen gepflegt, auf dem freien Arbeitsmarkt keinen Beruf ausgeübt, könnte wahrscheinlich auch nicht in den Beruf zurück, da das ohne Weiterbildung schwierig sein dürfte. Wie leicht hat man den Anschluss an den Stand der Technik verloren! Er hat sich in dem seit vielen Jahren gelebten Status Quo endgültig eingerichtet. Eine für den zu Betreuenden fatale Perspektive ist auch hier vorprogrammiert: Dank der guten medizinischen Versorgung in unserem Land haben die meisten der besonderen Mitbürger die Option auf ein normales Alter. Und dann kann es unter den geschilderten Umständen zu einer wie oben beschrieben abrupten und schmerzhaften Umstellung kommen, die ganz einfach dem Sachzwang unterliegt. Der plötzlich alleinstehende, behinderte Mitbürger ist auf sofortige Fremdunterbringung und Versorgung angewiesen mit allem, was dazugehört. Neue Umgebung, Personen, die er nie zuvor gesehen hat, die räumliche Umorientierung, veränderte Rituale im Einnehmen von Mahlzeiten und bezüglich der Schlafgewohnheiten, um nur wenige Dinge aufzuzählen, die auch für uns Normalos einiges an Flexibilität erfordern, denkt man sich zum Beispiel einmal in einen Krankenhausaufenthalt hinein. Wieviel schwerer muss ein solch abrupter Bruch in der Biografie für besondere Menschen wiegen, denen sich für so manches keine einleuchtende Erklärung erschließt?
Eltern müssen unter diesem Aspekt dringend durch frühzeitige Information aufgeklärt und sogar gewarnt werden, denn auch für das Personal einer Einrichtung ist eine solche Situation nicht zumutbar.
Anfang des Jahres gefiel es dem Tod in unserer Straße. Jedenfalls deutete alles darauf hin, als vier liebe, langjährige Nachbarn innerhalb weniger Monate abberufen wurden. Alle hatten die Diagnose Krebs. Drei von ihnen haben die medizinischen Angebote angenommen und damit den Kampf gegen die Krankheit angetreten. Ein Mann hat die lebensverlängernden Maßnahmen abgelehnt. Er wollte den qualvollen Krankheitsverlauf nicht durch eine Therapie in die Länge ziehen. Er war bereit zu sterben. Nachdem alle beerdigt waren und wir im Nachbarkreis über den Kummer der nächsten Angehörigen und ihren Umgang mit dem Verlust diskutiert hatten, fragte ich abends beiläufig meinen Mann, was für ihn das Schlimmste sei, wenn ich stürbe. Er musste nicht lange überlegen. »Am schlimmsten wäre es für mich, wie ich es Tina beibringe, dass du nicht mehr da bist.«
Ich verstand vollkommen – bei allem Kummer und eigenem Verlustempfinden würde es mir genauso gehen, wenn er stürbe.
Wie bringt man jemandem den Tod seiner allernächsten Bezugsperson bei, wenn es keine Erklärung gibt, die er begreifen kann? Nun ist der Tod ja an sich schon etwas Unbegreifliches – jedenfalls, wenn man so unmittelbar mit ihm konfrontiert wird. Wieviel schwerer muss es für einen besonderen Menschen wie Tina sein, zu begreifen, dass ich nicht mehr kommen kann?
Auf einer Fortbildung in Marburg für Eltern besonderer Kinder war eine Familie, deren Sohn das Down-Syndrom hatte und dessen engste Bezugsperson der Großvater war. Wie gewohnt, ging der Junge eines Tages nach nebenan, um den Großvater zu sehen, mit ihm einkaufen zu gehen, zu spielen – eben all die Unternehmungen mit seinem Opa anzupacken, die er gewohnt war. Doch nun war der Großvater gestorben. Es mag ein wenig schauerlich klingen, aber die Eltern haben folgendermaßen gehandelt: Der Junge durfte den toten Opa in die Leichenhalle begleiten. Er durfte ihn anfassen, damit er spürte, dass sich der alte Mann kalt anfühlte und dass er ihn noch so feste anstoßen konnte, er aber nicht aufwachte. Der Junge stand auch daneben, als man seinen Großvater in den Sarg legte, den Deckel darauf befestigte, indem man ihn annagelte. Er durfte sogar selbst mit Hilfe einen Nagel einschlagen. Natürlich erlebte der Junge zwei Tage später mit, wie der Sarg zuerst in der Kirche stand, wo man sang und betete, und wie der Sarg mit dem Opa drin in die Erde gelassen wurde. Sein geliebter Opa war nun unter der Erde – ganz wörtlich – und der Junge hatte den gesamten Vorgang begleitet. Es war für ihn die einzige Möglichkeit, den Großvater so zu verabschieden, dass er es begreifen konnte. Nun musste er lernen, sich auf andere Mitmenschen zu konzentrieren – mit jemand anderem einkaufen zu gehen und zu spielen. Nach einiger Zeit hat er sich umgewöhnt.
Man liest immer mal wieder, dass der Tod früher weniger tabuisiert worden sei. Dass der Sterbende von seiner Familie bis zum Schluss begleitet wurde, was auch häufig Stoff der Literatur ist. So wird in Thomas Manns berühmten Roman Die Buddenbrooks fast ausschließlich zu Hause gestorben.
Für besondere Menschen wie den oben beschriebenen Jungen gibt es im Grunde keine Alternative, um ihnen den Tod anschaulich zu machen.
Vielleicht ein Tipp für jedermann? Denn der Tod gehört nun einmal zum Leben dazu. Längst haben wir aber alles getan, um ihn aus unserer Nähe zu verbannen …
Meine besondere Tochter lehrt mich, dass das eine Dummheit ist.