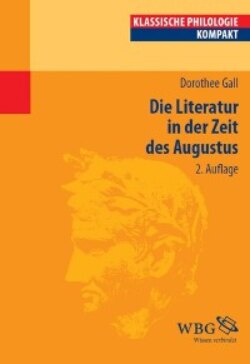Читать книгу Die Literatur in der Zeit des Augustus - Dorothee Gall - Страница 11
II. Die Literatur
ОглавлениеDie bedeutendsten Autoren der augusteischen Zeit sind: Vergil (70 bis 19 v. Chr.), Horaz (65 bis 8 v. Chr.), Livius (64 oder 59 v. Chr. bis 12 oder 17 n. Chr.), Vitruv (Mitte 1. Jahrhundert v. Chr.), Tibull (50 bis 19 oder 17 v. Chr.), Properz (circa 47 bis höchstens 2 v. Chr.), Ovid (43 v. Chr. bis 18 n. Chr.), Manilius (gestorben nach 22 n. Chr.).
Überlieferung und Selektion
An der Selektion durch die Überlieferung mögen bloße Zufälle ebenso mitgewirkt haben wie die inhaltliche Relevanz, die Spätantike und Mittelalter den einzelnen Gattungen und Texten zuerkannten. Dass wir aber mit den erhaltenen Autoren zugleich auch im Großen und Ganzen diejenigen Vertreter der augusteischen Literatur besitzen, denen das Publikum und die Kritiker der folgenden Jahrhunderte exemplarische Qualität beimaßen, legt die Existenz von Biographien und Kommentaren zu diesen Werken ebenso wie ihre reiche Rezeptionsgeschichte nahe. Dennoch führt der Verlust so zahlreicher Werke der Epoche zu einer erheblichen Verzerrung unserer Perspektive: Manches mag uns als singuläres Phänomen erscheinen, was zeitgenössischem Standard entsprach und viele Parallelen hatte; die Prozesse der Intratextualität erschließen sich uns nur fragmentarisch und in keiner Weise repräsentativ; für die Entwicklung von Gattungen und Diskursen wichtige Zwischenstücke bleiben verborgen oder allenfalls in Ansätzen sichtbar.
Die augusteische Epoche
Die Werke der ‚Augusteer‘ sind, wie die Übersicht auf S. 15 zeigt, teils vor der Konsolidierung augusteischer Herrschaft, zum geringen Teil auch nach Augustus‘ Tod entstanden oder publiziert worden; so umfasst die ‚Literatur der augusteischen Zeit‘ einen größeren Zeitraum als die ‚augusteische Zeit‘ im strengen Wortsinn. Andererseits ist es die Literatur, die den eigenen Epochencharakter des Augusteischen besonders deutlich hervortreten lässt: Im Feld der Politik stellt Augustus nur den Beginn der viele Jahrhunderte umspannenden Epoche von Prinzipat und Kaisertum oder der etwa ein Jahrhundert währenden Herrschaft des iulisch-claudischen Kaiserhauses dar; dagegen bildet die Literatur seiner Zeit ein eigenes Kontinuum, das sich von der Phase der späten Republik ebenso abgrenzt wie von den literarischen Bestrebungen der späteren Zeit. Wenn der augusteische Prinzipat als eigene und nicht nur von der Republik, sondern auch vom späteren Prinzipat abgegrenzte Epoche erfahren wird, dann verdankter dies im Wesentlichen seiner Literatur, die trotz zahlreicher gattungsspezifischer und thematischer Differenzen von einem poetologischen Grundkonsens getragen und durch eine größere Zahl übergreifender Aspekte und Diskurse geprägt ist.
Klassik
Als Alternativbegriff zur ‚augusteischen Literatur‘ dient häufig die Formel ‚augusteische Klassik‘.,Klassik‘ oder ‚das Klassische‘ sind ihrerseits Begriffe, die einer historischen und systematischen Erläuterung bedürfen:
Der Begriff ‚klassisch‘ ist in seinem Ursprung soziologisch beziehungsweise politisch. Gellius (2. Jahrhundert n. Chr.) unterscheidet zwischen dem classicus scriptor und dem proletarius (Noctes Atticae 19,8,15); er wendet also das Kriterium der römischen Bürgerklassen an und bezeichnet als klassisch Autoren mit römischem Bürgerstatus und eigenem Vermögen. Die Gleichung ‚klassisch = begütert‘ ist aber doch sehr problematisch und ließe sich vielfach widerlegen. Und Gellius‘ Definition meint auch mehr als nur die Vermögensverhältnisse: Tatsächlich spricht er von der ‚besseren Gesellschaft‘ unter den Schriftstellern, also von den qualitativ guten und beachtenswerten Autoren. Als ‚Klassiker‘ gelten demnach die hervorragenden, beispielhaften, stilbildenden Autoren einer Nationalliteratur, einer Epoche oder auch der Weltliteratur. Man kann also von griechischen und römischen Klassikern (und so weiter) sprechen, aber auch von voraugusteischer und augusteischer Klassik (und so weiter).
In der modernen Literaturwissenschaft umschließt die Kategorie des ‚Klassischen‘ verschiedene Aspekte, die zum Großteil aus als klassisch geltenden Literaturen, unter anderem der augusteischen, abgeleitet sind: die Hochphasen einer Literatur im Verlauf ihrer Entwicklung; die Orientierung an antiken Vorbildern, wobei das Verständnis der beispielgebenden ‚antiken Kunst‘ vielfach einer programmatisch verengten Auswahl unterliegt; die Formmerkmale der Harmonie und des Maßvollen, im Gegensatz zum Unausgewogenen, Überbordenden, Manierierten; ein Menschenbild, das den Einzelnen vor allem auf die Verwirklichung seiner moralischen Qualität und die Entwicklung seiner menschlichen Individualität in vollkommener geistiger, seelischer und körperlicher Hinsicht verpflichtet (Ideal der humanitas). Auch die überzeitliche Gültigkeit der Themen, die nicht auf das Tagesgeschäft einer Epoche oder spezifischer Lebensumstände beschränkt sind, sondern einen ideellen und allgemein menschheitsrelevanten Gehalt in sich tragen und damit an der Verwirklichung allgemeiner humanitas mitwirken, stiftet den klassischen Charakter von Literatur. In der deutschen Literaturkritik dient ‚Klassik‘ zugleich als Epochenbegriff für die Zeit des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und wurde als Gegenbegriff zur Romantik geprägt. Diese Opposition hat es in der Antike natürlich nicht gegeben.
Vergil: buc. = Bucolica; georg. = Georgica; aen. = Aeneis; cat. = Catalepton
Horaz: ia. = Iambi; ser. = Sermones; ep. = Epistulae; Carm. = Carmina; c.s. = Carmen saeculare
Tibull, Properz: el. = Elegien
Ovid: am. = Amores; her. = Heroides; ars = Ars amandi; rem. = Remedia amoris; met. = Metamorphosen; fast. = Fasti; trist. = Tristia; pont. = Epistulae ex Ponto
Epochen werden immer in Abgrenzung zu vorangehenden und folgenden Epochen wahrgenommen; tatsächlich konstituieren sie sich erst durch die Auseinandersetzung mit Früherem und den Einfluss auf Späteres. Wesentlich für die ‚augusteische Klassik‘ ist hinsichtlich des Rückbezugs auf frühere Epochen eine starke Traditionsbindung, die aber innovativen Charakter gewinnt: Die augusteischen Autoren verstehen sich nicht als literarische Revolutionäre, sondern als die glücklichen Erben einer reichen griechisch-römischen Überlieferung, aus der sie die besten Schätze auswählen und nach eigenem Ermessen und Anspruch verwenden können; indem sie sich der ‚klassischen‘ wie auch der hellenistischen griechischen Literatur bemächtigen, ihre römischen Vorgänger zu übertreffen suchen und über die Grenzen von Sprachen, Gattungen und Stiltendenzen hinweg Anregungen und Vorbilder für ihre eigenen Werke finden, lassen sie eine Literatur entstehen, die zugleich abhängig und frei, traditionsgebunden und originell ist. Dieser literarische Eklektizismus – die Entwicklung einer ganz eigenen Literatur aus dem Potential verschiedener Epochen, Gattungen und Stile – konstituiert jenseits aller thematischen Parallelen das Kontinuum der klassischen augusteischen Literatur. Der formalen, insbesondere sprachlichen Qualität dieser Epoche trägt die Literaturwissenschaft Rechnung, wenn sie von ‚Goldener Latinität‘ spricht.
,Goldene und ‚Silberne Latinität
Die ‚nachklassische Phase der römischen Literatur hat ihre berühmten augusteischen Vorgänger in engagierter Nachahmung rezipiert; dabei bildete sich aber eine eigene Ästhetik heraus, die gerade den Stilen, Motiven und Gestaltungsformen Raum gab, die bei den Augusteern eher vereinzelt auftraten. In der Philologie werden diese Tendenzen gewöhnlich als ‚unklassisch‘ oder ‚gegenklassisch‘ bewertet; sie sind aber auch im Ansatz schon Elemente augusteischer Stilgebung und kündigen sich insbesondere in Ovids Werk deutlich an. Der Begriff ‚Silberne Latinität‘ hebt die Literatur des 1. Jahrhunderts n. Chr. qualitativ von der ‚Goldenen Latinität‘ ab.
Komposition
Im Einzelnen lassen sich folgende natürlich generalisierende und insofern stark vereinfachende Unterscheidungen treffen: Die Augusteer bevorzugen eine eher schlichte und in der Stilhöhe einheitliche Sprache, in der überlange Sätze, entlegene Begriffe und auffällige Klangwirkungen wie Alliteration oder Endreim zurückhaltend und in der Absicht gezielter Akzentuierung verwendet werden. Ein wichtiges Mittel der Stilisierung und Gedankenführung ist die Vielschichtigkeit von Alltagsworten: Sekundäre Bedeutungen bereichern den Text und bereiten thematische Übergänge vor.
Die Themen, Bücher, Bilder sind einer rational nachvollziehbaren Gesamtkomposition verpflichtet, die auf ausgewogene Proportionen und innere Ordnung abzielt: Ein Großteil der Einzeltexte ist in der Grobgliederung in zwei oder drei Teilen aufgebaut, die in Parallelität und Symmetrie zueinander stehen (Diptychon- oder Triptychonstruktur). Diese strengen Ordnungskriterien werden aber auch immer wieder aufgebrochen – ein rhetorischer Technik entsprechendes Verfahren, das die Technik der Strukturierung überhaupt erst ins Bewusstsein rückt.
Bildlichkeit
Ein wichtiges Merkmal der augusteischen Literatur ist ihre ausgeprägte Bildlichkeit. Vergleiche, Metaphern, Allegorien und vielschichtige Symbole überlagern den primären Wortsinn mit einer schillernden Schicht von Nebenbedeutungen, Anspielungen und weiterführenden Assoziationen.
Klassische Mäßigung
Die Augusteer meiden das Exzessive und Manierierte. Leidenschaften, Grausamkeiten, Hässliches und Widerwärtiges kommt auch in ihrer Dichtung zur Sprache, wird aber durch die Form und kultiviert zurückhaltende Sprache in seiner verstörenden Wirkung eingegrenzt. In dieser Bändigung liegt ein optimistischer Grundton: Das augusteische Menschenbild sieht das Leid und die Verwirrungen, denen die Menschen in der Welt ausgesetzt sind, eröffnet aber die Chance sittlicher Autarkie und der Treue zu eigenen Vorstellungen und Zielen; ein wesentliches Mittel dazu ist die Mäßigung der Affekte – ein Prozess der Selbstprägung, der an mythischen und historischen exempla vor Augen geführt wird.
Nachklassik
Die Nachklassik strebt nach einer deutlicher konstruierenden und polarisierenden, schwierig-gelehrten oder aber auch in höherem Maße kolloquial geprägten Sprachform; sie setzt rhetorische Mittel reicher und mit geringerer Akzentuierungskraft ein. Die Nachklassiker verstärken die Technik des Strukturbruchs; sie führen Gliederungen ein, um sie unmittelbar darauf wieder zu missachten; sie lassen Einzelteile ausufern und Wichtiges gegenüber Marginalem zurücktreten. Exzessiv betreiben sie die Schilderung des Grauenerregenden und zwingen dem Leser in detaillierten und rhetorisch brillanten Schilderungen Assoziationen des Schrecklichen und Abstoßenden auf. Dem entspricht ein im Kern pessimistisches Menschen- und Weltbild: Affekte treiben die Menschen um, in Liebe, Hass und Grausamkeit schwelgen sie. Insofern gibt es auch keine verbindlichen Vorbilder mehr, Mythos und Historie sind in erster Linie Erzählstoff ohne moralische Implikation.
In den Jahrzehnten augusteischer Herrschaft kommt es in Rom zu einer ganz ungewöhnlichen Konzentration von hohen dichterischen Begabungen. Eine kleine Schicht gebildeter und hochbegabter Männer sammelt sich um einige Förderer; die wichtigsten sind zwei enge Vertraute des princeps, Maecenas (um 70–8 v. Chr.) und Messalla (59 v. Chr. – 8 oder 11 n. Chr.).
Maecenas
Maecenas entstammt einer vornehmen etruskischen Familie in Arezzo und gehört dem Ritterstand an. In der Schlacht von Philippi (42) kämpft er auf Seiten Octavians, dem er bis zu seinem Lebensende im Jahre 8 v. Chr. als Berater und Vertrauter dient; in Zeiten der Abwesenheit des princeps führt er zeitweilig sogar für ihn die Regierungsgeschäfte in Rom und Italien. Berühmter als durch eigene Werke – er verfasst Prosa und Dichtung, aber nur Fragmente davon sind erhalten – wird er als Freund und Förderer bedeutender Schriftsteller: Zu seinem Kreis gehören neben Vergil, Horaz und Properz auch Schriftsteller, deren Werke verloren sind: der etwas ältere L. Varius Rufus, der großen Respekt genießt und in verschiedenen Gattungen brilliert, der Komödiendichter Aristius Fuscus, Domitius Marsus, dessen Epigramme Martial lobt, und C. Melissus, Maecenas‘ Freigelassener, der als Grammatiker in hohem Ansehen steht und auch Komödien schreibt. Auch Valgius Rufus, Konsul des Jahres 12 v. Chr. und Verfasser von Dichtung und Fachliteratur, scheint sich im Maecenas- und Messalla-Kreis bewegt zu haben.
Messalla
Messalla steht im Bürgerkrieg zwischen Marcus Antonius und Octavianus auf Seiten des Antonius, avanciert aber nach dessen Tod zum engen Vertrauten Octavians. Zu seinem Kreis gehören Tibull, wahrscheinlich auch der junge Ovid, Aemilius Macer (gestorben 16 v. Chr.) und vielleicht auch der Autor – oder die Autoren – einiger fälschlich unter Vergils Namen überliefertenKleintexte innerhalb der Gedichtsammlung Catalepton (zumindest ist catal.9 ein Preisgedicht auf Messalla). Unter den gewöhnlich als 3. (und in vielenAusgaben: 4.) Buch Tibulls überlieferten Dichtungen befinden sich nebennachaugusteischen Texten auch einige Kurzelegien (oder Epigramme), deren ‚Ich‘ sich als Sulpicia, Messallas Nichte, zu erkennen gibt.
In Messallas Umfeld scheint eine nostalgische Rückbindung an die Zeit der Republik eher möglich gewesen zu sein als im Maecenas-Kreis; zumindest können die um Messalla vereinigten Dichter sich dem Druck politischer Propaganda leichter entziehen und stehen in Thematik und Ästhetik der späten republikanischen Dichtung näher. Progressiver, aber eben auch politisch engagierter ist der Maecenas-Kreis.
Leitmotive augusteischer Dichtung
Die persönliche Interaktion der Künstler und ihrer Förderer mag von jeweils spezifischer Intensität gewesen sein; in jedem Fall partizipieren sie alle an einem gemeinsamen Bildungshintergrund und nehmen die literarischen Werke ihrer Zeitgenossen nicht nur zur Kenntnis, sondern setzen sich auch in ihren eigenen Werken produktiv damit auseinander. Kein Werk der augusteischen Zeit ist in ‚splendid isolation‘ entstanden; sie alle sind nur im Konnex der bereits existierenden oder gleichzeitig entstehenden Werke angemessen zu verstehen. Nicht all diese intertextuellen Bezüge kann man heute noch entschlüsseln; und in deutlich aufeinander bezogenen Texten lässt sich nicht immer mit letzter Sicherheit klären, wo die Priorität liegt. Dass häufig – mit und ohne Namensnennung – nicht nur aus früheren, sondern auchaus zeitgenössischen Werken zitiert oder auf sie verwiesen wird, ist aber unverkennbar. Einige Themen und Leitmotive werden von mehreren oder allenAutoren in unterschiedlicher Weise aufgegriffen: Verherrlichung des Augustus und seiner Familie, Preis des Goldenen Zeitalters, Kritik gesellschaftlicher Degeneration, poetologische Reflexion im Sinne kallimacheischer Beschränkung und eines hohen Selbstbewusstseins als römischer poeta doctus (gelehrter Dichter), die Beschäftigung mit den mythischen, ethnologischen, religiösen und etymologischen Ursprüngen der Dinge, Bräuche und Institutionen (Aitiologie: die Erforschung der Ursprünge). Diese Themen konstituieren zugleich auch eine produktive Teilhabe der Dichtung an der Ausformungdes augusteischen Wertesystems und Italien- und Rombildes.
Gattungsintegrativer Stil
Die besondere Verflechtung innerhalb der augusteischen Literatur und die souveräne Beherrschung des schriftstellerischen ‚Handwerks‘ schlagen sich auch gattungsspezifisch nieder: Die Grenzen zwischen den Gattungen lockern sich, Elemente aus unterschiedlichen genera werden in einem Werk integriert. Zur Vollendung bringt Ovid diesen gattungsintegrativen Stil; aber auch Vergil lässt beispielsweise sein Lehrgedicht Georgica in einem mythologischen Kleinepos münden; Horaz mischt in seine Sermones und Epistulae Elemente der Diatribe (eine gesprächsweise entfaltete popularphilosophische Abhandlung), der Komödie, der Invektive (aggressive Schmähung); Properz öffnet seine Elegien – eine in der römischen Literatur zunächst auf subjektive Themen fixierte Form – auch für politische und aitiologische Themen.
Literarische Kleinformen
Allgemein favorisiert werden in der augusteischen Zeit literarische Kleinformen, die einen persönlichen Dialog zwischen Leser (beziehungsweise Hörer) und Werk stiften, auch wenn sie durchaus für den öffentlichen Vortrag geeignet sind. Das gilt für die Elegie, und damit für das Gesamtwerk von Tibull und Properz; es gilt aber auch für die vergilische Bukolik, Horaz‘ hexametrische und lyrische Dichtung und für große Teile des ovidischen Gesamtwerkes. Einen persönlichen Bezug zwischen Leser und Werk strebt auch noch das Lehrgedicht an, vor allem wenn es, wie bei Ovid, in die dem Subjektiven besonders zuneigende metrische Form des elegischen Distichons gekleidet ist.
Das ‚Sprecher-Ich‘, das sich in diesen Texten dem Leser zuwendet, darf nicht leichtfertig mit der Person des Dichters identifiziert werden. Relativ leicht fällt die Differenzierung in der Lyrik, wo das ‚Ich‘ in Rollen schlüpft, die in der literarischen Tradition vorgeprägt waren. Im Lehrgedicht, aber auch in Elegie, Iambus und satura steht der ‚Sprecher‘ manchmal auf derselben Ebene wie die ‚personae‘, die er einführt, an anderen Stellen suggeriert er durch Namensnennung oder biographische Verweise seine Identität mit der historischen Person des Autors.
Literarische Großformen
Die noch im 2. Jahrhundert v. Chr. ungeheuer fruchtbare Produktion von Komödien und Tragödien lässt in augusteischer Zeit fast völlig nach, und das Epos wird zu einer Gattung, der alle Schriftsteller mit Rang und Namen äußerst misstrauisch gegenüber stehen. Vergil fügt sich schließlich den Wünschen von Augustus und Maecenas und verfasst mit der Aeneis das wohl bedeutendste Werk der augusteischen Literatur; aber noch die Art, wie Ovid in seinen gleichermaßen genialen Metamorphosen die Gattungselemente des Epos der Episodentechnik unterordnet und Motive der Aeneis rezipiert und parodiert, belegt die tiefe Skepsis der Augusteer gegenüber dem Großwerk.
Drei Werke der augusteischen Literatur sprengen das Ideal der kleinen Form: Vergils Aeneis, Ovids Metamorphosen und – im Bereich der Kunstprosa – Livius‘ Geschichtswerk Ab urbe condita. Doch auch hier sind die Gesetze der Kleinform nicht außer Kraft gesetzt: Die Stofffülle wird gebändigt durch eine kunstvolle Komposition; an die Stelle einer chronologischen Folge im ordo naturalis (natürliche, das heißt chronologische Folge) tritt in der Epik der ordo artificialis (künstliche, das heißt nicht chronologische Folge), der in Vor- und Rückblenden, in Binnenerzählungen, dialogischen Partien und durch das Kunstmittel der ausführlichen Ekphrasis (ékphrasis: exkursartige Beschreibung) den Großstoff in kleinere Einheiten aufteilt. Innerhalb der Einzelbücher und im Verhältnis der Bücher untereinander herrscht ein System von Vor- und Rückverweisen, von Wiederholungen und Spiegelungen, das die kleinere Einheit jeweils aufwertet und sie zugleich in das Gesamtwerk einbindet.