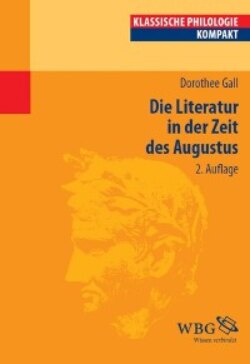Читать книгу Die Literatur in der Zeit des Augustus - Dorothee Gall - Страница 8
A. Rom in der Zeit des Augustus I. Die Zeit der Bürgerkriege
ОглавлениеRom nach den punischen Kriegen
Den Niedergang der römischen Republik (res publica Romana) führte der römische Historiker Sallust (86–34 v. Chr.) – wahrscheinlich in der Nachfolge des griechischen Philosophen und Geschichtsschreibers Poseidonios Rhodios (135–51 v. Chr.) – auf die Zerstörung Karthagos im Jahr 148 v. Chr. zurück: Ohne ebenbürtige Feinde habe Rom die Motivation gefehlt, seine Tugenden und Kräfte zu erhalten; so sei es allmählicher Degeneration zum Opfer gefallen. Tatsächlich setzt mit dem Ende der Eroberungskriege ein großer Wandel ein, der aber weniger durch den Verlust eines Feindbildes, als durch zahlreiche Feldzüge und die wirtschaftlichen Folgen der gewaltigen Expansion des Reiches zu erklären ist: Gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. stehen Spanien, ganz Griechenland mit Makedonien, der Norden Afrikas und Teile Kleinasiens unter römischer Herrschaft. Davon profitiert vor allem die Oberschicht; sie bereichert sich in den Kriegen durch Beutenahme, nach den Kriegen in den Provinzen, die sie verwaltet.
Landflucht und Sklavenaufstände
Für das Sozialgefüge der Städte, die ökonomische Situation der Landbevölkerung und die innere Sicherheit des römischen Reiches bedeutet die Expansion dagegen eine Quelle der Instabilität: Die Landbevölkerung stellt große Teile des römischen Heeres – und verliert so ihr wesentliches Arbeitspotential. Die von Sklaven bewirtschafteten Latifundien drängen die bäuerlichen Kleinbetriebe ins wirtschaftliche Abseits und befördern Landflucht und Verelendung der Kleinbauern. Da die Bevölkerung eroberter Städte vielfach versklavt wird, droht die Zahl der Sklaven in Italien die Zahl der wehrfähigen Bürger zu übersteigen. Sklavenaufstände überziehen in rascher Folge Sizilien, Griechenland, Kleinasien, Italien. Die institutionalisierte Ausbeutung der Provinzen fördert die Piraterie im Mittelmeer, die von den Städten als einziges Mittel angesehen wird, den eigenen finanziellen Ruin abzuwehren. All diese Faktoren bewirken eine zunehmende gesellschaftliche Destabilisierung und politische Polarisierung. Gegen den Widerstand weiter Teile der politischen Führungsschicht setzen in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. vermehrt Bestrebungen ein, die Rechte des Volkes zu stärken. Dazu gehören die leges tabellariae (Tafelgesetze), durch die die comitia (Volksversammlungen) auf geheime Abstimmung verpflichtet werden.
Tafelgesetze
Weiteres Konfliktpotential liegt in der rechtlichen Privilegierung der römischen Bürger, die einem Großteil der Italiker verwehrt bleibt. Erst der Bundesgenossenkrieg der italischen Städte gegen Rom (91–88 v. Chr.) erzwingt die Ausweitung des römischen Bürgerrechts auf alle Italiker und die Gallia Transpadana (Oberitalien jenseits des Po).
Die Gracchen
Das Problem der Landflucht und der aus ihr resultierenden Überbevölkerung in Rom kann durch Getreideabgaben an das städtische Proletariat nicht dauerhaft gelöst werden; dazu müssten Schritte zu einer Rücksiedelung erfolgen. Das wäre aber nur im Rahmen einer umfassenden Neuordnung der Grundbesitzverhältnisse unter Enteignung des von der Oberschicht usurpierten italischen Landes möglich. Diese Bodenreform, der sich Tiberius Sempronius Gracchus und sein Bruder Gaius als tribuni plebis (Volkstribunen, 133 und 123/2), verschreiben, scheitert am Widerstand der Großgrundbesitzer.
Sulla und Marius
Die Interessengegensätze zwischen den Optimates (die Besten: die alte Aristokratie) und Populares (Vertreter der Volkspartei) gipfeln schließlich in einem Bürgerkrieg. Dessen unmittelbarer Auslöser ist der Krieg gegen den pontischen Herrscher Mithradates, der sich der römischen Provinz Asia zu bemächtigen sucht. Der Senat entsendet im Jahr 88 v. Chr. als Feldherrn den Optimaten L. Cornelius Sulla. Die Volksversammlung aber bestimmt den Popularen Marius als Feldherrn. Die Konkurrenz dieser beiden Männer bereitet das Ende der Republik vor: Nach einer Phase der Machtübernahme durch Marius und seine Anhänger kann Sulla zwar für kurze Zeit die Herrschaft der Senatsaristokratie in Rom wieder herstellen, beide Feldherren nutzen aber jeweils ihre Herrschaft über die Stadt, um ihre Widersacher zu verfolgen und zu töten und ihr Vermögen einzuziehen. Die alte Führungsschicht wird auf diese Weise drastisch dezimiert.
Pompeius, Crassus und Caesar
Im Jahr 79 erklärt Sulla sein Programm einer Restituierung der Senatsherrschaft für abgeschlossen und legt seine Vollmachten nieder. Fast gleichzeitig beginnt der Aufstieg von Pompeius, der im Krieg gegen den Marius-Anhänger Sertorius in Spanien ersten militärischen Ruhm gewinnt, und von Crassus, der durch seinen Sieg über das von Spartacus angeführte aufständische Sklavenheer populär wird. Im Jahr 71 stehen Pompeius und Crassus mit siegreichen Heeren vor der Stadt – eine fatale Bedrohung für den Senat. Sie setzen ihr gemeinsames Konsulat für das Jahr 70 durch und heben die sullanische Verfassung auf.
Pompeius’ Macht und Popularität wächst durch den Seeräuberkrieg, die Zerschlagung der Seeräuberflotten im Mittelmeer (67). Im Jahr 66 wird ihm der Oberbefehl im Krieg gegen Mithradates erteilt; seinen Sieg krönt er mit einer umfassenden politischen Neuordnung Kleinasiens und Iudaeas im Sinne römischer Machtpolitik. Als Pompeius 62 nach Italien zurückkehrt, verlangt er vom Senat die Bestätigung seiner Politik im Osten, die Versorgung seiner Veteranen und die Gewährung eines Triumphes. Den Triumphzug kann er im September 61 abhalten, aber 60 scheitert der Gesetzesantrag auf Versorgung der Veteranen. Pompeius entfernt sich von der Senatspartei. 56 schließt er ein Zweckbündnis mit Crassus und mit Caesar, dem bedeutendsten politischen Aufsteiger der vergangenen Jahre, der in Rom die Partei der Populares hinter sich gebracht hat und durch seine militärischen Erfolge in Gallien über ein großes Heer verfügt; Pompeius’ Ehe mit Caesars Tochter Iulia und Crassus‘ Vermittlung halten diesen Dreierbund (Triumvirat) eine gewisse Zeit im Gleichgewicht. Als aber 54 Iulia stirbt und 53 Crassus bei Carrhae in der für die Römer verheerenden Schlacht gegen die Parther fällt, schlägt das Bündnis um in einen offenen Konkurrenzkampf. Der Bürgerkrieg zwischen Pompeius und Caesar (49–45) bedeutet das Ende der römischen Republik. Kurz nach seiner Niederlage in der Schlacht bei Pharsalos im Jahr 48 wird Pompeius in Ägypten erschlagen, der siegreiche Feldherr Caesar lässt sich 45 zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen. Doch an den ‚Iden des März‘ (15. 3.) 44 wird er von einer Gruppe von Verschwörern umgebracht.
Politische Destabilisierung
In den Bürgerkriegen der Jahre zwischen 133 und 45 – also von den gracchischen Reformversuchen bis Pharsalos – treten verschiedene Schwächen des politischen und ökonomischen Systems in Rom zu Tage: Dieses ist ausgerichtet auf den Ausgleich zwischen zwei Schichten in einer Stadt, nicht auf die Verwaltung eines Weltreiches, das Kontinuität der Machtausübung, straffere Hierarchien, kürzere Entscheidungswege und gestalterische Innovationskraft verlangt. Im kleineren Bereich italischer Politik konnten sich die Anpassungen an die jeweiligen Erfordernisse noch in jahrzehntelangen Prozessen vollziehen. Die neue politische Situation ist aber auf diese Weise nicht mehr zu gestalten.
Klientelverhältnisse
An der inneren Stabilität der römischen Gesellschaft hatten die Klientelverhältnisse großen Anteil; sie banden die Reichen und Armen, die Mächtigen und Machtlosen durch gegenseitigen Nutzen aneinander. Jetzt verlieren sie aber an Bedeutung, einerseits durch die kostenlosen Getreideabgaben in der Stadt, die die Armen wirtschaftlich unabhängig machen, dann durch die Einführung geheimer Wahlen, die den patroni die Kontrolle über ihre clientes entziehen. Auch die Entstehung eines ‚dritten Standes‘ aus begüterten Gewerbetreibenden, Finanziers etc. erschüttert die alten Bündnisverhältnisse und schwächt den Einfluss der nobilitas. Deren internes Kontrollsystem verliert an Zuverlässigkeit, der Aufstieg Einzelner wird möglich.
Stehendes Heer
Als problematisch erweist sich auch eine von Marius eingeführte Neuerung: das stehende Heer aus ‚Berufssoldaten‘. Angesichts der Landflucht scheint dies eine sinnvolle Reform zu sein; sie schafft aber im Heer neue Solidaritäten. Die Söldner fühlen sich nun weniger dem Staat verpflichtet, dessen Bürger sie sind, als dem Feldherrn, der für ihren Sold aufkommt und ihre Altersversorgung garantiert – eine entscheidende Vorbedingung für Bürgerkriege.
Caesars Diktatur
Caesar trägt der Verelendung des städtischen Proletariats und den Problemen eines Großreichs Rechnung, indem er ein umfangreiches Reformprogramm zu Gunsten der plebs durchzusetzen sucht und die Macht in seiner Person bündelt. Geschickt schließt er sich dabei an römische Herrschaftstraditionen an und beansprucht zunächst für sich nicht den Titel eines Königs, sondern den eines Diktators auf Lebenszeit – ein Amt, das für den Ausnahmezustand auch in der alten Verfassung vorgesehen war und deren normales Funktionieren außer Kraft setzte.
Allerdings unterschätzt Caesar die Widerstandskraft der nobilitas; mit seiner Ermordung an den Iden des März 44 (15. 3.) bäumt sich die alte Führungsschicht ein letztes Mal gegen die Diktatur auf und verlängert die Phase des republikanischen Rom um weitere 14 Jahre. Es sind Jahre des Bürgerkriegs, zunächst zwischen den Caesar-Mördern und den Anhängern Caesars, an deren Spitze Octavianus und Marcus Antonius, dann – nach dem Sieg dieser beiden über die Vertreter der alten Republik – zwischen diesen beiden Männern selbst.