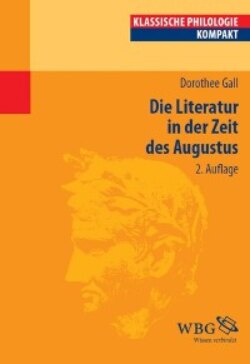Читать книгу Die Literatur in der Zeit des Augustus - Dorothee Gall - Страница 17
IV. Lehrdichtung
ОглавлениеHesiod
Lehrdichtung in stichischen Hexametern ist seit Hesiod (um 700 v. Chr.) in der griechischen Literatur bekannt. Hesiods Theogonie (Entstehung der Götter) und Erga kai Hemerai (Werke und Tage), haben das Ziel, Weltverständnis, Frömmigkeit und Sittlichkeit zu fördern. Die Wirksamkeit der vermittelten Lebensmaximen wird verstärkt durch die subjektive Sprechweise; ein Dichter-Ich gibt sich als Wegweiser zum richtigen Leben, als Verkünder einer Heilslehre zu erkennen. Auch die frühen griechischen Philosophen vor der Sophistik fassten ihre Lehren in das Gewand von Dichtung.
Hellenistische Lehrdichtung
In hellenistischer Zeit scheint sich ein Wandel im Selbstverständnis des Lehrdichters zu vollziehen: Die schöne metrische Form und die ausgefeilte Sprache und Komposition gewinnen gegenüber der didaktischen Funktion des Textes an erheblichem Eigenwert. Bereits die Antike betrachtete Arat (zwischen 315 und 305 – circa 240/239) und Nikander (wohl 2. Jahrhundert v. Chr.) in erster Linie als poetische Virtuosen, deren Verdienst darin lag, einen entlegenen Stoff kunstvoll zu meistern; davon zeugt die bei Cicero (De orat. 1, 69) und in den Arat-Viten überlieferte Anekdote, Arat, der Verfasser des astronomisch-astrologischen Lehrgedichts Phainomena (Himmelserscheinungen), sei Arzt, Nikander, der zwei Lehrdichtungen über Gifte und ihre Heilmittel (Theriaka; Alexipharmaka) schrieb, sei Astronom gewesen. Wie immer es um die historische Wahrheit dieser Nachricht steht, auch Arat und Nikander verfolgten neben dem Zweck der Unterhaltung den der Unterweisung: Sehr engagiert richtet Arat seine Lehren nach der stoischen Philosophie aus; und in der Verarbeitung medizinischer Quellen demonstriert auch Nikander nicht nur seine dichterische Kompetenz, sondern trägt auch ernsthaft für nützlich erachtetes Fachwissen vor.
Römische Lehrdichtung
Das erste bedeutende Lehrgedicht der römischen Literatur ist Lukrez’ De rerum natura, eine dichterische Darstellung der epikureischen Philosophie. Lukrez beansprucht dafür die Großform von sechs Büchern; sein Werk vereinigt die Ansprüche hellenistischer Poetik mit der didaktischen Ernsthaftigkeit früher griechischer Lehrdichtung.
Germanicus
Die Attraktivität von Lehrdichtung in augusteischer Zeit ist durch mehrere Beiträge bezeugt: Der von Augustus als Nachfolger des Tiberius vorgesehene Germanicus (15 v.–19 n. Chr.) hat Arats Phainomena – wie schon vor ihm Cicero – ins Lateinische übersetzt. Manilius (gestorben um 22 n. Chr.) hat ihm mit seinen eigenen Astronomica nachgeeifert.
Vergil, Georgica
Die Phainomena sind – neben Hesiod und Lukrez und einschlägiger Fachliteratur – aber auch eine der Quellen, die Vergil in seinen Georgica benutzt hat, einem Lehrgedicht, das mit seinen vier relativ kurzen Büchern in zwei Buchpaaren einen Kompromiss zwischen Groß- und Kleinform darstellt. Die Georgica repräsentieren mit dem Thema der Landwirtschaft in ihrer eher der stoischen Philosophie verpflichteten Ausrichtung und vor allem im deutlichen Bezug zum Programm augusteischer Erneuerung eine ganz andere Richtung als Lukrez; dieser ist aber in vielen Motiven und Aspekten rezipiert. In der Vermittlung des konkreten Stoffs tritt auch die Freude an der poetischen Technik hervor; dennoch transportiert das Werk in seiner Gesamtheit eine mit dem Anspruch der Verbindlichkeit vertretene Weltsicht. Die in einigen Viten Vergil zugeschriebene Aetna, ein Lehrgedicht über Vulkanismus in mindestens 645 Versen, stammt nach heutigen Erkenntnissen nicht von ihm; das Werk ist wohl erst in der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden.
Horaz, Ars poetica
Lehrdichtung als Kleinform bietet Horaz’ Ars poetica (Dichtkunst); die Schrift trägt Briefcharakter und ist auch im freundschaftlichen Gesprächston und in der aufgelockerten Organisation des Stoffs eher der Gattung der saturae (vermischte Schriften) verpflichtet. Aemilius Macer verfasste in Nachahmung Nikanders ein Lehrgedicht über den medizinischen Nutzen von Pflanzen und ein weiteres über Heilmittel gegen Tiergifte; beide Werke sind, wie auch seine Ornithogonia, eine Sammlung von Mythen zur Aitiologie der verschiedenen Vögel, verloren.
Ovids elegische Lehrdichtung
Ovids Ars amatoria (Liebeskunst) und Remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe) geben sich schon durch das elegische Versmaß (Hexameter und Pentameter) als hybride Form zwischen Lehrdichtung und Elegie zu erkennen; auch in den Fasti, die dem römischen Festkalender und den Sternzeichen gewidmet sind, weicht Ovid der strengen Form der hexametrischen Lehrdichtung aus und entfaltet sein Thema – die Feste und Bräuche der Römer und ihre mythischen oder historischen Ursachen – in dem etwas leichteren und persönlicheren Ton der Elegie; hierin folgt er dem elegischen aitiologischen Gedicht des Kallimachos, den Aitia.