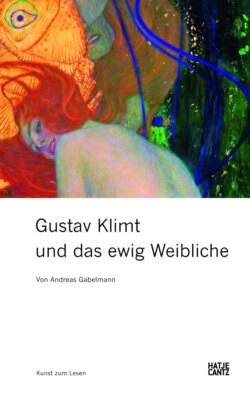Читать книгу Gustav Klimt und das ewig Weibliche - Dr. Andreas Gabelmann - Страница 4
ОглавлениеOuvertüre im Burgtheater – Anfang und Aufbruch
Alle wollen mit aufs Bild: Mehr als 200 Persönlichkeiten der Wiener Gesellschaft drängen sich auf dem großen Gruppenporträt, das Gustav Klimt 1888 vom Zuschauerraum des alten Burgtheaters malt. Es gilt, das Schauspielhaus vor dessen Abriss zu verewigen – natürlich nicht ohne Publikum. Den Auftrag erhält der Maler vom Kaiser höchstpersönlich. Klimt kann sich vor Anträgen der Wiener kaum retten. Für die Vielzahl der Gesichter nutzt er hauptsächlich Porträtfotografien. Der mit 400 Gulden dotierte Kaiserpreis ist dann die Auszeichnung für diese Arbeit. Es entsteht ein Schlüsselbild der Wiener Gesellschaft des Fin de Siècle und ein erster Markstein in Klimts Bildniskunst. Vor allem die Damen aus dem gehobenen Bürgertum buhlen um die Gunst des Künstlers, gilt es doch, in eleganten Roben »bella figura« zu machen und das Ansehen auf der gesellschaftlichen Bühne zu festigen. Mit diesem festlich inszenierten Gesellschaftspanorama setzt Klimt ein erstes fulminantes Zeichen seiner Malerei. Der Künstler aus einfachsten, bitterarmen Verhältnissen erhält Zutritt zu den Kreisen der Schönen und Reichen.
Die Anfänge für diesen Erfolg reichen weiter zurück. Aufgrund seiner zeichnerischen Begabung 1876 im Alter von nur 14 Jahren an die Kunstgewerbeschule gekommen, freundet sich Klimt mit dem Kommilitonen Franz Matsch an. Zwei Jahre später stößt sein Bruder Ernst hinzu, und die Zusammenarbeit des Trios, das vom Lehrer Julius Ferdinand Laufberger erste Aufträge erhält, entwickelt sich so erfreulich, dass die Studienkollegen 1881 die Ateliergemeinschaft Künstler-Compagnie gründen. Stilistisch orientieren sie sich am gängigen Historismus ihrer Zeit, der in der Person Makarts eine dominante Vorbildfigur hat. Nach Makarts Tod 1884 entsteht eine Lücke, in welche die vorwärtsdrängende Künstler-Compagnie stoßen kann. Das erste Großprojekt wartet 1886 mit der Gestaltung der Treppenaufgänge im neu erbauten Burgtheater von Gottfried Semper an der Ringstraße. In die allegorischen Deckengemälde zur Entwicklungsgeschichte des Theaters integriert Klimt Porträts seiner Schwestern Helene und Johanna, der Bruder Georg ist als sterbender Romeo im Theater Shakespeares zu finden. In der Darstellung des Globe Theatre in London verewigt sich der Maler zum ersten und einzigen Mal in einem Selbstbildnis. Die Anerkennung für diese Arbeit ist 1888 das Goldene Verdienstkreuz.
Ein Karrieresprung gelingt Klimt und seinen Mitstreitern der Compagnie 1890/91 mit dem Auftrag zur Ausschmückung des Treppenhauses im Kunsthistorischen Museum mit Allegorien der Kulturepochen seit dem alten Ägypten. Die Maler stehen vor der Aufgabe, die schwierigen Bildfelder über den Rundbögen mit figürlichen Darstellungen zu füllen. Das Ergebnis fasziniert noch heute: Die in höchster Sorgfalt ausgeführten Wandbilder symbolisieren meisterhaft die Epochen der Kulturgeschichte. Klar lassen sich nun die einzelnen Handschriften der Maler unterscheiden. Bei Klimts Gemälden sind sowohl Figuren als auch Hintergründe flächig ausgeführt, dabei aber strikt voneinander getrennt. In der weiblichen Personifikation der griechischen Antike schlägt der Künstler erstmals neue, ungewohnte Töne an, indem er das Mädchen aus Tanagra als moderne Frau aus dem Wien seiner Zeit präsentiert. Gesicht, Frisur und Kleidung lassen sie unmissverständlich als eine zeitgenössische Figur erscheinen. Mit ihren rötlichen Haaren und dem lasziven Blick ist das Mädchen eine Vorbotin jener Femmes fatales, die schon bald zu den legendären Frauentypen in Klimts Bildern gehören. Damit verlässt der Künstler die akademische Tradition und rückt das Weibliche, durchaus kühn und eigenwillig, aus der historischen Distanz in das Hier und Jetzt der Jahrhundertwende. Auch beginnt er damit, an den heuchlerischen Konventionen und den verkrusteten Moralvorstellungen seiner Zeit zur rütteln.
Für ihre Leistungen erhalten die drei Maler die »Allerhöchste Auszeichnung«, was eine Audienz beim Kaiser einschließt. In der Folge werden sie für würdig befunden, der renommierten Künstlerhausgenossenschaft beizutreten, und gehören damit zu den angesehensten Künstlern Wiens. Der Durchbruch ist geschafft. Die guten Verdienste ermöglichen Klimt jetzt erste Reisen, zunächst nach Salzburg, München und Krakau, 1890 auch nach Venedig. Im gleichen Jahr zieht er in die Westbahnstraße 36, wo er zusammen mit seiner Mutter und den Schwestern Klara und Hermine bis zu seinem Lebensende wohnen wird. Hatte Klimt in seiner Kindheit große Armut erfahren, so genießt er jetzt den Wohlstand. In einem Brief an seine Geliebte, das Modell Maria (Mizzi) Zimmermann, heißt es im August 1903: »Es bleibt eine üble Gemeinheit, Kapitalien anzuhäufen. Das verdiente Geld muß man trachten, rasch auszugeben.« Erstaunlich ist vor diesem Hintergrund, dass sich Klimt zeitlebens nie, wie manche Kollegen und Freunde, eine Villa im neuen Stil der Wiener Moderne erbauen lässt.
Der rasche Aufstieg wird 1892 vom Tod des Vaters und des Bruders Ernst überschattet. Die Künstler-Compagnie löst sich auf, und Gustav Klimt konzentriert sich fortan auf die Weiterentwicklung seines eigenen Stils. Nach dem schmerzlichen Verlust seines Bruders beginnt eine Zeit des Übergangs und des Reifens, in der allmählich jene Formensprache und Inhalte Gestalt annehmen, die den Künstler in den folgenden zehn Jahren in ungeahnte Höhen persönlichen Ruhms wie auch in schwere Krisen durch Anfeindungen führen sollte.