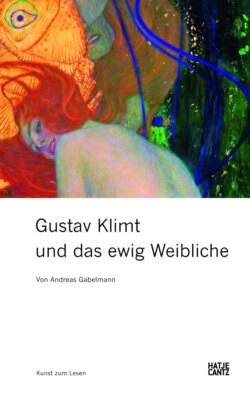Читать книгу Gustav Klimt und das ewig Weibliche - Dr. Andreas Gabelmann - Страница 5
ОглавлениеDas ewig Weibliche – Klimt und die Frauen
»Ohne Frauen, die sich seiner Kunst als Morgengabe darbringen, ist Klimt schlichtweg undenkbar. Wie ein Gewinde blühender Blumen umstehen sie gleichsam sein Werk. Wienerinnen sind es, Mädchen des Volkes und Damen der vornehmen Gesellschaft, Jüdinnen und Aristokratinnen. Er kannte sie genau, lebte gleichsam in ihrem Duftkreise. Und er wurde ihr Ruhmesverkünder.« So berichtet der Journalist Franz Servaes 1912 über den Künstler und dessen inniges Verhältnis zur Damenwelt im Wien der Jahrhundertwende. Klimts Schaffen ist im Wesentlichen den Frauen und der weiblichen Erotik gewidmet. Seine Darstellungen wollen das ganze Spektrum des Weiblichen ergründen: Heldinnen und Göttinnen, Schönheiten der Wiener Gesellschaft, Adlige und Gattinnen von Großindustriellen – dazu Aktmodelle aus den unteren sozialen Schichten. Stets entfalten sich die Frauenbilder im Spannungsfeld zwischen prachtvoller Ästhetik und schwüler Provokation und loten die Grenzen aus zwischen Porträt und Idealtypus.
Gustav Klimt hat ein enges Netzwerk an Kontakten und Beziehungen zum weiblichen Geschlecht aufgebaut, das aus einer illustren Reihe von Protagonistinnen besteht: attraktive Damen des Großbürgertums und des Adels, die er repräsentativ porträtiert, junge Modelle, die in seinem Atelier ihren erotischen Reiz versprühen, seine Mutter und die Schwestern, mit denen er zusammenlebt, und schließlich Emilie Flöge, die als Lebensgefährtin und intellektuelle Partnerin an seiner Seite steht. Aus diesem Kreis von Frauen empfängt Klimt Bewunderung, Zuneigung und Geborgenheit. Sie sichern ihm seine Existenz und stillen seine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse. So vielschichtig und geheimnisvoll wie seine Bilder sind auch seine Beziehungen zu Frauen. Als Muse und Modell, Geliebte oder Lebenspartnerin, feine Dame oder erotisches Lustobjekt sind sie untrennbar mit seinem Kunstwollen verbunden. Klimts Frauengeschichten wirken bereits zu Lebzeiten als beliebte Projektionsflächen für wilde Gerüchte und delikate Spekulationen und bieten, gerade weil er seine Person und sein Privatleben sorgsam vor der Öffentlichkeit abschirmt, reichlich Stoff für Vermutungen und Skandale, für Verehrung wie auch für Hohn und Spott. Seine Amouren sorgen für Klatsch und Tratsch im Volk wie in den Kreisen des finanzkräftigen Bürgertums, bei den Industriellen und Bankiers, die gleichzeitig Auftraggeber und Käufer seiner Bilder sind. Und schließlich ziehen Klimts Erfolge bei den Frauen und seine herausragende Stellung im Wiener Kunstleben auch Neid und Missgunst an.
Gustav Klimt ist den Frauen nicht nur als Augenmensch und Künstler, sondern auch als Mann zugetan. Ein gewisser Ruf als Verführer eilt ihm voraus, zahlreiche Affären werden ihm nachgesagt. Von den 14 unehelichen Kindern, die nach seinem Tod Erbschaftsansprüche stellen, hat er drei zu Lebzeiten anerkannt und Verantwortung für sie und ihre Mütter übernommen. Klimts großer Erfolg ist vorrangig auf seine außergewöhnlichen Frauenbilder zurückzuführen. Beim Großteil des rund 250 Gemälde umfassenden Gesamtwerkes handelt es sich um Frauendarstellungen, ferner existieren noch mehrere Tausend Aktzeichnungen. In seinen Bildschöpfungen offenbart sich eine klare Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Blick: hier die Frau als stilisierte Ikone bei offiziellen Auftragsporträts, dort die intime Erotisierung des Weiblichen hinter verschlossenen Ateliertüren.
Die bürgerliche Gesellschaft um 1900 unterliegt strikten Regeln und Normen. Die Rolle der Frau ist streng definiert und auf ihre Verpflichtungen in Ehe und Familie beschränkt. Im Gegensatz dazu existiert das Bild der Frau als Verführerin und Mätresse. Klimt zeigt in seinen Bildern beide Seiten, lässt beides gelten und zum Vorschein kommen: die sozial geachtete Dame aus besseren Kreisen und die Frau aus dem Volk. Das macht den Reiz und die Brisanz seines Werkes aus. Er beschwört einerseits den Typus der »modernen Frau« in schlanker, bisweilen androgyner Schönheit. Berta Zuckerkandl, Ehefrau des Arztes Emil Zuckerkandl, umtriebige Kunstjournalistin und mit dem Künstler gut bekannt, meint rückblickend dazu: »Man kannte den Ausdruck ›Vamp‹ noch nicht. Aber Klimt schuf den Typus einer Greta Garbo, einer Marlene Dietrich lange, ehe er Wirklichkeit wurde.« Andererseits lässt er Gestalten wie Salome oder Danaë Lust, Eros und Gefahr verkörpern. Seine Frauenbilder schweben zwischen schönem Schein und drohendem Abgrund, zwischen naturalistischer Beobachtung und abstraktem Formwillen, zwischen Ästhetisierung und Individualisierung des Weiblichen in einer Zeit des gesellschaftlichen und künstlerischen Auf- und Umbruchs.