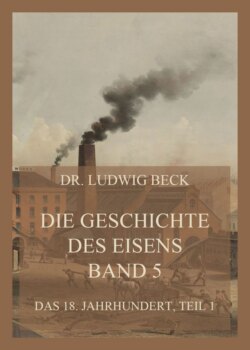Читать книгу Die Geschichte des Eisens, Band 5: Das 18. Jahrhundert, Teil 1 - Dr. Ludwig Beck - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Chemie des Eisens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
ОглавлениеDie Entwicklung der Chemie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war für die Eisenindustrie wenig förderlich. Die Phlogistontheorie, welche das 18. Jahrhundert beherrschte, erklärte die chemischen Vorgänge, auf welchen die Eisenschmelzprozesse beruhten, die Reduktion und Oxidation, falsch und wirkte dadurch nur verwirrend. Die chemische Analyse war aber noch nicht so weit gediehen, um den wichtigsten Gemengeteil des Eisens, den Kohlenstoff, nachweisen zu können.
In das erste Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts fällt zunächst ein lebhafter Streit über die Frage, ob durch die Verbrennung gewisser Körper Eisen gebildet werde oder nicht. Da man das Eisen nicht als ein Element ansah, so war eine solche Kontroverse möglich. Becher hatte die Generation des Eisens auf diesem Wege bestimmt behauptet (s. Bd. II, S. 962). Die Frage war 1702 in Paris von neuem angeregt worden, durch den Nachweis des älteren N. Lemery, dass manche Pflanzenaschen Eisen enthielten, welches sich mit dem Magneten ausziehen ließe.
St. G. Geoffroy, der bei Verbrennung gewisser Pflanzen ebenfalls eisenhaltige Asche erhielt, behauptete 1705, dass dieses Eisen erst durch die Verbrennung entstehe. L. Lemery widersprach ihm 1706, indem er nachwies, dass dieses Eisen nur aus der Pflanze bei der Verbrennung ausgeschieden sei. Geoffroy verteidigte aber seine Ansicht, indem er auf Bechers Versuch zurückgriff, wonach in dem mit Leinöl getränkten Ton nach dem Glühen mehr Eisen nachweisbar sei als vor dem Glühen. Obgleich auch dieses 1708 von dem jüngeren Lemery richtig gestellt wurde, verschwand diese Ansicht nicht ganz und wurde viel später von Justi von neuem vorgebracht.
Ebenso übten Bechers Ansichten über die Verbrennung und die Entstehung der Metalle auf die Chemiker zu Anfang des 18. Jahrhunderts, insbesondere auf Stahl, den eigentlichen Begründer der Phlogistontheorie, großen Einfluss aus. Nach Becher war die Ursache der Verbrennlichkeit jedweder Substanz im Gehalte eines gewissen Prinzipes, das er als terra pinguis bezeichnete, begründet. Diese fette Erde sei nicht identisch mit dem gemeinen Schwefel, wie die früheren Chemiker mehr oder weniger angenommen hatten, sondern auch der Schwefel enthalte nur einen größeren Anteil dieser terra pinguis. Diese sei auch in allen mineralischen Substanzen enthalten, welche verbrennlich seien und die Verkalkung der Metalle beruhe auf der Vertreibung dieser terra pinguis durch Feuer. Überhaupt sei jede Verbrennung eine Auflösung. Eine einfache Substanz könne nicht brennen. Die Feuererscheinung beruhe auf der bei dieser Auflösung eintretenden Zerteilung und Verdünnung des verbrennlichen Körpers.
Neben dieser terra pinguis gäbe es noch eine terra lapidea und eine terra mercurialis, welche drei ungefähr den früheren Elementen Schwefel, Salz und Quecksilber entsprachen. In allen Metallen seien diese drei Erden enthalten, so bestehe z. B. Eisen aus viel Salz, wenig Schwefel und noch weniger Merkur. Deshalb bildeten sich auch die Metalle in der Erde immer neu, wie schon Plinius sagte, auf Elba wachse das Eisen (gigni ferri metallum).
Becher, der bekanntlich ein sehr unruhiges, aufregendes Leben führte, fand nicht die Muße, seine Theorie so durchzuarbeiten, dass er sie auf jeden einzelnen Fall hätte anwenden können. Er beklagte dies und wünschte sich einen Nachfolger, der seine Theorie, die er nur in Umrissen mitgeteilt hatte, vervollkommnen möge. Dieser Wunsch ging in Erfüllung, indem der berühmte Mediziner Georg Ernst Stahl Bechers Ideen zu einem vollständigen System entwickelte. Gleich bei seinem ersten Auftreten stimmt Stahl in seiner 1697 erschienenen Cymotechnia fundamentalis Bechers Ansicht bei, dass der Schwefel denselben verbrennlichen Stoff enthalte, wie die Metalle und dass der Schwefel aus diesem Stoffe in Verbindung mit Schwefelsäure bestehe, gerade so wie der Metallkalk der andere Bestandteil des Metalls sei. 1702 gab er Bechers Physica subterranea neu heraus, wobei er klagt, dass das Werk so wenig Anerkennung gefunden habe. Er fügte deshalb demselben sein Spezimen Becherianum bei. In diesem wiederholte er bestimmt, dass alle verkalkbaren Metalle aus einer brennbaren Substanz und Metallkalk bestehen, dass das, was wir die Reduktion der Metallkalke nennen, ihre Vereinigung mit dieser brennbaren Substanz ist. Diese brennbare Substanz, die nicht Schwefel, noch Oel, noch Fett an und für sich, auch nicht Feuer schlechthin, sondern nur das Prinzip oder das Ursächliche desselben ist, nannte er Phlogiston. Er definiert dieses Phlogiston als materiale et corporeum prinzipium, quod solum citatissimo motu ignis fiat. Es ist die Substanz, durch deren Abscheidung die Metalle zu Kalken werden.
Diese Theorie erscheint uns nach unserer jetzigen Kenntnis der chemischen Vorgänge durchaus verkehrt und fast widersinnig und doch war dieselbe ein wesentlicher Fortschritt in der Chemie, weil sie die wichtigsten chemischen Erscheinungen von einem bestimmten und einheitlichen Gesichtspunkte aus betrachtete, prüfte und zusammenfasste. Das Phlogiston, dieses Grundwesen, die Bedingung der Verbrennlichkeit, ist in allen brennbaren Substanzen dasselbe: „es ist vor die Augen zu legen“, sagt er, „dass sowohl in dem Fett, da man die Schuhe mit schmiert, als in dem Schwefel aus den Bergwerken und allen verbrennlichen halben und ganzen Metallen in der Tat einerlei und eben dasselbige Wesen sei, was die Verbrennlichkeit eigentlich gibt und machet“; … und „es ist meines Erachtens das vernunftgemäßeste, wenn man es von seiner allgemeinen Wirkung benennt. Und dieserwegen habe ich es mit dem griechischen Namen Phlogiston, zu Deutsch brennlich, beleget.“ — Bechers Lehre von der fortdauernden Neubildung und dem Wachsen der Metalle in der Erde verwarf Stahl dagegen; nach ihm waren alle „ganghaftig befindlichen Erze, stracks von Anfang, in die allerweiteste Einteilung, Befestigung und Auszierung der Erde mit eingelegt und eingeschaffen worden“.
Stahls Phlogistontheorie fand allgemeine Anerkennung und Anwendung in Europa, wenn auch die französischen Chemiker den Ausdruck Phlogiston nicht annahmen, sondern nach wie vor statt dessen „Schwefel“ sagten, obgleich sie dabei nicht wirklichen Schwefel, sondern ebenfalls nur das verbrennliche Prinzip meinten. Zwar erhoben einzelne bedeutende Chemiker, wie namentlich Fr. Hoffmann und Boerhave, gegen Stahls Erklärung wichtiger Erscheinungen Widerspruch, dies konnte aber die Verbreitung und die Macht der Phlogistontheorie nicht einschränken. Sie war, was in mechanischen Betrieben ein besseres Werkzeug ist, und darin liegt auch ihre historische Bedeutung. Sie schloss, wie Fr. Kopp treffend sagt, einen großen Fortschritt in der Fähigkeit, chemische Erscheinungen unter allgemeineren Gesichtspunkten zu betrachten, in sich. — Mit der Phlogistontheorie trat zugleich die Chemie als ein selbständiger Teil der Naturwissenschaft auf; sie suchte die chemischen Erscheinungen, d. h. die Zusammensetzung der Körper und die chemischen Prozesse, durch welche Zusammensetzung und Zerlegung vor sich gehen und deren Gesetzmäßigkeit an und für sich zu erforschen und nicht wie seither im Dienste einer anderen Wissenschaft wie die Jatrochemie oder eines unwissenschaftlichen Zweckes, wie die Alchimie.
Stahls Ansicht über das Eisen und die unedlen Metalle überhaupt geht dahin, dass das brennliche Wesen (Phlogiston) dergestalt „den vier unedlen Metallen beigemischt sei, dass sie eben dadurch ihre ganze metallische, letztsichtbare Gestalt, Glanz, Klang, vornehmlich aber die Geschmeidigkeit durch solches erlangen. — Welches sich handgreiflich, durch deren Zerstörung aus solcher ihrer metallischen Gestalt und Wiederbringung zu derselben durch die Kunst (insgemein Reduktion genannt) bescheiniget.
a) Da nämlich die Zerstörung aus solcher ihrer metallischen Verfassung, darinnen sie im gemeinen Leben brauchbar sind, bloss durch Verglühen sich zuträgt; als wodurch dieses verbrennliche Wesen nicht anders als aus einer Kohle nach und nach ausgebrannt wird, dass das übrige einer Asche gleich zerfällt: ja auch noch darin der Kohlenasche ähnlich bleibt, dass es wie jene durch genügsamen Feuers Zwang zu einem Glas zusammenfließet. …
b) Die Wiederbringung aber zu dieser recht metallischen Gestalt, geschieht bloß durch wiederbeigebrachte Ersetzung solcherlei brennlichen Wesens; welches auch diese metallischen Aschen ganz gern und behände wieder annehmen und dadurch, so oft man nur beiderlei wiederholt, wieder zerstört und wieder ergänzt werden können.
c) Welches dann das einzige wahre Fundament des Hüttenschmelzens bei dieser Art Metallen ist; da solche nämlich durch das Rösten oder Brennen, des dabei verhafteten, schwefligen, spießglasigten oder arsenikalischen Wesens zugleich an diesem ihren eigenen brennlichen Wesen verlustig werden und zu Asche gedeihen. Dannhero, wann sie außer körperlicher Berührung der Kohlen geschmolzen werden, nichts anderes, als ein Glas geben; welches mit dem übrigen tauben Schlackenglas vermengt und darinnen zerstreut, haften bleibt. Wann aber das Schmelzen nach wohlhergebrachtem Brauch durch die Kohlen hindurch dergestalt verrichtet wird, dass auch das Schlackenglas selbst möglichst dünn fließt, so gewinnt das rechte Metallglas durch Berührung der Kohlen seine vorhin aus- und abgebrannte metallmäßige Gestalt wieder, läuft zusammen, scheidet sich von der Glasschlacke und setzt sich unter dieselbige wieder zusammen“.
Stahls Ansicht über den Unterschied zwischen Eisen und Stahl ging dahin, dass das Eisen noch erdige Teile enthalte, während Stahl mit Phlogiston gesättigt sei.
Eingehender und sachlicher beschäftigte sich Reaumur mit den Unterschieden zwischen den verschiedenen Arten des Eisens. Er erkannte deutlich, dass Stahl in Bezug auf seinen Phlogistongehalt oder, wie er sich als Franzose ausdrückt, in Bezug auf seinen Schwefel zwischen Gusseisen und Schmiedeeisen stehe. Gusseisen enthielte am meisten Schwefel, Schmiedeeisen keinen oder am wenigsten, Stahl stehe in Bezug auf den Schwefelgehalt mitten inne. Das Wort Schwefel darf uns nicht beirren, gemeint ist das brennliche Prinzip, und wenn wir statt Schwefel Kohlenstoff setzen, so haben wir die richtige Lösung. Reaumur war in seiner Theorie, die übrigens auch nur eine Erklärung beobachteter Tatsachen war, der Wahrheit bereits sehr nahe gekommen, und deswegen sind auch seine theoretischen Erklärungen meistens richtig, wenn wir uns nur durch die Ausdrucksweise nicht beirren lassen.
In Bezug auf die Reinheit des Eisens klassifizierte er die Eisensorten in anderer Reihenfolge, indem er Roheisen als das unreinste, Stahl als das reinste Eisen erklärte. Er nahm an, dass Gusseisen noch durch viele erdige Bestandteile aus den Erzen verunreinigt sei, im Schmiedeeisen seien diese zwar abgeschieden, dieses enthalte dagegen Eisenkalke, Stahl dagegen sei Eisen im reinsten Zustande der Metallizität.
Die Eisenerze sind nach Reaumurs Ansicht zusammengesetzt aus Eisen-, Erde-, Schwefel- und Salzteilen. Durch den Schmelzprozess werden die erdigen Teile von den Eisenteilen getrennt, erstere vereinigen sich mit den übrigen Verunreinigungen des Eisens zu der leichteren Schlacke, welche auf dem abgeschiedenen schweren Eisen obenauf schwimmt. Reaumur nimmt also die metallische Substanz in den Erzen als bestehend an und ist weit davon entfernt, wie Becher, zu glauben, dass dieselbe erst durch den Schmelzprozess aus der erdigen Grundmasse sich bilde. Das Roheisen ist eine noch unreine Form des Eisens, welches noch nicht vollständig von den in den Erzen enthaltenen erdigen Beimengungen getrennt ist. Als wesentlichen Bestandteil enthält es eine beträchtliche Beimengung schweflig-salziger Materie. Nach Reaumurs Auffassung bilden Gusseisen, Stahl und Schmiedeeisen eine Reihe von reiner Eisensubstanz als Grundmasse, verbunden mit mehr oder weniger schweflig-salziger Materie, und zwar in der Weise, dass Gusseisen davon am meisten, Schmiedeeisen davon am wenigsten enthält und der Stahl in der Mitte zwischen beiden steht. Gusseisen lässt sich durch Abscheiden der schweflig-salzigen Materie erst in Stahl und dann in Eisen überführen, während weiches Eisen durch Hinzufügung von schweflig-salziger Materie Stahl wird und durch Überschuss dieser Beimengung in Gusseisen übergeht. Reaumurs Auffassung stimmt also ganz mit unserer heutigen Theorie überein, wenn wir nur statt schweflig-salziger Materie Kohlenstoff setzen. Die Übereinstimmung tritt noch deutlicher hervor, wenn wir ins Auge fassen, dass Reaumur unter Schwefel nicht das Element in unserem Sinne, sondern den brennbaren Teil der Holzkohle, des Rußes u. s. w. verstand.
Die Rolle, die er dem Salz zuschreibt, ist weniger verständlich. Auch die salzige Beimengung denkt er sich flüchtig. Sie dringt mit dem Schwefel in die Poren des Eisens ein. An einer Stelle sagt er, das Salz vermittle die Verflüchtigung und die Aufnahme der schwefligen Substanz. Er teilt ihm also nur eine vermittelnde Rolle zu; dennoch hält er es für einen wesentlichen Bestandteil, weshalb er seinem Zementierpulver, dessen wichtigster Bestandteil Kohle ist, Salz beimischt, obgleich er zugibt, dass Holzkohlenpulver allein die Umwandlung von Schmiedeeisen in Stahl durch Zementation bewirken kann. Aus theoretischen Gründen, die den irrigen chemischen Ansichten der damaligen Zeit entspringen, kann Reaumur der salzigen Beimengung bei den verschiedenen Eisenarten nicht entbehren, und sie spielt eine wichtige Rolle bei seiner Erklärung der Härtung des Stahles. Eisen hat, nach seiner Ansicht, eine gewisse Verwandtschaft zu der schwefligen und salzigen Materie. Glüht man deshalb Eisen in Substanzen, welche einen Überschuss dieser Materien enthalten und sie deshalb leicht abgeben (den Zementierpulvern), so nimmt das Eisen dieselben in sich auf. Umgekehrt gibt es Substanzen, welche eine stärkere Verwandtschaft zu der schwefligen und salzigen Materie haben, welche deshalb, wenn man Stahl oder Gusseisen in diesen glüht, diese weich machen (adduzieren), indem sie denselben die betreffenden Materien entziehen. Auf diesen Tatsachen beruht die Zementstahlfabrikation und die Darstellung des schmiedbaren Gusses, welche wir später näher betrachten werden.
Die Aufnahme der schweflig-salzigen Materie erhöht die Härte des Eisens. Nun tritt aber beim Stahl die eigentümliche Erscheinung ein, dass derselbe, wenn langsam erkaltet, weich, wenn rasch erkaltet, hart wird, worauf die wichtige Eigenschaft der Stahlhärtung beruht. Dies erklärt Reaumur, von seiner Theorie ausgehend, in geistreicher Weise so: Stahl enthält schweflig-salzige Materie an Eisen gebunden; durch öfteres Erhitzen verliert der Stahl seine Stahlnatur, die schweflig-salzige Substanz lässt sich also durch Glühen verflüchtigen. Ehe dies aber geschieht, tritt ein Zwischenzustand ein. Bei der Erhitzung wird die innige Verbindung des Eisens mit der schweflig-salzigen Materie aufgehoben, dieselbe scheidet sich sozusagen in flüssigem Zustande aus und füllt die leeren Räume, die zwischen den Eisenmolekülen vorhanden sind, aus. Tritt plötzliche Abkühlung ein, so wird die Substanz in diesem Zustande fixiert und bewirkt die Stahlhärte, tritt die Abkühlung langsam ein, so kehrt die schweflig-salzige Materie, wenn die Grenztemperatur wiederum erreicht ist, in ihre frühere Lagerung, beziehungsweise ihre intime Verbindung mit dem Eisen zurück. Die fixierte schweflig-salzige Verbindung denkt sich Reaumur sehr hart, er vergleicht sie treffend mit Eisenpyrit, Schwefelkies, welcher nach den Anschauungen jener Zeit auch in der Hauptsache eine schweflig-salzige Verbindung war; der Schwefel ließ sich daraus durch Erhitzen in Substanz austreiben, während durch Verwitterung Salz (Eisenvitriol) entstand. Eine ähnliche, wenn nicht dieselbe Verbindung wäre die die Eisenmoleküle umgebende, durch rasche Abkühlung fixierte Materie. Können wir diese Theorie Reaumurs auch nach dem heutigen Stande der chemischen Wissenschaft nicht als richtig anerkennen, so müssen wir doch zugestehen, dass sie geistreich ist und sehr nahe mit modernen Theorien übereinstimmt, nach denen der Kohlenstoff dieselbe Rolle spielen soll, wobei auf den allotropischen Zustand desselben als Diamant hingewiesen wird.
Reaumur hielt auch später an der Idee fest, dass der Grundstoff des metallischen Eisens ein besonderes Element sei. In der berühmten Abhandlung von de Courtivron und Bouchu: Art des Forges et fourneaux à fer in den Descriptions des Arts et Métiers, welche nach Reaumurs hinterlassenen Handschriften verfasst ist, wird dieser Gedanke noch schärfer ausgedrückt. Diese Stelle mit der Kritik des deutschen Übersetzers von Justi gibt eine interessante Illustration zu der chemischen Auffassung der Metalle in jener Zeit. Nachdem der Verfasser auf die Widersprüche der herrschenden Theorie hingewiesen hat, sagt er (Reaumur): „Wäre es nicht denkbar, dass es ebenso viele Elemente als verschiedene Metalle selbst gäbe, wovon ein jedes sein ihm eigentümliches Wesen hätte? Die metallischen Substanzen, sagt man, sind schwere, glänzende, undurchsichtige und schmelzbare Körper, die hauptsächlich aus der Verbindung einer glasartigen Erde mit dem brennbaren Wesen entstanden sind. Wir aber kommen zu dem Schluss, ein Metall ist ein schwerer, glänzender und undurchsichtiger Körper, der im Feuer schmilzt, unter dem Hammer sich treiben lässt und der aus einer glasartigen Erde, dem brennbaren Wesen und einem noch unbekannten, verborgenen und jedem Metall besonders eigenen Element besteht. Nach dieser allgemeinen Erklärung muss man insbesondere von dem Eisen sagen, es sei ein Metall, welches aus seinem eigenen Element, aus Salz und brennbarem Wesen zusammengesetzt ist, welche drei Dinge sich im gehörigen Verhältnis in einer glasartigen Grunderde verbinden und darin festgehalten werden“. Justi verwirft diese Annahme besonderer metallischer Elemente, da sie die Wahrheit nur verdunkle. „Henkel und andere vortreffliche Mineralogen haben uns gelehrt, dass ein jedes Metall seine ihm besonders eigene metallische Grunderde hat, wodurch es determiniert wird, dieses und kein anderes Metall zu werden.“
In der Röstung erblickte Reaumur eine Ausscheidung von überschüssigem Schwefel und Salz, welche sehr notwendig sei, weil sonst bei heftigem Feuer gar kein Eisen sich abscheide, sondern verbrenne.
Justi hatte von der Röstung eine viel unrichtigere Vorstellung. Nach seiner Meinung „enthalten die Eisenerze weiter nichts, als die metallische Erde des Eisens in sich und keineswegs wirkliches Eisen. Das Eisen wird erst erzeugt, wenn sich das brennliche Wesen der Kohlen mit der metallischen Eisenerde verbindet. Allein in dem hohen Ofen selbst kann sich wegen der Menge des Eisensteins und wegen der Gewalt der Blasebälge, welche eine Menge brennliches Wesen forttreiben, nicht so viel brennliches Wesen mit der Eisenerde vereinigen, als deren Menge erfordert. Es geht also ein sehr großer Teil an noch roher und noch nicht metallifizierter Eisenerde in das Gusseisen mit hinein. Daher entsteht also die große Sprödigkeit und dass sehr viele nachfolgende Bearbeitung im Feuer erfordert wird, um mit der an noch in dem Gusseisen steckenden großen Menge roher Eisenerde brennliches Wesen zu verbinden. Allein, da in diesen nachfolgenden Arbeiten diese Verbindung des brennlichen Wesens wegen des großen Klumpens von Metall nur auf der Oberfläche geschehen kann, daher so viel Hämmerns und Durchschweißens erfordert wird, um ein geschmeidiges Eisen zu machen, so sondert sich eben bei diesem Durchschweißen und Bearbeiten eine große Menge an noch unmetallifizierter Eisenerde in Schlacken davon ab. Diese geht also verloren. Man sieht aber leicht, dass nicht so viel Eisenerde unnützer Weise verloren gehen würde, wenn man schon vor dem Schmelzen in den Eisenstein brennliches Wesen zu bringen bemüht gewesen wäre. Dieses geschieht nun durch das Rösten, und zwar am besten, wenn das Rösten vermittelst schichtenweiser Versetzung mit Kohlen geschieht. Je langsamer das Feuer bei dem Rösten angeht, und je weniger heftig der Grad des Feuers ist, je mehr brennliches Wesen muss sich mit den Eisensteinen verbinden. Ich glaube sogar, wenn man die Haufen von Kohlen- und Erzschichten, wie die Meiler mit Rasen bedeckte(!) und nur vermöge anfangs schwacher Öffnungen das Feuer sehr langsam angehen ließe, dass dies die nützlichste Art des Röstens sein würde“.
Ebenso verkehrt waren Justis Ansichten über den Schmelzprozess. Herr v. Justi hat im Anhange zu seiner Übersetzung der Abhandlung von v. Courtivron und Bouchu an Stelle der Übersetzung des Swedenborg, welche er weggelassen, einen mageren Ersatz geboten in der Beschreibung des Baruther Hochofens durch den Grafen von Solms-Baruth und einem sehr mittelmäßigen Aufsatz über das Eisenhüttenwesen im Allgemeinen von ihm selbst. Er beweist darin nicht nur sehr oberflächliche praktische Kenntnisse, sondern entwickelt auch ganz verkehrte theoretische Ansichten. Dieselben würden keine Beachtung verdienen, wenn v. Justi nicht doch eine gewisse Autorität im vorigen Jahrhundert genossen hätte, allerdings weniger in Fachkreisen als bei dem sogenannten gebildeten Publikum.
Seine Grundanschauung von der Natur des Eisens und der Erze war eine durchaus falsche. Nach seiner Ansicht kann „eine jede gemeine Erde eine metallische Eisenerde werden“, durch die Einwirkung mineralischer sowohl als vegetabilischer Säuren. Die Erze im Boden sind in dieser Weise entstanden. Die Raseneisensteine dienen ihm als Beispiel, denn diese sind nach seiner Behauptung entstanden und entstehen noch fortwährend durch die Einwirkung vegetabilischer Säure auf gemeine Erde oder Schlamm!
Das Ausschmelzen der Erze zu Eisen ist nach seiner Annahme Austreibung der Säure und Aufnahme von brennlichem Wesen, welches sich mit der Eisenerde verbindet und dadurch zu Metall wird. Nach seiner Ansicht ist es „eine sehr lächerliche Einbildung, wenn man glaubt, dass Zuschläge den Fluss der Eisenerze in der Tat befördern können“. „Der eigentliche Endzweck und Nutzen der sogenannten Flusssteine ist, dass sie das überflüssige Saure der Eisenerze in sich schlucken. Sie bewirken also, dass die metallische Eisenerde desto leichter von dem Sauren befreit wird, sich mit dem brennlichen Wesen vereinigt und in einen metallischen König gehen kann; dahingegen, wenn man diesen Zusatz nicht brauchet, viele Eisenerde, die noch mit dem Sauren verbunden ist, in den Schlacken bleibt. Sie sind also mehr ein Niederschlagungsmittel, als eine Sache, welche den Fluss und das leichtere Schmelzen befördert.“
Der Grund, warum so viele Erze ein sprödes, weißes Eisen, welches er für verunreinigt hält, geben, ist der, dass „die Eisenerze von Natur Dinge in ihrer Grundmischung haben, welche, wenn sie nicht davon geschieden werden, allemal ein sprödes Eisen verursachen. — Diese natürlichen Fehler der Eisenerze sind hauptsächlich dreierlei. Sie führen entweder eine Säure und zuweilen einen wirklichen Schwefel bei sich, oder sie sind arsenikalisch, oder sie sind mit anderen Halbmetallen verunreinigt“.
Nun wird in der weiteren Ausführung dem Arsenik eine Verbreitung und eine Rolle zugeschrieben, die nur in der Phantasie des Verfassers existiert. Es war die bequeme Argumentation jener Zeit, wenn etwas nichts taugte, wenn es nicht nach Wunsch geriet, so war das abscheuliche Arsenik daran Schuld, welches ähnlich wie der Schwefel überall dabei sein musste. Natürlich fiel es keinem dieser großen Chemiker ein, jemals die Anwesenheit des Arseniks in Substanz nachzuweisen, oder nur danach zu suchen. Seine Anwesenheit war genügend dadurch erwiesen, dass die Sache nichts taugte. Dass solche verschrobene Theorien die Praxis nicht fördern konnten, bedarf keiner Versicherung. Theoretiker wie Justi haben mehr geschadet als genützt.
Auf sichererer Grundlage arbeiteten dagegen die schwedischen Chemiker, welche namentlich die Mineralchemie förderten. Brandt, der verdienstvolle Untersuchungen über die Verbindung des Eisens mit anderen metallischen Substanzen angestellt hat, kam mit seinen Ansichten über die Natur des Stahls der Wahrheit schon ziemlich nahe.
Brandt sagt 1751 über die Umwandlung von weichem Eisen in Stahl: „wenn das eigentümliche brennbare Wesen des Eisens durch den Zusatz solcher Materie vermehrt wird, die eine ziemlich feuerbeständige Fettigkeit enthalten, als Hörner, Klauen und dergleichen, welche in verschlossenen Gefäßen ihre fette Kohlenschwärze bei sich behalten und damit verschlossen geglüht wird, so wird Stahl daraus“.
Die phlogistische Schule nahm bereits an, dass sich das Eisen in verschiedenen Verhältnissen mit dem Phlogiston vermischen könne, da sie aber die Wage und damit die quantitative Bestimmung nicht kannte, war das Alles, was sie über die verschiedenen Oxidations- und Kohlungsstufen des Eisens zu sagen wusste.
Erwähnenswert ist noch die Entdeckung des Berliner Blaus durch Dippel im Anfange des 18. Jahrhunderts. Nach Stahls Mitteilung von 1731 soll dieselbe dem Zufalle zu verdanken gewesen sein. Erst 1725 wiesen der englische Chemiker John Brown und der Franzose St. F. Geoffroy nach, dass das Eisen die färbende Substanz im Berliner Blau sei. — Großes Aufsehen erregte der Nachweis des Eisengehaltes im roten Blute, welchen der Italiener Menghini in den Denkschriften der Akademie zu Bologna 1747 veröffentlicht hatte. Nach seinen Ermittlungen berechnet sich der Eisengehalt eines Menschen mit 25 Pfd. Blut auf 6 Loth = 100 g.
Die Probierkunst hatte in Bezug auf die Bestimmung des Eisens besondere Verbesserungen nicht erfahren, man bediente sich nach wie vor der trockenen Probe.
Christian Carl Schindler unterscheidet in seiner metallischen Probierkunst (Dresden 1697) folgende Eisenerze:
Brauneisenstein, Roteisenstein, Glaskopf (Blutstein), „weißer Eisenstein, sieht weiß wie ein Spat und gibt gut Eisen und gelber Eisenstein, sieht wie eine gelbe Erde aus“.
Eisen- und Stahlstein zu probieren, gibt er folgende Vorschriften: Nimm den Eisen- oder Stahlstein, reibe ihn klein, wiege dessen 2 Zentner (Probierzentner) und röste ihn wohl und gut. So er erkaltet, so teile ihn. Zu solchem einem Teil nimm 2 Zentner schwarzen Fluss, 1 Zentner Salarmoniak, einen halben Zentner Glasgalle und einen halben Zentner klein geriebene Kohlen, solches wohl untereinander vermenget, mit Salz bedeckt und eine starke Viertelstunde wohl zugeblasen.
Oder: 1 Zentner gerösteten Eisenstein, 1 Zentner Bleiglas, 2 Zentner schwarzen Fluss von 2 Teilen Salpeter und einem Teil Weinstein und einen halben Zentner kleingeriebene Kohlen.
Oder: Nimm alten stinkenden Urin zwei Maß, tue darin eine Hand voll pulverisierten Weinstein und auch soviel Glasgalle oder Pottasche, solches wohl eingesotten, bis es hart wird, dann klein gerieben und auf einen Zentner gerösteten Eisenstein 6 Zentner dieses Flusses genommen, mit Salz bedeckt und bei einer starken Viertelstunde wohl angesotten, so bekommst Du seinen Gehalt.
Im Jahre 1739 gab Johann Andreas Cramer seine Docimasia zu Leyden in Holland heraus, welche 1743 verbessert als Elementa Artis Docimasticae, die auch in die englische und französische Sprache übersetzt wurden, erschien. Er verwirft die Probe mit dem Magneten und bemerkt zur Tiegelprobe, dass dieselbe nicht so zutreffend sei wie bei den anderen Metallen. „Es gehört ein sehr heftiges und langandauerndes Feuer dazu, wenn das sämtliche reduzierte Eisen in ein dichtes Korn gehen soll. Da man nun kein sicheres Kennzeichen hat, wann solches geschehen ist und vom Eisen gar bald ein Merkliches wieder in die Schlacken gehet, wenn mit dem Feuer länger als nötig fortgefahren wird, so bleibt diese Probe allemal ungewiss.“ Das Korn untersucht man mit einem Hammer auf einem kleinen Amboss und erkennt dann leicht, ob das Eisen gar oder grell ist.
Die trockene Probe gab nie den wirklichen Eisengehalt, sondern den Gehalt von Roheisen, der sich aus dem betreffenden Erz ausschmelzen ließ.