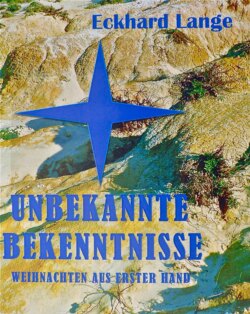Читать книгу Unbekannte Bekenntnisse - Eckhard Lange - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER PRIESTER (Lukas 1, 5-25. 39-45. 57-68)
ОглавлениеWas soll ein Mann schon sagen, wenn zwei Frauen miteinander reden! Da kommt er beim besten Willen meist nicht zu Wort. Sie haben sich ja immer so viel zu erzählen. Und zugegeben - diesmal stimmte das auch wirklich.
Gut, ich konnte an jenem Tag sowieso nicht reden. Etwas hatte mir die Sprache verschlagen. Wer kann denn auch so ohne weiteres glauben, daß er doch noch einmal Vater werden soll, wenn die Frau schon in die Wechseljahre gekommen ist! Aber eben das war geschehen, und Elisabeth, meine Frau, war zwar erstaunt und erschrocken, und vielleicht auch besorgt, ob die Geburt noch so problemlos verlaufen würde wie bei jüngeren Frauen, aber sie war dennoch glücklich.
Ich aber war verstummt. Spätere haben daraus eine Strafe Gottes gemacht, weil ich dieser Ankündigung nicht den erforderlichen Glauben geschenkt hätte, aber damit wollten sie das Unerklärliche erklären, erfanden gar so eine Art Streitgespräch zwischen mir und einem Engel, als ob ich mich unterhalten würde wie mit einem Nachbarn auf der Straße! Ich weiß es besser: Ich hatte eine Begegnung dort im Tempel, als ich dem Ritual gemäß das Rauchopfer vollzog, eine Erscheinung, ein Erlebnis, das schwer zu beschreiben ist. Ich will es dennoch versuchen:
Ich spürte die Nähe, ohne zu sehen; ich fühlte eine Botschaft, ohne zu hören. Eigentlich ja etwas ganz und gar Selbstverständliches, wenn man so direkt seinen Dienst vor dem Höchsten - gelobt sei sein Name! - verrichtet. Und doch war es unerwartet, erschreckend und furchteinflößend, wenn es dann Wirklichkeit wird.
Versteht es richtig, meine Freunde: Das ist das Zwiespältige, Bedrückende an unserem priesterlichen Dasein: Wir treten vor den Altar, stellvertretend für all die anderen, die draußen bleiben müssen, weil die Nähe Gottes erschreckend, gefährlich, ja unerträglich ist für den Menschen. Und doch dürfen, ja müssen wir Priester vor ihn treten, mit ihm kommunizieren, wie ihr es wohl nennen würdet. Eigentlich ein Wagnis - jedes Mal von neuem. Wir setzen uns der Gefahr aus, verbrannt zu werden vom Feuer seiner Gegenwart, vernichtet zu werden als Sterbliche, als Unwürdige, mögen wir uns auch noch so gut gerüstet haben für diesen Dienst. Wir begeben uns in eine tödliche Bedrohung, und doch tun wir es Jahr für Jahr immer wieder von neuem, wenn unser Dienst ansteht und das Los uns dazu bestimmt. Wir tun es routiniert, nach jahrhundertealtem Ritus, und das besagt ja, daß es ungefährlich ist.
Wer priesterlich wirkt, muß also wohl im Laufe der Zeit unweigerlich zum Zweifler werden; statt der bedrohlichen Nähe Gottes erlebt er nichts als das Alltägliche: den Altar, auf dem er das Opfer vollzieht als Gabe für den Höchsten, den heiligen Raum, der doch die Gegenwart des Allmächtigen umfaßt – und doch nichts weiter als Steine, als Dunkelheit und weihrauchgeschwängerte Luft. Und dort vollziehen wir Tag um Tag das ewig gleiche Ritual, begleitet von ewig gleichen Sprüchen, verbrennen wir ein ewig gleiches Gemisch wohlriechender Essenzen. Wir nennen es Gottesdienst, Dienst für den Allerhöchsten, den Einzigen und Ewigen, aber wir tun es mit der gleichen Routine und der gleichen Sorgfalt, wie der Schmied eine Pflugschar hämmert oder dein Weib einen Brotfladen backt. Wir tun es vielleicht nicht gleichgültig, aber gleichmütig, vielleicht in Ehrfurcht, aber ohne besondere Furcht. Wir nehmen die Nähe Gottes hin, ohne davor noch zu erschrecken.
Für die da draußen sind wir Berufene, Auserwählte, Mittler ihrer Gebete, Mittler auch der Gnade, die der Allmächtige ihnen zuwendet, wenn wir nach vollzogenem Opfer ihnen den Segen zusprechen. Aber hier drinnen sind wir wie Arbeiter, die ihr Tagwerk tun, so wie sie es gelernt haben und wie es von ihnen erwartet wird.So ging es auch mir: Ich trat wie stets vor den Altar des Höchsten, ohne doch seine Nähe zu spüren; ich erflehte im Gebet die Wiederkehr des Propheten Elia, damit er Gottes Erscheinen verkünden möge und sein Volk sich rüste zu seinem Empfang, aber ich erwartete sie nicht, jetzt und hier und mitten in unserem alltäglichen Leben, natürlich nicht.
Bis zu jenem Tag war ich ein Priester wie all die anderen vor und neben mir, nur in einem war ich anders: kinderlos geblieben und damit ausgegrenzt aus unserem Volk, weil es all seine Hoffnungen ja weitergeben mußte an Kind und Kindeskind. Ich aber hatte daran keinen Anteil, bei mir würde die Hoffnung zu Ende sein mit meinem Tod.
Doch dann geschah das, wovon ich berichten wollte: Plötzlich war diese Nähe da. Ich spürte sie mit allen Zellen meines Körpers – erschrocken, entsetzt, zitternd vor Furcht. Es bedurfte keines Opfers, keines Gebets, keiner geheiligten Handlung, um das Heilige in mir und um mich zu wissen, alles erfüllend, alles verschlingend, meine ganze Existenz erfassend und zugleich auflösend in einem anderen Sein. Ich erfuhr, was ich früher nur gleichmütig angenommen hatte als eine erlernte Wahrheit: Daß der Ewige da ist inmitten unserer Endlichkeit, daß er für mich da ist, mich ergreift, mich fordert, mir begegnet. Ich erfuhr, daß jenes so oft routiniert daher gesprochene Gebet um Sein Kommen wirkmächtig ist, daß das Zukünftige Gegenwart wird, daß Verheißung sich erfüllt, hier und jetzt in dieser Stunde. Diese Nähe war wie Sterben, und sie war doch zugleich Leben ohne Tod, ohne Ende.
Nein, ich habe kein Zeichen gefordert wie ein mißtrauischer Händler, ehe er die Ware annimmt. Das Zeichen ist über mich gekommen, weil es sein mußte. Ich bin verstummt, weil es keiner Gebete mehr bedurfte, keines Segens, keiner Ansage, weil alles gesagt war im Schweigen dieser Gegenwart, in der stummen Beredheit der Ewigkeit: Weil ER da ist, wird er kommen. Darum werde ich einen Sohn haben, es zu verkünden. Es ist ja nicht mein, sondern sein Auftrag.
Ich wußte es, ich wußte es einfach: ER wird kommen, und da muß einer sein, der ihn ankündigt, wie ein Herold das Kommen eines Königs verkündet. Er wird die Gnade ausrufen, anders, als ich dem Volk den Segen zuspreche, ganz anders. Er wird die Gnade des Nahenden bezeugen, und so wird er darum auch heißen: "Gott ist gnädig", Jochanan. Ich wußte es. Ich wußte es, weil es SEIN Wille war, und weil sein Wille mich ergriffen, umhüllt, erfüllt hatte. Es gab nichts mehr zu sagen. Es würde geschehen.
So blieb ich stumm, während das Kind heranwuchs im Leib seiner Mutter. Und ich blieb stumm, als Maria, schwanger wie sie, in unser Haus trat. Ich sah ihre Freude, und ich verstand sie, aber es war eine andere Freude als ich sie empfand. Frauen freuen sich anders, das ist wahr, denn sie müssen auch leiden und Schmerzen empfinden, wenn sie gebären. Aber sie spüren auch dieses neue Leben anders, als wir Väter es vermögen. Es ist ja Leben in ihnen, Leben im Leben, Leben aus Leben. So ließ ich sie beide allein, als sie über ihre Kinder sprachen, denn von Marias Kind wußte ich nichts.
Erst später, viel später, als unser Sohn geboren war, als ich dieses Zeichen göttlicher Gnade in den eigenen Händen hielt, da brach es aus mir hervor, wie die lange versiegte Quelle im Bergland wieder sprudelt, wenn der Frühregen das Land befeuchtet. Da mußte ich den, der nun allem Volk nahekommen wollte, mit lauter Stimme rühmen, seine Nähe preisen, die ich erfahren hatte und die nun alle erfahren würden. Nein, ich kannte die Zukunft nicht. Ich wußte nichts von dem, was mein Sohn einmal sagen und tun würde. Und ich wußte auch nichts über das Kind, das Maria zur Welt bringen würde. Ich wußte nur dieses eine: Daß unser Gott nicht fern ist, erhaben und groß, aber fern von uns, sondern daß er nahe ist, so unendlich nahe, wie er unendlich ewig ist.