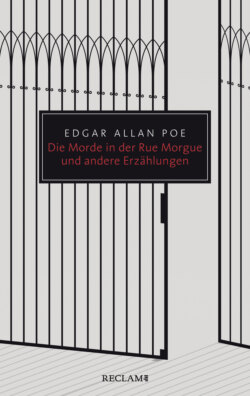Читать книгу Die Morde in der Rue Morgue und andere Erzählungen - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ligeia
ОглавлениеUnd darin liegt der Wille, der nicht stirbt. Wer kennt die Geheimnisse des Willens mit seiner mächtigen Kraft? Denn Gott ist nichts als ein machtvoller Wille, der alle Dinge aufgrund seiner Stärke durchdringt. Der Mensch unterwirft sich den Engeln oder dem Tode einzig nur durch die Schwäche seines kraftlosen Willens.
JOSEPH GLANVILL33
Selbst um meines Seelenheils willen vermag ich mich nicht zu erinnern, wie, wann oder auch nur genau wo ich zuerst die Bekanntschaft der Lady Ligeia machte. Lange Jahre sind seither vergangen, und mein Erinnerungsvermögen ist geschwächt durch tiefes Leid. Oder vielleicht kann ich mich dieser Umstände jetzt nicht mehr erinnern, weil der Charakter meiner Geliebten, ihre seltene Gelehrsamkeit, ihre einzigartige und doch sanfte Form der Schönheit und die hinreißende und fesselnde Beredtheit ihrer leisen, melodiösen Sprache wahrlich ihren Weg mit so beharrlichen und verstohlenen Schritten in mein Herz fanden, dass mir alle äußeren Umstände unbemerkt und unbekannt blieben. Doch mir deucht, dass ich ihr erstmals und dann recht häufig in irgendeiner großen, alten, verfallenden Stadt am Rhein begegnet bin. Von ihrer Familie – ja, da hörte ich sie sprechen. Dass sie unvordenklich alten Ursprungs war, kann nicht bezweifelt werden. Ligeia! Ligeia! Vergraben in Studien einer Art, die mehr als alles andere dazu angetan sind, die Eindrücke der Außenwelt verlöschen zu lassen, genügt mir dies eine süße Wort allein – Ligeia –, um vor meinen Augen das Bild von ihr heraufzubeschwören, die nicht mehr ist. Und jetzt, da ich dies schreibe, flammt die Erinnerung auf, dass ich von ihr, meiner Freundin und Verlobten, der Gefährtin meiner Studien und schließlich der Vermählten meines Herzens, den Familiennamen nie gekannt habe. War es eine spielerische Herausforderung meiner Ligeia? Oder war es eine Prüfung für die Stärke meiner Zuneigung, dass ich keine Nachforschungen in dieser Sache anstellen würde? Oder war es eher eine Laune meinerseits – eine wild-romantische Gabe auf dem Altar äußerster leidenschaftlicher Hingabe? Ich erinnere mich nur verschwommen der Tatsache selbst – was Wunder, dass ich die Umstände, die sie herbeiführten oder begleiteten, gänzlich vergessen habe? Und wahrlich, wenn je der Geist der Romanze – wenn je die bleiche und nebelflüchtige Ashtophet34 des götzendienerischen Ägypten, wie die Sage es will, über eine dem Unheil geweihte Ehe geherrscht hat, so sicherlich über der meinen.
Doch da ist ein teures Angedenken, bei dem mich mein Gedächtnis nicht verlässt. Es gilt dies der Person Ligeias. Von Statur war sie hochgewachsen, eher schlank, und in ihren letzten Tagen sogar abgezehrt. Ich würde vergeblich die Majestät, die gelassene Ruhe ihres Auftretens oder die unbegreifliche Leichtigkeit und Geschmeidigkeit ihres Ganges zu beschreiben suchen. Sic kam und ging wie ein Schatten. Nie bemerkte ich ihr Eintreten in mein abgeschiedenes Studierzimmer, bis ich die geliebte Musik ihrer sanften, süßen Stimme vernahm und sie ihre Marmorhand auf meine Schulter legte. Was die Schönheit des Antlitzes betrifft, so war ihr keine andere ebenbürtig. Es war die strahlende Erscheinung eines Opiumtraums – eine hochfliegende, geistbeflügelnde Vision, wilder und göttlicher noch als die Traumgesichte, die um die schlummernden Seelen der Töchter von Delos35 schwebten. Doch waren ihre Züge nicht von jener Regelmäßigkeit, die man uns fälschlicherweise in den klassischen Arbeiten der heidnischen Bildhauer zu verehren gelehrt hat. »Es gibt keine exquisite Schönheit«, sagt Bacon, Lord Verulam, wo er zutreffend von allen Formen und Genera des Schönen spricht, »ohne etwas Befremdliches in den Proportionen.«36 Doch wenn ich auch sah, dass die Züge Ligeias nicht von klassischer Regelmäßigkeit waren – wenn ich auch wahrnahm, dass ihre Schönheit in der Tat »exquisit« war, und empfand, dass viel »Befremdliches« sie durchdrang, so suchte ich doch vergebens, die Unregelmäßigkeit zu entdecken und meine Empfindung von der »Befremdlichkeit« auf ihren Ursprung zurückzuführen. Ich betrachtete eingehend die Kontur der hohen und bleichen Stirn: sie war ohne Fehl – wie kalt war in der Tat schon das Wort, wenn man es auf etwas so göttlich Erhabenes anwandte! –, die Haut wie von reinstem Elfenbein, die gebieterische Höhe und Ruhe, die sanfte Wölbung über den Schläfen; und dann das rabenschwarze, das schimmernde, das wallende und naturgelockte Haargeflecht, das so ganz den vollen Sinn des Homerischen Epithetons »hyazinthenartig« erfüllte. Ich betrachtete die delikaten Linien der Nase – und nirgendwo, außer in den anmutigen Medaillons der Hebräer, hatte ich je eine ähnliche Vollendung gesehen. Da war die gleiche wundervolle Sanftheit, die gleiche, kaum merkliche Tendenz zur Krümmung, der gleiche harmonische Schwung der Nasenflügel, der den freien Geist verriet. Ich sah den hinreißenden Mund an. Hier feierte in der Tat alles Himmlische Triumphe: der herrliche Schwung der kurzen Oberlippe, der sanfte, sinnliche Schlummer der Unterlippe, die verspielten Grübchen, die ausdrucksvolle Farbe, die Zähne, die mit einer fast bestürzenden Brillanz jeden Strahl des heiligen Lichts widerspiegelten, der ihnen zufiel in Ligeias heiterem und gelassenem, doch auch frohlockend-strahlendstem aller Lächeln. Ich erforschte die Form des Kinns – und auch hier fand ich die milde Fülle, die Sanftheit und Majestät, die Weite und Geistigkeit des Griechischen – jene Kontur, die der Gott Apoll dem Kleomenes37 dem Sohn Athens, nur im Traum entdeckte. Und dann versenkte ich mich tief in Ligeias große Augen.
Für die Augen haben wir keine Vorbilder selbst in entferntesten Zeiten. Es mag auch sein, dass in diesen Augen meiner Geliebten das Geheimnis lag, auf das Lord Verulam anspielt. Sie waren, so muss es mir scheinen, weit größer als die gewöhnlichen Augen unseres Menschengeschlechts. Sie waren sogar intensiver als die intensivsten Gazellenaugen beim Stamme des Tals von Nourjahad.38 Doch geschah es nur zuweilen, in Augenblicken höchster Erregung, dass diese Besonderheit auffallend bei Ligeia hervortrat. Und in solchen Augenblicken war ihre Schönheit – vielleicht erschien es auch nur meiner überhitzten Phantasie so – die Schönheit von Wesen, die überirdisch oder doch unirdisch sind, die Schönheit der sagenumwobenen Huri39 der Türken. Die Farbschattierung der Augen war ein tief strahlendes Schwarz, und weit über sie herab senkten sich lange, pechschwarze Wimpern. Die Brauen, leicht unregelmäßig in ihrem Schwung, zeigten den gleichen Farbton. Das »Befremdliche« jedoch, das ich in ihren Augen fand, lag nicht in der Form oder der Farbe oder dem Glanz und musste wohl auf ihren Ausdruck zurückgehen. Ach, Wort ohne tiefere Bedeutung, hinter dessen anspruchsvollem bloßen Klang wir unsere Unkenntnis von so viel Geistigkeit verbergen. Der Ausdruck von Ligeias Augen! Wie habe ich lange Stunden darüber nachgesonnen! Wie habe ich eine ganze Mittsommernacht hindurch gebebt, ihn zu ergründen! Was war es – dieses Etwas, das unergründlicher war als der Brunnen des Demokritos40 –, das tief in den Pupillen meiner Geliebten verborgen lag? Was war es nur? Ich war besessen von der Leidenschaft, es zu ergründen. Diese Augen! Diese großen, schimmernden, himmlischen Gestirne! Sie wurden für mich zum Zwiegestirn der Leda41, und ich für sie zum andächtigen Sternendeuter.
Unter den vielen Unbegreiflichkeiten der Wissenschaft von der Seele ist kein Punkt faszinierender und aufregender als die Tatsache – von der Schulweisheit, so glaube ich, nie entdeckt –, dass wir uns in unseren Versuchen, etwas längst Vergessenes ins Gedächtnis zurückzurufen, oft geradezu an der Schwelle zur Erinnerung befinden, ohne doch am Ende in der Lage zu sein, uns wirklich zu erinnern. Und wie oft habe ich gerade so in meiner intensiven Versenkung in Ligeias Augen das volle Wissen um ihren Ausdruck sich nähern gespürt – sich nähern, doch noch nicht ganz mein – und so am Ende sich wieder gänzlich entziehen! Und ich fand (seltsames, o seltsamstes aller Geheimnisse!) einen Kreis von Analogien für jenen Ausdruck in den alltäglichsten Gegenständen der Welt. Ich will sagen, dass unmittelbar nach der Zeit, als Ligeias Schönheit mich überwältigt hatte und in mir wie in einem Schrein ruhte, viele Erscheinungen der dinglichen Welt ein Gefühl in mir auslösten, wie es mich immer wieder angesichts ihrer großen und leuchtenden Augen überkam. Doch konnte ich deswegen jenes Gefühl nicht besser definieren oder analysieren oder auch nur ständig im Blick behalten. Ich bemerkte es, so darf ich wiederholen, beim Anblick der aufstrebenden Weinrebe, bei der Betrachtung eines Nachtfalters, eines Schmetterlings, einer Schmetterlingspuppe, eines dahinfließenden Stroms. Ich habe es im Ozean gespürt oder im Fallen einer Sternschnuppe. Ich habe es im Blick von sehr, sehr alten Menschen gefunden. Und es gibt ein oder zwei Sterne am Himmel (einer insbesondere, ein Stern sechster Größenordnung, doppelt und wechselvoll, nahe dem großen Stern in der »Leier«), bei deren Beobachtung durchs Teleskop ich des Gefühls gewärtig wurde. Es hat mich ergriffen bei gewissen Klängen von Saiteninstrumenten und nicht selten auch bei der Lektüre von Büchern. Unter zahllosen anderen Beispielen erinnere ich mich an eine Stelle in einem Band von Joseph Glanvill, die (vielleicht nur wegen ihrer Wunderlichkeit – wer vermag dies schon zu sagen?) nie verfehlt hat, dieses Gefühl in mir zu erwecken: «Und darin liegt der Wille, der nicht stirbt. Wer kennt die Geheimnisse des Willens mit seiner mächtigen Kraft? Denn Gott ist nichts als ein machtvoller Wille, der alle Dinge aufgrund seiner Stärke durchdringt. Der Mensch unterwirft sich den Engeln oder dem Tode einzig nur durch die Schwäche seines kraftlosen Willens.«42
Lange Jahre und ständiges Nachsinnen haben mich dahin gebracht, tatsächlich eine entfernte Verbindung zwischen diesem Zitat des englischen Moralisten und einem Zug im Charakter Ligeias aufzuspüren. Die Intensität des Denkens, Handelns oder Redens war möglicherweise bei ihr ein Ergebnis oder doch wenigstens ein Indiz jener gigantischen Willenskraft, die während unseres langen Zusammenlebens versäumte, auf andere, unmittelbare Weise Zeugnis von sich abzulegen. Von allen Frauen, die ich je gekannt, war die äußerlich ruhige, immer gelassene Ligeia jene, die auf das ungestümste ein Opfer der heftigen Beutegier grausamer Leidenschaften war. Und von diesen Leidenschaften konnte ich mir kein Bild machen, es sei denn durch die übernatürliche Weite jener Augen, die mich zugleich begeisterten und erschreckten – durch die fast magische Melodie, Modulation, Klarheit und Ruhe ihrer so sanften Stimme – und durch die stürmische Energie (doppelt wirkungsvoll im Kontrast zur Art ihres Sprechens) der wilden Worte, die sie für gewöhnlich äußerte.
Ich habe von Ligeias Gelehrsamkeit gesprochen: sie war grenzenlos, so wie ich sie bei einer Frau nie kennen gelernt habe. Sie war äußerst bewandert in den klassischen Sprachen, und soweit sich meine eigene Vertrautheit mit den modernen Idiomen Europas erstreckte, habe ich sie nie im Irrtum gefunden. In der Tat, gab es überhaupt ein Thema der zuhöchst bewunderten, weil einfach zuhöchst dunklen, gerühmten Gelehrsamkeit der Akademie, bei dem sich Ligeia jemals im Irrtum befunden hätte? Auf welch eigene, bestürzende Weise dieser eine Zug im Wesen meiner Frau sich meiner Aufmerksamkeit just zu diesem späten Zeitpunkt wieder aufdrängt! Ich sagte, ihr Wissen sei von einer Art gewesen, wie ich es nie bei einer Frau kennen gelernt habe – aber wo lebt denn der Mann, der all die weiten Gebiete der moralischen, physikalischen und mathematischen Wissenschaften abgeschritten hätte, und dies erfolgreich? Ich sah damals noch nicht, was ich heute mit aller Klarheit sehe, dass die Errungenschaften Ligeias ungeheuer, ja überwältigend waren; doch war ich mir ihrer unendlichen Überlegenheit genügend bewusst, um mich mit einem kindlichen Vertrauen ihrer Führung durch die chaotische Welt metaphysischer Untersuchungen zu überlassen, mit denen ich mich während der frühen Jahre unserer Ehe stark beschäftigte. Mit welch großem Triumph, mit welch lebhaftem Vergnügen, mit wie viel von dem, was die Hoffnung so himmlisch macht, fühlte ich, wenn sie sich über mich beugte bei wenig betriebenen, ja wenig bekannten Studien, jene herrliche Geisteslandschaft vor mir sich entfalten, deren lange, prachtvolle und unbetretene Pfade ich endlich beschreiten würde, einem Ziel an Weisheit entgegen, das zu heilig und kostbar war, um nicht verboten zu sein!
Wie bitter war da der Gram, mit dem ich einige Jahre später sah, wie meinen wohlbegründeten Erwartungen Schwingen wuchsen und sie mir davonflogen! Ohne Ligeia war ich nichts als ein Kind, das durchs Dunkel tappt. Ihre Gegenwart, ihre Deutungen allein erhellten auf das lebhafteste die vielen Geheimnisse des Transzendenten, in die wir uns versenkt hatten. Ohne den strahlenden Schimmer ihrer Augen erschienen leuchtende und goldene Schriftzeichen trüber als saturnisches Blei. Und jetzt erhellten diese Augen seltener und seltener die Seiten, über denen ich grübelte. Ligeia erkrankte. Die wilden Augen loderten auf in einem allzu blendenden Glanz; die bleichen Hände nahmen den durchsichtig-wächsernen Farbton des Todes an, und die blauen Venen auf ihrer hohen Stirn pulsierten ungestüm im Rhythmus schon der geringsten Gemütsbewegung. Ich sah, dass sie sterben würde – und im Geiste rang ich verzweifelt mit dem erbarmungslosen Azrael43. Doch das Ringen meiner leidenschaftlichen Frau war zu meinem Erstaunen noch energievoller als mein eigenes. Es hatte viel in ihrer unbeugsamen Natur gegeben, das mir den Glauben erwachsen ließ, der Tod würde ohne Schrecken zu ihr kommen – doch weit gefehlt. Der Worte sind keine, um eine angemessene Idee von der verbissenen Entschlossenheit des Widerstandes zu vermitteln, in der sie mit dem großen Schatten rang. Ich stöhnte vor Qual bei diesem erbarmungswürdigen Schauspiel. Ich würde besänftigt, würde argumentiert haben; doch gegenüber der Tiefe ihres wilden Verlangens zu leben – zu leben – nichts als zu leben –, waren Trost und vernünftiger Zuspruch gleichermaßen von äußerster Torheit. Doch bis zum allerletzten Augenblick, im krampfartigen Aufbäumen ihres unbeugsamen Geistes, wurde die äußerliche Ruhe ihres Verhaltens nicht erschüttert. Ihre Stimme wurde noch sanfter, noch leiser – doch will ich nicht auf den wahnwitzigen Sinn ihrer ruhig gesprochenen Worte näher eingehen. Mein Geist schwindelte, als ich gebannt einer kaum noch dem Irdischen verhafteten Melodie lauschte – Höhenflügen und Hoffnungen, wie sie die Sterblichen zuvor nie gekannt.
Dass sie mich liebte, hätte ich nie bezweifelt; und ich hätte leicht wissen können, dass in einem Herzen wie dem ihren die Liebe nicht mit gewöhnlicher Leidenschaft regierte. Doch erst in ihrem Tode überwältigte mich die volle Macht ihrer Liebe. Für Stunden ohne Ende hielt sie meine Hand umschlossen und schüttete mir ihr überflutendes Herz aus, dessen mehr als leidenschaftliche Hingabe an Vergötterung grenzte. Wie hatte ich es verdient, durch solche Geständnisse gesegnet zu werden? – wie es verdient, zum Verlust der Geliebten verdammt zu werden in eben der Stunde, da sie diese Geständnisse machte? Aber ich kann es nicht ertragen, weiter davon zu sprechen. Nur eines sei mir erlaubt zu sagen, dass ich zu guter Letzt in Ligeias mehr als weiblicher Hingabe an eine Liebe, die ach so unverdient war und einem Unwürdigen galt, das Prinzip ihrer Sehnsucht erkannte, die sich mit wildem, tiefem Verlangen auf ein Leben richtete, das ihr nun so unwiderruflich entfloh. Es ist dies wilde Verlangen – es ist diese heiße Inbrunst der Gier nach Leben – nichts als Leben –, die zu schildern meine Kräfte versagen und meine Worte nicht ausreichen.
Um die Mitte der Nacht, da sie mich verließ, winkte sie mich gebieterisch an ihre Seite und bat mich, ihr einige Verse zu wiederholen, die sie vor wenigen Tagen selbst gedichtet hatte. Ich gehorchte. Es waren diese Verse:
Seht! Es ist Galanacht
Im Lauf der einsam späten Jahre!
Der Engel Schar, voll Flügelpracht, im Schmuck
Der Schleiertracht und tränenüberströmt,
Sitzt im Theaterrund, ein Schauspiel
Anzusehn voll Hoffnung und voll Furcht,
Dieweil der Chor im Wechselspiel
Den Klang der Sphären haucht.
Mimen in der Gestalt von Gott hoch oben
Murmeln und munkeln sacht
Und hasten her und hin –
Nur Puppen sie, die kommen und gehen
Ganz auf Geheiß gestaltlos vager Wesen.
Die der Szene Ort verschieben, bald hierhin, bald dorthin,
Und aus ihren Kondorschwingen entschweben lassen
Unsichtbares Weh!
Dies Narrenspiel! – seid unbesorgt,
Vergessen wird es nimmer!
Dies Trugbild, das verfolgt wird immerdar
Von einer Menge, die es nie begreift,
Die sich im Kreise dreht, der stets zurückkehrt
Zu dem immerselben Anfang,
Und dieser Wahnsinn und mehr noch diese Sünde
Und Horror die Seele des Stücks.
Doch seht, im Mittelkreis des grimassierenden Tumults
Schleicht ein Phantom sich ein!
Ein blutrot Ding, das sich entwindet
Aus ungeschauter Einsamkeit!
Es windet sich! – und windet sich! – in Todesqualen,
Die Mimen werden seine Beute,
Und die Engel schluchzen, da des Wurmes Zahn
Vor Menschenblut sich färbt.
Aus – aus sind nun die Lichter – alle aus!
Und über jede zuckende Gestalt
Fällt nieder wie ein Sturmesbrausen
Der Vorhang, gleich dem Leichentuch.
Die Engel aber, bleich und fahl,
Erheben sich, entschleiern ihr Gesicht und lassen wissen,
Dass dieses Drama die Tragödie »Mensch«
Und dass sein Held »Eroberer Wurm« geheißen.
»O Gott!«, schrie Ligeia, sprang auf und reckte ihre Arme mit einer krampfhaften Gebärde gen Himmel, als ich diese Zeilen beendete – »O Gott! O himmlischer Vater! – muss all dies unabänderlich so sein? – soll dieser Eroberer nicht ein einziges Mal selbst überwältigt werden? Sind wir nicht Teil und Bestandteil Deiner selbst? Wer – wer kennt die Geheimnisse des Willens mit seiner mächtigen Kraft? Der Mensch unterwirft sich den Engeln oder dem Tode einzig nur durch die Schwäche seines kraftlosen Willens.«
Und dann, wie überwältigt vom Gefühl, ließ sie ihre weißen Arme kraftlos fallen und kehrte feierlich auf ihr Totenbett zurück. Und als sie ihre letzten Seufzer tat, da kam, vermischt mit diesen, ein leises Murmeln über ihre Lippen. Ich neigte ihr mein Ohr zu und vernahm wiederum die Schlussworte der Stelle aus Glanvill: »Der Mensch unterwirft sich den Engeln oder dem Tode einzig nur durch die Schwäche seines kraftlosen Willens.«
Sie starb, und ich, den der Gram in den Staub niederwarf, konnte die öde Verlassenheit meiner Behausung in der dunklen, verfallenden Stadt am Rhein nicht länger ertragen. Ich hatte keinen Mangel an dem, was die Welt Reichtum nennt. Ligeia hatte mir weit mehr, sehr viel mehr hinterlassen, als für gewöhnlich den Sterblichen zufällt. Und so erwarb ich nach einigen Monaten des matten und ziellosen Wanderns in einer der wildesten und abgelegensten Gegenden des schönen England eine Abtei, deren Namen ich nicht nennen möchte, und setzte sie einigermaßen instand. Die düstere und zugleich trostlose Pracht des Gebäudes, der nahezu verwilderte Charakter des Grundstücks, die vielen melancholischen und altehrwürdigen Erinnerungen, die sich mit beiden verbanden, standen so recht im Einklang mit dem Gefühl gänzlicher Verlassenheit, das mich in diese abgelegene und ungesellige Region des Landes getrieben hatte. Und obwohl das Äußere der Abtei, überwuchert vom grünenden Verfall, nur wenig Veränderungen zuließ, widmete ich mich in kindlicher Launenhaftigkeit und vielleicht auch in der schwachen Hoffnung, meinen Kummer zu lindern, einer Ausschmückung des Innern, die mehr als königliche Pracht entfaltete. Für solche Torheiten hatte ich schon in meiner Kindheit einen Geschmack entwickelt, und nun suchten sie mich wieder heim, als ob ich vor Kummer närrisch geworden. Ach, ich fühle es, wie viel aufdämmernder Wahnsinn in den prachtvollen und phantastischen Vorhängen, in den erhabenen ägyptischen Statuen, in den wilden Simsen und Möbeln, in den wahnwitzigen Mustern der Teppiche aus dichtgewebtem Gold hätte entdeckt werden können! Ich war zum hilflosen Sklaven in den Fesseln des Opiums geworden, und meine Werke und Weisungen hatten das Kolorit meiner Träume angenommen. Doch ich sollte nicht bei der Beschreibung dieser Absurditäten verweilen. Nur von jenem einen, auf immer verfluchten Gemach lasst mich sprechen, in das ich in einem Augenblick geistiger Umnachtung vom Altare weg als meine Braut – als Nachfolgerin der unvergessenen Ligeia – die blonde, blauäugige Lady Rowena Trevanion von Tremaine führte.
Da ist kein Detail der Architektur und Dekoration dieses Brautgemachs, das mir nicht jetzt noch vor Augen stünde. Wo war das Mitgefühl der hochmütigen Angehörigen der Braut, als sie in ihrer Goldgier gestatteten, dass eine junge Frau und geliebte Tochter die Schwelle zu einem derart geschmückten Gemach überschritt? Ich sagte schon, dass ich mich an die Details des Brautgemachs sehr genau erinnere – doch überkommt mich trauriges Vergessen, was Dinge von zentraler Bedeutung anbelangt –, und hier, in dem phantastischen Prunk, gab es kein System, keinen Anhaltspunkt, der dem Gedächtnis als Anker hätte dienen können. Der Raum lag in einem hohen Turm der burgartigen Abtei, war fünfeckig und von beträchtlicher Größe. Die gesamte Südseite des Fünfecks nahm das einzige Fenster ein – eine riesengroße, ungeteilte Scheibe aus venezianischem Glas – eine einzige bleifarbene Glasfläche, so dass die Strahlen der Sonne oder des Mondes, die hindurchschienen, mit einem gespenstischen Glanz auf die Gegenstände im Inneren fielen. Über den oberen Teil dieses gewaltigen Fensters breitete sich das Rankenwerk eines uralten Weinstocks aus, der die massigen Wände des Turms emporklomm. Die Decke aus düsterem Eichenholz war hoch und gewölbt und ausgiebig mit der wildesten und groteskesten Art von Schnitzwerk halb im gotischen, halb im druidischen Stil verziert. Vom höchsten Punkt dieses melancholischen Gewölbes hing an einer einzelnen langgliedrigen Goldkette eine gewaltige Weihrauchschale, ebenfalls aus Gold, mit sarazenischen Mustern verziert und mit vielen Öffnungen versehen, die so gestaltet waren, dass eine stetige Folge bunter Flammen hinein- und herauszüngelten, als seien sie von einem schlangengleichen Leben beseelt.
Einige Ottomanen und goldene Kandelaber im orientalischen Stil standen hier und da im Raum verteilt – und da war noch die Liegestatt – das Brautbett – nach indischem Vorbild, niedrig und aus solidem Ebenholz geschnitzt, mit einem Baldachin darüber, der einem Sargtuch glich. In jeder der fünf Ecken des Raumes stand aufrecht ein gigantischer Sarkophag aus schwarzem Granit; fünf Sarkophage, die aus den Königsgräbern im Tal der Könige44 stammten und deren ehrwürdige Deckel mit uralten Skulpturen verziert waren. Aber erst in den Wandbehängen des Gemachs zeigte sich, ach, die überschwänglichste Phantasterei von allen. Die aufstrebenden Wände von gigantischer, fast schon unproportionierter Höhe waren von der Decke bis zum Boden im weiten Faltenwurf mit schweren, undurchdringlich wirkenden Wandteppichen behangen – Stoffe aus einem Material, das gleichermaßen als Teppich auf dem Boden, als Überwurf für die Ottomanen und das Ebenholzbett, als Baldachin über diesem und in den prunkvollen Windungen der Vorhänge, die teilweise das Fenster überschatteten, wiederzufinden war. Dieses Material war ein schweres Goldgewebe. Es war über und über in unregelmäßigen Abständen mit arabesken Figuren bedeckt, die etwa einen Fuß im Durchmesser aufwiesen und in tiefschwarzen Mustern in den Goldstoff gewirkt waren. Doch diese Figuren enthüllten sich nur als wahre Arabesken, wenn man sie von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtete. Durch einen heute geläufigen Kunstgriff, der sich allerdings in sehr entfernte Epochen der Antike zurückverfolgen lässt, veränderte sich ihr Anblick je nach Standpunkt. Einem Betrachter, der den Raum betrat, mussten sie wie simple Monstrositäten erscheinen; doch wenn er weiter fortschritt, änderte sich ihre Erscheinung allmählich; und Schritt um Schritt, je nach dem Standpunkt des Besuchers, sah er sich umgeben von einer endlosen Folge gespenstischer Formen, wie sie dem Aberglauben der Normannen entspringen oder in den schuldbeladenen Träumen eines Mönchs aufsteigen mögen. Der gespenstisch-flüchtige Effekt wurde dabei noch wesentlich durch einen künstlich erzeugten Luftstrom hinter den Wandbehängen erhöht, was dem Ganzen eine schreckliche und beklemmende Lebendigkeit verlieh.
In Hallen dieser Art – in einem Brautgemach wie diesem – verbrachte ich mit der Lady von Tremaine die unheiligen Stunden des ersten Monats unserer Ehe – verbrachte sie und war nur wenig beunruhigt. Dass meine Frau die stürmische Launenhaftigkeit meiner Stimmungen fürchtete, dass sie mich mied und nur wenig liebte – es konnte mir nicht entgehen; doch dies bereitete mir eher Freude als alles andere. Ich verabscheute sie mit einem Hass, der eher dämonisch als menschlich war. Meine Gedanken flohen (oh, mit welch tiefem Bedauern!) zurück zu Ligeia, der geliebten, der majestätischen, der schönen, der begrabenen. Ich schwelgte in Erinnerungen an ihre Reinheit, ihre Weisheit, ihre hehre, ja ätherische Natur, ihre leidenschaftliche und abgöttische Liebe. Nun erst entbrannte mein Geist in einem vollen und freien Feuer, das alle ihre Feuer übertraf. Im Taumel meiner Opiumträume (denn ich lag gewohnheitsmäßig in den Banden dieser Droge) rief ich immer wieder laut ihren Namen in das Schweigen der Nacht oder bei Tag durch die stillen Winkel der Bergschluchten, so, als ob ich durch das wilde Verlangen, die feierliche Leidenschaft, die verzehrende Glut meiner Sehnsucht nach der Dahingeschiedenen sie selbst wieder zurückführen könnte auf die irdischen Pfade, die sie – ach, konnte es für immer sein? – verlassen hatte.
Gegen Anfang des zweiten Monats unserer Ehe wurde Lady Rowena von einer plötzlichen Krankheit befallen, von der sie sich nur langsam erholte. Das Fieber, das sie verzehrte, ließ ihre Nächte unruhig werden. Und in ihrem verwirrten Zustand des Halbschlummers sprach sie von Lauten, von Bewegungen in und um das Turmgemach, deren Ursprung, so glaubte ich, nur im Aufruhr ihrer Phantasie zu finden war oder vielleicht in den phantasmagorischen Einflüssen des Gemachs selbst. Schließlich erholte sie sich, wurde gar wieder gesund. Doch verging nur eine kurze Zeit, ehe ein zweiter, heftigerer Anfall sie auf das Krankenbett zurückwarf; und von dieser Attacke erholte sich ihr Körper, der schon immer schwach gewesen, nie wieder ganz. Ihre Krankheitssymptome waren von Stund an alarmierend, und noch alarmierender ihre stete Wiederkehr, und sie spotteten gleichermaßen allem Wissen und allen großen Bemühungen ihrer Ärzte. Zugleich mit der Steigerung ihres chronischen Leidens, das offenkundig schon zu tief in sie eingedrungen war, um durch irdische Heilmittel noch ausgemerzt werden zu können, konnte ich nicht umhin, eine ähnliche Steigerung an nervöser Reizbarkeit sowie an Schreckhaftigkeit bei den geringsten Anlässen zur Furcht zu beobachten. Sie sprach wiederum, und jetzt häufiger und beharrlicher, von den Lauten – den kaum hörbaren Lauten – und von den ungewöhnlichen Bewegungen in den Wandbehängen; Erscheinungen, auf die sie schon vorher hingewiesen hatte.
Eines Nachts, der September zog schon herauf, lenkte sie mit mehr als gewöhnlichem Nachdruck meine Aufmerksamkeit auf dieses qualvolle Thema. Sie war gerade aus einem unruhigen Schlummer erwacht, und ich hatte halb besorgt, halb entsetzt das Mienenspiel ihrer eingefallenen Züge betrachtet. Ich saß zur Seite ihres Ebenholzbettes auf einer der indischen Ottomanen. Sie richtete sich halb auf und sprach in einem inbrünstigen leisen Flüstern von Lauten, die sie gerade jetzt hörte, die ich aber nicht vernahm – von Bewegungen, die sie gerade jetzt sah, die ich aber nicht zu sehen vermochte. Der Wind rauschte heftig-bewegt hinter den Wandbehängen, und ich wollte ihr zeigen (was, so will ich zugeben, mir nicht gänzlich glaubhaft erschien), dass jenes fast unhörbare Atmen und jenes sanfte Spiel der Gestalten auf der Wand nur die natürlichen Folgen des Luftstroms waren, der wie üblich zirkulierte. Doch eine tödliche Blässe, die ihr Antlitz überzog, bewies mir schon, dass meine Bemühungen, sie zu beruhigen, fruchtlos sein würden. Sie schien in Ohnmacht zu fallen, und keiner unserer Diener war in Rufweite. Ich erinnerte mich, wo sich eine Karaffe leichten Weins befand, der ihr von den Ärzten verordnet worden war, und hastete quer durch den Raum, die Karaffe zu holen. Aber als ich in den Lichtkreis der Weihrauchschale trat, erregten zwei Umstände beunruhigender Art meine Aufmerksamkeit. Ich fühlte, wie ein spürbares, aber nicht sichtbares Objekt leicht an mir vorbeistreifte; und ich sah, dass auf dem goldenen Teppich, genau in der Mitte des strahlenden Lichterkranzes der Weihrauchschale, ein Schatten lag – ein schwacher, unbestimmter Schatten von engelsgleicher Erscheinung –, so wie man sich den Schatten eines Schattens vorstellen würde. Doch ich war verstört und erregt von einer übermäßigen Dosis Opium und beachtete diese Dinge kaum und sprach auch nicht zu Rowena davon. Als ich den Wein gefunden hatte, durchquerte ich den Raum erneut und füllte einen Pokal, den ich der halb Bewusstlosen an die Lippen hielt. Doch sie war wieder halbwegs zu sich gekommen und ergriff selbst den Pokal, wahrend ich auf die nächste Ottomane sank und mit meinen Augen an ihr hing. Es war in diesem Moment, dass ich deutlich sanfter Schritte auf dem Teppich und bei der Bettstatt gewärtig wurde; und Sekunden später, als Rowena im Begriff war, den Wein an ihre Lippen zu führen, sah ich – oder träumte dies nur – drei oder vier große Tropfen einer glitzernden, rubinroten Flüssigkeit in den Pokal fallen, so, als entsprängen sie einer unsichtbaren Quelle inmitten der Leere des Raumes. Ich sah es wohl – doch nicht Rowena. Sie trank den Wein, ohne zu zögern, und ich wagte es nicht, sie mit einem Geschehnis vertraut zu machen, das letztlich – wie ich meinte – wohl die Vorspiegelung einer allzu lebhaften Einbildungskraft gewesen sein musste, die durch das Entsetzen Rowenas, durch das Opium und durch die ungewohnte Stunde krankhaft überhitzt war.
Doch kann ich es vor mir selbst nicht verbergen, dass unmittelbar nach dem Ereignis mit den Rubintropfen im Zustand meiner Frau eine schnelle Wendung zum Schlimmeren eintrat, so dass ihre Dienerschaft sie in der dritten darauf folgenden Nacht für das Grab vorbereitete und ich in der vierten Nacht allein bei ihrem verhüllten Leichnam saß, allein in dem bizarren Gemach, das sie als meine Braut betreten hatte. Wilde Visionen, opiumgeboren, flirrten wie Schatten vor meinen Augen. Mit unstetem Blick starrte ich auf die Sarkophage in den Ecken des Gemachs, auf die wechselvollen Figuren der Wandbehänge und auf das Züngeln der bunten Flammen in der Weihrauchschale über mir. Dann fiel mein Blick, als ich mir die Ereignisse der vergangenen Nacht ins Bewusstsein zurückrief, auf die Stelle unter dem Lichtkreis der Weihrauchschale, wo ich die vage Andeutung des Schattens gesehen hatte. Der Schatten jedoch war verschwunden; ich atmete befreit auf, und mein Blick schweifte hinüber zur bleichen und starren Gestalt auf dem Bett. Da stürmten tausend Erinnerungen an Ligeia auf mich ein – und dann überfiel mein Herz mit der ungestümen Gewalt einer Flut das ganze unaussprechliche Weh, mit dem ich sie als verhüllten Leichnam gesehen hatte. Die Nacht schwand dahin, und voll bitterer Gedanken an die eine, die einzige, die über alles Geliebte verweilte ich und starrte versunken auf die sterbliche Hülle Rowenas.
Es mag um Mitternacht gewesen sein, vielleicht auch früher oder später, denn ich hatte den Sinn für die Zeit verloren, als ein sanftes, leises, doch deutlich vernehmbares Schluchzen mich aus meinen Träumen auffahren ließ. Ich fühlte, dass es von dem Ebenholzbett her kam – dem Lager des Todes. Ich lauschte, gepeinigt von abergläubischem Entsetzen – doch das Schluchzen wiederholte sich nicht. Ich marterte meine Augen, um irgendeine Bewegung des Leichnams zu entdecken – doch nicht die geringste Bewegung war zu sehen. Dennoch konnte ich mich nicht getäuscht haben. Ich hatte den Laut ja gehört, wie schwach er auch immer gewesen war, und meine Seele war zu neuem Leben erwacht. Entschlossen und standhaft richtete ich meine ganze Aufmerksamkeit auf den toten Körper. Viele Minuten vergingen, ehe irgendetwas geschah, was das Geheimnis hätte erhellen können. Endlich wurde klar, dass ein leichter, sehr schwacher und kaum wahrnehmbarer Anflug von Farbe die Wangen wie auch die feinen, tiefliegenden Äderchen der Augenlider belebte. Eine Art unsäglicher Horror und Entsetzen, wofür die Sprache der Menschen keinen zureichenden Ausdruck kennt, ließ meinen Herzschlag anhalten und meine Glieder so, wie ich saß, versteinern. Doch endlich bewirkte mein Pflichtgefühl, dass ich meine Fassung zurückgewann. Ich durfte nicht länger daran zweifeln, dass wir in unserem Tun voreilig gewesen waren – dass Rowena noch lebte. Die Notwendigkeit verlangte, dass auf der Stelle etwas geschehe; doch der Turm lag gänzlich abseits von denjenigen Räumen der Abtei, welche die Bediensteten beherbergten – keiner von ihnen war in Rufweite –; ich hatte keine Möglichkeit, sie zur Hilfe herbeizurufen, ohne das Zimmer für lange Minuten zu verlassen – gerade dies aber konnte ich nicht wagen. So rang ich also allein in meinem Bemühen darum, den unentschlossen schwebenden Geist in den Körper zurückzurufen. Binnen kurzem wurde jedoch klar, dass ein Rückfall eingetreten war; die Farbe wich wieder aus den Augenlidern und den Wangen und hinterließ eine Blässe, die kälter war als Marmor; die Lippen welkten noch mehr dahin und kniffen sich in einem grässlichen Ausdruck des Todes zusammen; eine widerwärtige Feuchte und Kälte überzog rapide den ganzen Körper; und sofort darauf hatte sich auch die übliche Leichenstarre wieder eingestellt. Ich fiel schaudernd zurück auf die Ottomane, von der ich so alarmiert aufgeschreckt war, und überließ mich wieder den leidenschaftlichen Wachträumen von Ligeia.
So war eine Stunde verronnen, als ich (konnte es überhaupt sein?) zum zweiten Male gewisser vager Laute, die aus der Richtung des Bettes kamen, gewärtig wurde. Ich lauschte in höchstem Entsetzen. Der Laut wiederholte sich – es war ein Seufzen. Ich stürzte hin zu der Toten und sah – sah in aller Deutlichkeit – ein Zittern auf den Lippen. Einen Moment später entspannten sie sich und enthüllten eine blendende Reihe von Perlenzähnen. Ungläubiges Staunen kämpfte jetzt in meiner Brust mit einer tiefen, ehrfürchtigen Scheu, die mich bisher allein beherrscht hatte. Ich fühlte, dass ich in Dunkelheit versank und dass mein Denken abirrte; und nur dank einer gewaltigen Anstrengung gelang es mir, mich aufzuraffen und der Aufgabe zu stellen, welche die Pflicht mir einmal mehr gebot. Ein schwaches Glühen überzog nun die Stirn, die Wangen und den Hals; eine spürbare Wärme durchdrang den ganzen Körper; sogar ein leichtes Pulsieren des Herzens war bemerkbar. Rowena lebte, und mit verstärktem Eifer widmete ich mich der Aufgabe der Wiedererweckung. Ich rieb und benetzte ihre Schläfen und Hände und wandte jeden Kunstgriff an, den Erfahrung und eine nicht geringe medizinische Belesenheit mir nahezulegen vermochten. Doch vergebens. Plötzlich wich die Farbe wieder, der Puls verstummte, die Lippen nahmen erneut den Ausdruck des Todes an, und einen Augenblick später zeigte der ganze Körper wieder die eisige Kälte, die aschgraue Färbung, die tiefe Starre, die eingesunkenen Umrisse und all jene ekelhaften Eigenschaften dessen, der schon für viele Tage sein Grab gefunden hatte.
Und wieder versank ich in Visionen von Ligeia – und wiederum (was Wunder, dass mich schaudert, da ich dies niederschreibe?), wiederum drang vom Ebenholzbett her ein leises Schluchzen an mein Ohr. Aber warum soll ich die unsagbaren Schrecken jener Nacht auf das genaueste wiedergeben? Warum bei der Enthüllung verweilen, wie Mal um Mal bis in die graue Morgendämmerung hinein dieses scheußliche Drama der Wiederbelebung seine Erneuerung fand; wie jeder schreckliche Rückfall nur ein grausameres und offenbar immer hoffnungsloseres Verfallen an den Tod war; wie jede Agonie den Anblick eines Kampfes mit einem unsichtbaren Feind bot; und wie jeder Kampf eine ich weiß nicht wie zu beschreibende wilde Veränderung in der Erscheinung des Leichnams zur Folge hatte? Man möge mich zum Schlussakt eilen lassen.
Der größte Teil der furchtbaren Nacht war vergangen, und sie, die schon tot gewesen, regte sich erneut – und jetzt nachdrücklicher als bisher, obgleich sie aus einem Zustand des Verfalls erwachte, der in seiner völligen Hoffnungslosigkeit erschreckender als alles Vorherige erschien. Ich hatte schon lange aufgehört, zu kämpfen oder mich zu bewegen, und saß erstarrt auf der Ottomane, ein hilfloses Opfer im Wirbel heftigster Emotionen, deren am wenigsten schreckliche, am wenigsten verzehrende vielleicht noch maßlose Furcht war. Der Leichnam, ich wiederhole es, regte sich, und jetzt lebhafter als zuvor. Das Farbenspiel des Lebens überflutete mit ungewöhnlicher Macht das Antlitz – die Glieder entkrampften sich – und wären nicht die Augenlider noch immer schwer zusammengepresst gewesen und hätten nicht die Binden und Tücher des Grabes der Gestalt ihre Leichenerscheinung verliehen, ich hätte mir vorgaukeln können, dass Rowena in der Tat die Fesseln des Todes gänzlich abgestreift habe. Aber selbst wenn sich dieser Gedanke nicht einmal jetzt vollständig bei mir durchsetzte, so war doch kein Raum mehr für Zweifel, als dieses Etwas im Leichentuch sich vom Bett erhob und wankend, mit unsicherem Schritt, mit geschlossenen Augen und nach der Art eines Schlafwandlers kühn und unübersehbar in die Mitte des Zimmers vordrang.
Ich zitterte nicht – ich rührte mich nicht –, denn ein Wirbel unfassbarer Vorstellungen, die sich mit dem Auftreten, der Statur und dem Verhalten der Gestalt verknüpften, bestürmte mein Denken und hatte mich in Stein verwandelt. Ich rührte mich nicht – starrte nur die Erscheinung an. Es herrschte eine wahnwitzige Verwirrung in meinen Gedanken – ein unkontrollierbarer Tumult. Konnte es denn wahrhaft und wirklich die lebende Rowena sein, die vor mir stand? Konnte es in der Tat überhaupt Rowena sein – die blonde, blauäugige Lady Rowena Trevanion von Tremaine? Warum, warum bloß sollte ich daran zweifeln? Die Binde war fest um ihren Mund geschlungen – doch warum sollte es nicht der Mund der atmenden Lady von Tremaine sein? Und die Wangen – sie erblühten rosig wie im Mittag ihres Lebens – ja, sie mochten wirklich die schönen Wangen der lebenden Lady von Tremaine sein. Und das Kinn mit den Grübchen wie ehedem – war es nicht ganz das ihre? Aber war sie denn größer geworden seit dem Beginn ihrer Krankheit? Welch unaussprechlicher Wahn ergriff mich bei diesem Gedanken? Ein Sprung, und ich war bei ihr! Sie zuckte vor meiner Berührung zurück und ließ die geisterhaften Leichentücher gelöst von ihrem Haupt gleiten, die es umschlossen hatten, und es ergossen sich in die brausende Atmosphäre des Gemachs überquellende Massen von langem, aufgelöstem Haar: es war schwärzer als die Rabenfittiche der Mitternacht! Und jetzt öffneten sich langsam die Augen der Gestalt, die vor mir stand. »Hier nun endlich«, schrie ich laut auf, »kann ich niemals, niemals irren – dies sind die großen und schwarzen und wilden Augen – meiner verlorenen Geliebten – der Lady – der LADY LIGEIA!«
1838 Übersetzung von Manfred Pütz