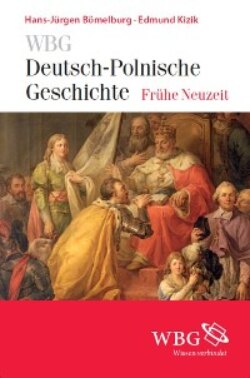Читать книгу WBG Deutsch-Polnische Geschichte – Frühe Neuzeit - Edmund Kizik - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Römisch-deutsches Reich und Polen-Litauen: Strukturelle Parallelen und nachbarschaftliche Beziehungen
ОглавлениеBereits ein Blick auf die geographische Ausdehnung beider Reichsverbände legt eine Parallelisierung der frühneuzeitlichen deutschen und polnischen Geschichte nahe: Mit ca. 800.000–1.000.000 km² (das frühneuzeitliche Frankreich umfasste ca. 400.000 km²) erreichten das Heilige Römische Reich deutscher Nation und Polen-Litauen eine ähnliche räumliche Ausdehnung, die erhebliche Probleme in der Kommunikation zwischen den Zentren, den Regionen und den Peripherien aufwarf und die unter den damaligen Verkehrsverhältnissen nur eine begrenzte machtpolitische Durchdringung des Raumes zuließ.
Manchmal wird eine Terminologie verwendet, die eine Entgegensetzung von deutschem „Reich“ und polnischer „Adelsrepublik“ suggeriert (die Folge einer Übersetzung des lat. respublica in die französische republique des nobles, aus der die deutsche Bezeichnung hervorging), diese Begrifflichkeit löst jedoch eher Missverständnisse aus. Bei beiden Staatsverbänden handelte es sich jeweils um eine konstitutionell begrenzte monarchia mixta mit einer gestuften ständischen Verfassung, in der insbesondere adlige Eliten, aber auch Geistlichkeit und städtisches Bürgertum Partizipationsmöglichkeiten besaßen.1
Terminologische Überschneidungen tauchten bereits zeitgenössisch gehäuft auf: So verwandten die deutschsprachigen Bevölkerungen im Preußen „königlich polnischen Anteils“ oder in Großpolen für den einheimischen Staatsverband ebenfalls die Bezeichnung „polnisches Reich“. Andererseits sprachen Verfassungstheoretiker bei beiden Verbänden von einer res publica (poln. rzeczpospolita) oder einer monarchia mixta. In der Korrespondenz der großen preußischen Städte Danzig, Thorn und Elbing wurden vielfältige Analogien zwischen dem Reich und Polen-Litauen beschworen, die Städte beanspruchten einen ähnlichen Status wie die Reichsstädte. In dieser Vielfalt und in den changierenden Bezeichnungen kommt der schwer klassifizierbare Charakter beider Verbände zum Ausdruck: Der Historiker Heinz Schilling spricht von einer „amöbenhaften, amorphen Gestalt“.2
Auch parallele politische Entwicklungen in der Frühen Neuzeit legen einen Vergleich nahe: Beide Verbände bildeten um 1500 gemischte Herrschaftsformen mit monarchisch-ständischen Institutionen politischer Entscheidungsfindung aus: Neben die gewählten Herrscher (König/Kaiser und König/Großfürst) traten regelmäßig tagende zentrale ständische Diskussions- und Aushandlungsforen in Form des Reichstags (1495) und des Sejms (1493). Beide Ständeversammlungen erhielten durch die Reichsreformen bzw. die polnisch-litauische Exekutionsbewegung neue Strukturen (Festlegung der Reichsstände und Reichskreise, Woiwodschaften entsandten jeweils zwei Landboten zum Sejm) und Verhandlungsformen (Abschiede). Dabei ist die parallele Entstehung beider zentraler Ständeversammlungen nicht zufällig: Politische Ereignisse (Türkengefahr) erzwangen die Ausbildung handlungsfähiger Gremien, die Beschlüsse treffen und Steuern erheben konnten. Polen galt als antemurale christianitatis, im Reich stilisierte sich vor allem Wien durch die zweimaligen Belagerungen zu einer „Vormauer der Christenheit“. Auch nahmen die habsburgischen und jagiellonischen Herrscher sehr wohl wahr, welche Modernisierungen beim Nachbarn stattfanden.
Deutlich ist diese wechselseitige Rezeption bei der Einrichtung von Institutionen der höheren Rechtsprechung sichtbar. Als in der Krone Polen in den 1540er Jahren eine höhere, vom nur schleppend tätigen König und Hof losgelöste Gerichtsbarkeit gefordert wurde, berief man sich in der Publizistik neben den französischen parlaments auf das 1495 eingerichtete Reichskammergericht. Andrzej Frycz Modrzewski (Modrevius) schlug öffentlich vor, dass die Besetzung des zukünftigen höchsten polnischen Gerichts ähnlich wie beim Reichskammergericht vorgenommen werden sollte. Letztendlich sah die Wahlordnung für das polnische Krontribunal jedoch die Wahl von rotierenden Deputierten vor, während am Reichskammergericht dauerhaft bestellte Assessoren Recht sprachen.3
Für beide Staatsverbände galt eine historische Multizentralität: Im Reich traten an die Stelle der alten Kerngebiete Rheinland und Schwaben zunächst Böhmen, später die habsburgischen Erblande, aber auch Frankfurt und Speyer bzw. Wetzlar (Sitzorte des Reichskammergerichts) oder Regensburg als Sitz des Immerwährenden Reichstags. In Polen-Litauen wurde die seit dem 14. Jahrhundert dominierende Region Kleinpolen mit der Metropole Krakau im 16. Jahrhundert von Masowien mit Warschau abgelöst, unter den letzten Jagiellonen erfüllte aber zeitweise auch der polnisch-litauische Grenzbereich in Podlachien und Hoch-Litauen (Aukštaiten) die Funktion einer königsnahen Region, während an der unteren Weichsel das Königliche Preußen mit Danzig zum wirtschaftlichen Zentrum wurde. Ein Dilemma in beiden Reichsverbänden blieb, dass die wirtschaftlichen, kommunikativen und geographischen Schlüsselregionen – Böhmen und das Königliche Preußen – sowie deren Metropolen – Prag und Danzig – aufgrund ihres Sonderstatus für politische Zentralfunktionen ungeeignet waren.
Der umfangreiche Grenzstreifen entlang der ca. 1000 km langen Grenze zwischen römisch-deutschem Reich und der Krone Polen besaß für beide Reichsgefüge eine besondere Bedeutung. Hier lagen – in beiden Reichsverbänden – „reichsferne“ Territorien, in denen lokale oder regionale Eigenentwicklungen stattfanden. Die hinterpommerschen Herzogtümer, die Herrschaft en Lauenburg und Bütow (polnische Territorien, aber in Lehnbesitz der pommerschen und brandenburgischen Fürsten), die Pfandherrschaft Draheim, die Neumark als Nebenterritorium Brandenburgs, die Herzogtümer Auschwitz und Zator und das bischöflich krakauische Fürstentum Sewerien/Siewierz bildeten jeweils Herrschaftsgebiete an der Grenze, in denen eigene deutsch-polnische Strukturen, eine Zweisprachigkeit und Mehrkonfessionalität sowie spezifische Lehnsverhältnisse und Rechtsstrukturen entstanden. Das galt auch für die oberschlesischen Herzogtümer Oppeln, Ratibor, Pless und Teschen, Teile des Reichs, die jedoch häufig von böhmischen Standesherren regiert und vielfach mehrsprachig organisiert waren. Noch die slawischen Sorben der Lausitz profitierten von der sächsisch-polnischen Verbindung.
Grundsätzlich gab dieser Grenzstreifen auch Untertanen, die mit der bisherigen Herrschaft und den eigenen Lebensperspektiven unzufrieden waren, neue Chancen: Zogen sie über die Grenze, war es kaum möglich, solche „entlaufenen Untertanen“ zurückzuführen. Da die Region dünn besiedelt war, boten Grundherren oft günstige Ansiedlungskonditionen entlang der Grenze mit langen Freijahren oder niedrigen Zinszahlungen. Anderskonfessionelle Minderheiten wie die schlesischen und böhmischen Protestanten nach 1620 oder die polnischen Antitrinitarier nach 1660 fanden hier Unterschlupf, für Handelsleute und Spezialisten besaß die Großstadt Danzig Anziehungskraft.4 Das bessere Recht und die größeren Freiheiten an der Grenze erklären, warum der Grenzstreifen in der Frühen Neuzeit dichter besiedelt wurde.
Insbesondere muss der friedliche, ja friedensstiftende Charakter dieser Grenze betont werden: Nach der Säkularisierung des Deutschen Ordens (1525) kam es – abgesehen von der brandenburgischen Beteiligung am schwedischen Einmarsch in Polen 1655–1657 – i n 250 Jahren zu keinen deutschpolnischen militärischen Konflikten; ein im kriegerischen Europa der Frühen Neuzeit beinahe einzigartiges Phänomen. Die Ursache ist in den in beiden Reichen defensiv ausgerichteten militärischen Strukturen zu sehen: Weder die Reichsarmee noch die polnische Kronarmee führten Angriffskriege; mit ihrer finanziellen und logistischen Ausstattung wären sie dazu gar nicht in der Lage gewesen. Dabei gab es durchaus sich überkreuzende territoriale Prätensionen: So beanspruchte das Reich nach der Säkularisierung des Deutschen Ordens in Preußen das 16. Jahrhundert hindurch die Zugehörigkeit des Preußenlandes zum Reich, was von der polnischen Krone abgelehnt wurde. Dem können von den polnischen Eliten wie der Öffentlichkeit erhobene Ansprüche auf Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert gegenübergestellt werden. Obwohl die staatsrechtliche Zuordnung zur Krone Böhmen und zum römisch-deutschen Reich geklärt war, gab es einen tief sitzenden historiographischen Traditionalismus, der auch in der Frühen Neuzeit noch besondere Verbindungen Schlesiens zur Polonia postulierte. Trotz solcher wechselseitigen Ansprüche war das Verhältnis in der deutsch-polnischen Kontaktzone jedoch durchweg friedlich – Bruch- und Konfliktlinien verliefen in der Frühen Neuzeit anderswo in Europa.
Eine deutsch-polnische Diplomatiegeschichte lässt sich für die Spanne zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert schwerlich fassen, denn die Akteure wechseln in beiden Reichsgefügen und der Charakter von Diplomatie verändert sich nachhaltig. Kann man im 16. Jahrhundert zu Zeiten Karls V. und der Jagiellonen eine Diplomatiegeschichte zwischen den monarchischen Höfen und dem Reichstag bzw. Sejm schreiben, so verlagert sich im 17. Jahrhundert durch den Souveränitätsgewinn der deutschen Territorien nach 1648 das Gewicht stärker auf eine habsburgisch-polnische oder brandenburgisch-polnische Beziehungsgeschichte, wobei auch die polnischen Aristokraten (Familien wie die Radziwiłłs, Sobieskis oder Pac’) als Akteure berücksichtigt werden müssen. Im 18. Jahrhundert kann man von sächsisch-polnischen (→ Kap. 6) und preußisch-polnischen (→ Kap. 7) Beziehungen sprechen. Deshalb konzentriert sich der folgende Abschnitt auf die Beziehungen des 16. Jahrhunderts, wobei insbesondere Kanäle der Wissensvermittlung zwischen den beiden ständischen Arenen, zwischen Reichstag und Sejm, gewählt wurden. An diesen Kontakten waren nicht nur einzelne Diplomaten beteiligt, sondern auch ganze Gesandtschaften und größere Gruppen von Adligen, aber auch Bürgern, so dass sich hier ein breiteres Bild zeichnen lässt als bei der bloßen Analyse diplomatischer Berichte aus Wien, Prag, Krakau, Wilna oder Warschau.
Als Ausgangspunkt unserer Überlegungen kann der Besuch einer polnischen Gesandtschaftt auf dem Reichstag von 1486 in Frankfurt und Köln dienen. Dass dieser Auftritt für die Zeitgenossen eine Novität darstellte, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass in mehreren Berichten insbesondere die Kleidung der Gesandten beschrieben wurde. Auch die zunächst bestehenden Kommunikationsprobleme und zeremoniellen Unbestimmtheiten kamen deutlich zum Vorschein. Die polnische Gesandtschaft von 1486 trat in der Audienz vor Kaiser Friedrich III., König Maximilian und den anwesenden Kurfürsten und Fürsten in Köln in polnischer Sprache auf. Ihre Ansprache wurde von Johann Beckenschlager, dem aus Schlesien stammenden Erzbischof von Gran, konsekutiv ins Deutsche übersetzt. Anschließend bat man die Gesandten, den Versammlungsraum zu verlassen, um intern zu beraten, welche Antwort ihnen gegeben werden sollte. Dann rief man sie wieder herein, und der Bischof von Gran verkündete in „slawischer“ (es ist unklar, in welcher) Sprache den Bescheid der Versammlung. Diese komplizierte Prozedur der mehrfachen Übersetzung – mit allen Problemen, die dies für die Wiedergabe des zu Vermittelnden aufwarf – wäre überhaupt nicht erforderlich gewesen. Zur umfangreichen polnischen Gesandtschaft gehörten auch Personen, die das Deutsche oder Lateinische hervorragend beherrschten. Der Grund für die komplizierte Prozedur lag wohl darin, dass diese Gesandtschaft als etwas Neues und Unbekanntes wahrgenommen wurde.5
Die auch verwandtschaftlich verflochtenen habsburgischen und jagiellonischen Höfe waren an einer Verständigung interessiert, aber auch in Rivalität miteinander verbunden. Dabei konnte die osmanische Bedrohung als Argument für gemeinsame herrscherliche Anliegen dienen (Erhöhung des zentralen Steueraufkommens und Disziplinierung der Stände), hinter dem eventuell divergierende Interessen zurücktraten. Diese Konstellation – gemeinsame und/oder konkurrierende Interessen der Herrscherfamilien der Habsburger und Jagiellonen – sollte die politische Landschaft Ostmitteleuropas das 16. Jahr hundert hindurch bestimmen und stellte eine Rahmenbedingung für die Kontakte zwischen Altem Reich und Polen-Litauen dar.
Offizielle Gesandtschafttssprache war das Lateinische. Die Durchsetzung eines verbindlichen humanistischen Lateins in der habsburgischen und polnischen Kanzlei um 1500 erleichterte die Kommunikation. Die rhetorische Ausgangsbasis der polnischen Gesandtschaften bildete durchweg die Betonung des gemeinsamen Anliegens, pro bono Reipublicae christianae einzutreten. Inhaltlich fand dies Ausdruck in der wiederholten Hervorhebung der „Türkengefahr“ und den Versuchen, eine gemeinsame „Türkenabwehr“ zu lancieren. Im Einzelfall ist jedoch jeweils nachzufragen, ob sich hinter diesen Akzenten nicht eine taktische Betonung der Gemeinsamkeiten verbarg, um in der Verhandlung von Einzelfragen eine günstigere Position einzunehmen.
Das Problem der Verhandlungssprache tauchte in Zukunft in den Quellen nicht mehr auf. Der auf dem Freiburger Reichstag von 1498 als polnischer Gesandter (ein „großer Herr“) mit einem Hilfsersuchen gegen die Türken – nach dem Frankfurter Protokollanten ein „cleglich Anpringen“ – auftretende Mikołaj Rosenberg-Rozembarski fand durch die Form seiner lateinischen Ansprache, die in den nächsten Jahrhunderten in mehreren Kompendien mit Reichstagsreden gedruckt wurde, ein positives Echo.6
Allerdings gab es neben den besonderen Beziehungen zu den Habsburgern auch dynastische Faktoren, die die Jagiellonen mit mehreren Reichsständen verbanden: Insgesamt waren sechs Schwestern der vier 1492–1572 regierenden jagiellonischen Könige mit Reichsfürsten verheiratet, wodurch der polnische Hof insbesondere nach Sachsen, Ansbach, Brandenburg, Pommern und Braunschweig familiär-politische Beziehungen und Kommunikationskanäle besaß.7 Zwar fügten sich diese Verbindungen infolge der widerstreitenden Interessen der Reichsstände nicht zu einer „jagiellonischen Partei“ unter den Reichsständen zusammen, doch bot sich in einzelnen Situationen wiederholt die Chance, für politische Anliegen des polnischen Hofes auf dem Reichstag auch andere Reichsstände zu gewinnen, mit denen die Jagiellonen dynastisch verbunden waren. Anhand erhaltener Akten ist nachweisbar, dass der polnische Hof sowie einzelne Reichsstände versuchten, diese Kontakte zu einer informellen Zusammenarbeit auf dem Reichstag zu nutzen.
Ein Beispiel: Als 1532 in Regensburg die Reichssteuern diskutiert werden sollten, schrieb Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach in der Instruktion für seinen Gesandten Balthasar von Rechenberg, dieser solle in der Frage der Reichsanschläge eventuell den polnischen Gesandten Dantiscus als Vermittler vorschlagen.8 Georg, ein Neffe des polnischen Königs Sigismund I., war durch längere Aufenthalte am böhmischen und ungarischen jagiellonischen Hof, durch seine Rolle als Erzieher König Ludwigs II. und Vermittler bei der Umwandlung Preußens in ein protestantisches polnisches Lehen sowie durch seine schlesischen Besitzungen (Jägerndorf) eng mit der jagiellonischen Politik verbunden. Insbesondere bei der Verteidigung Herzog Albrechts nach dessen Übertritt zum Protestantismus arbeitete die ansbachische Diplomatie mit den polnischen Gesandten zusammen.
Grundsätzlich ist bei dem Besuch der Reichstage seit Anfang des 16. Jahrhunderts auch das Element der Gegenseitigkeit zu beachten: Kaiserliche oder königliche habsburgische Gesandtschaft en aus dem Reich nahmen in etwa gleichem Umfang an den polnischen ständischen Generalversammlungen teil. So besuchten die habsburgischen Diplomaten Sigismund von Herberstein und Georg von Lookschau 1527/28 den polnischen Sejm in Petrikau (Piotrków), während der polnische Gesandte Piotr Opaliński kurz darauf an dem Reichstag in Regensburg teilnehmen sollte.
Zwischen dem königlichen bzw. kaiserlichen Hof im Reich, den Tagungsorten der Reichstage und dem polnischen Hof bestanden vor der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts keine regelmäßigen Postverbindungen und Kommunikationswege. Keiner der Höfe hatte einen festen Sitz, auch erfolgte die Einberufung der Reichstage relativ kurzfristig. Bis diese Informationen über eine Entfernung von 1000 bis 2000 km nach Polen-Litauen oder an die habsburgischen Residenzen gelangten, konnten zwei bis drei Monate vergehen, zudem wurde der polnische Hof nicht unmittelbar von der Ausschreibung eines Reichstages unterrichtet, sondern erhielt die Einladungen oft aus zweiter Hand. Unter diesen Bedingungen hing die Nachrichtenübermittlung von den jeweiligen Aufenthaltsorten der Herrscher, der Organisation der Kanzlei und der Gesandtschaft en sowie nicht zuletzt auch von Zufällen ab.
Zwischen den 1480er Jahren und 1506 war der polnische Hof aus außenpolitischen Gründen wenig ortsfest und hielt sich häufig in Litauen auf. Dagegen ließen sich Hof und Kanzlei in der langen Regierungszeit Sigismunds I. (1507– 1547) in Krakau nieder. Nach 1547 nahm diese Präsenz in Krakau infolge persönlicher Vorlieben Sigismund Augusts wieder ab, und im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts pendelten Hof und Monarch zwischen Krakau, Warschau, den preußischen Städten und Litauen. Die Politik im Reich konzentrierte sich dagegen unter Maximilian I. am Oberrhein, später wegen des spanischen Engagements Karls V. in Brüssel.
Es liegt auf der Hand, dass diese Verlagerungen, die die Herrschaftszentren teilweise für mehr als 1000 km voneinander entfernten, die Kommunikation gewaltig erschwerten. Als besonders günstig für eine schnelle Nachrichtenübermittlung erwiesen sich Kontakte in der Residenzstadt Krakau, da die Metropole insbesondere über die Agenten und Informationsnetze am Ort ansässiger Kaufleute (Familien Thurzó-Fugger, Boner) bereits um die Wende zum 16. Jahrhundert an das internationale Nachrichtennetz angebunden war und die Entfernung nach Wien sowie zu den oberdeutschen Tagungsorten der Reichstage (Nürnberg, Regensburg, Augsburg) in ein bis zwei Wochen überwunden werden konnte.
Ein Aufenthalt in Warschau, in den bevorzugten Residenzen Sigismund Augusts im polnisch-litauischen Grenzbereich, verdoppelte und verdreifachte dagegen die Kommunikationswege und erschwerte insbesondere den Kontakt mit den Gesandtschaft en auf den Reichstagen. In Litauen versorgte zudem in erster Linie die litauische Kanzlei den Monarchen mit dem nötigen Personal, die allerdings für Fragen der Reichspolitik wenig kompetent war. Ein Beispiel: Als im Januar 1566 die Instruktion für den Gesandten Franciszek Krasiński zum Reichstag in der königlichen Residenz in Knyszyn (Podlachien) entworfen wurde, konnte diese nicht fertiggestellt werden, da vor Ort die nötigen Akten insbesondere in der Frage der preußischen Angelegenheiten nicht vorhanden waren. Am 10. März wurde deshalb aus Wilna ein Supplementum in negotio Prutenico nach Wien geschickt, das den Gesandten jedoch erst nach der Audienz beim Kaiser erreichte und nur noch für die Rede vor den Reichsständen (29. April) verwandt werden konnte.
Krakau erhielt seit 1558 einen Anschluss an das reguläre mitteleuropäische Postsystem durch die Einrichtung einer Postlinie über Wien und Graz nach Venedig, die, mit Stockungen und Unterbrechungen, zeitweise wöchentlich, später 14-tägig verkehrte. Seit 1583 wurde diese Postlinie auf Anordnung Stephan Báthorys bis an den jeweiligen Aufenthaltsort des königlichen Hofes verlängert, was die Nachrichtenverbindungen zum herrscherlichen Zentrum verbesserte.9 Allerdings sorgte diese Einrichtung regulärer Verbindungen nur phasenweise für Verbesserungen: Das 1596 zur königlichen Residenzstadt erhobene Warschau hatte bis in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts keinen regelmäßigen Anschluss an das internationale Postnetz. Eine Postlaufzeit von einem Monat aus den süd- und westdeutschen Regionen des Reichs bis an den polnischen Hof war für das ganze 16. Jahrhundert die Normalität.
Durchschnittliche Gesandtschaft en waren bescheiden und bestanden etwa bei Rosenberg-Rozembarski zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus sechs bis acht Personen. Allerdings nahmen diese Größenordnungen bereits Mitte des Jahrhunderts deutlich zu: Den Reichstag in Worms 1544/45 besuchte der Gesandte Jan Firlej mit einer 20 Personen zählenden adligen Gefolgschaft, wobei hier wohl auch die in der inneren Politik Polen-Litauens verbreitete Praxis zur Geltung kam, mit einem möglichst umfangreichen Gefolge (orszak) politische Bedeutung zu demonstrieren. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist bei speziell aus Polen zusammengestellten Gesandtschaft en von 20–60 Personen auszugehen. Diese Größe warf bei den hohen Lebenshaltungskosten an den Tagungsorten und der geringen finanziellen Ausstattung der Gesandtschaft en Probleme auf. Mehrere Gesandtschaft en gerieten in Geldnöte und mussten Ausrüstung und Pferde verkaufen, da die Versorgung nicht mehr gesichert war.
Dies änderte sich nach 1515, als humanistisch gebildete Berufsdiplomaten agierten, die sich längere Zeit am Hof aufhielten. Als Beispiel genannt sei Johannes Dantiscus, der zwischen 1518 und 1532 über zehn Jahre als polnischer Gesandter am kaiserlichen Hof Karls V. tätig war und in dieser Funktion an den Reichstagen 1530 in Augsburg und 1532 in Regensburg teilnahm. Erwähnt werden muss auch Martin Kromer, der 1558–1564 am Hofe Ferdinands I. ansässig war und mehrere Reichstage besuchte. Diese Persönlichkeiten besaßen eine sehr gute Kenntnis der Reichspolitik, wobei allerdings die Kontakte zum kaiserlichen Hof gegenüber den Kenntnissen der kurfürstlichen und fürstlichen Interessen überwogen.
Im Falle von Dantiscus, dessen gesamter Briefwechsel etwa 20.000 Dokumente umfasst, die inzwischen in Warschau in Kurzregesten erfasst sind (70 % Latein, 20 % Deutsch, 10 % sonstige Sprachen),10 sind auch quantitative Aussagen möglich: Erhalten sind etwa 60 Briefe von und an Dantiscus, in denen dieser über die in Augsburg und in Regensburg ablaufenden Ereignisse informierte beziehungsweise Anfragen und weitere Informationen erhielt. Die mitunter ausführlichen, bis zu 20 Seiten umfassenden Briefe gingen nach Polen an Sigismund I., die Königin Bona Sforza, ausgewählte Personen der Kronkanzlei sowie preußische Bekannte von Dantiscus, aber auch an die internationalen humanistischen Eliten. Die polnischen Eliten waren somit über diese Reichstage gut informiert; neben der Preußen-, Ungarn-, Türken- und Ostmitteleuropapolitik, für die man sich in Polen interessierte, wurde auch über allgemeine Fragen der Reichspolitik berichtet.
Zudem besaßen die Reichstage für die polnischen Eliten die Funktion von Nachrichtenbörsen. Der Königshof bat seine Gesandten zum Reichstag, im wöchentlichen Rhythmus ausführlich über alle in Erfahrung zu bringenden Neuigkeiten zu berichten und interessante Publikationen und Flugschriften nach Polen zu schicken. Sigismund August schrieb am 30. Mai 1566 an Franciszek Krasiński: „Die Nachrichten, die Ihr Uns übersandt habt, waren wir froh zu erhalten und Wir möchten, dass Ihr Uns oft und ausführlich schreibt.“11 Solange sich die Gesandten auf dem Reichstag aufhielten, wurde vielfach über diese die Post an die westeuropäischen Gesandtschaft en abgewickelt, da die polnische Kanzlei von der zutreffenden Einschätzung ausging, dass während der Reichstage diese Kommunikationswege besonders zügig bedient wurden. Erhaltene Berichtsammlungen – zum Beispiel des Gesandten Łukasz Podoski vom Reichstag in Speyer 1570 – belegen, dass über zahlreiche Details der Reichspolitik informiert wurde, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Bedeutung der Reichstage als Forum, auf dem dynastische Verbindungen sondiert werden konnten.12
Ein Beispiel für solche Verhandlungsaufträge: „Mit den geehrten pommerschen Herzögen solltet Ihr ebenfalls verhandeln, damit, im Bewusstsein unserer engen Verwandtschaft und der zwischen uns bestehenden Verträge, wenn unsere Lage dies erfordert, ihre Heere mit unseren vereint werden gegen diejenigen, die daran denken, Uns und Unseren preußischen Landen den Krieg anzukündigen. Behaltet auch die verwandtschaftlichen Beziehungen mit dem geehrten Markgrafen, unserem Schwiegersohn und mit seiner Gemahlin, unserer geliebten Tochter, in Erinnerung, und sprecht über diese Angelegenheiten gesondert […]. Versäumt es auch nicht, in derselben Angelegenheit mit Moritz, dem Kurfürsten von Sachsen zu sprechen sowie mit den Markgrafen Johann und Albert von Brandenburg.“13
Neben den offiziellen Gesandtschaft en des polnischen Königs gab es auch andere Gruppen, die den Reichstag besuchten und in gewissem Maß als Teil einer polnischen Öffentlichkeit angesehen werden können. Zu erwähnen sind erstens die Gesandten der preußischen Herzöge und insbesondere des Herzogs Albrecht von Brandenburg-Ansbach, die zwischen den 1520er und 1560er Jahren auf beinahe jedem Reichstag anwesend waren. Bei ihrer Beobachtung der Aktivitäten des Deutschen Ordens und den Bemühungen zur Lösung des Banns gegen Albrecht arbeiteten diese Beauftragten stets mit den polnischen Gesandtschaft en zusammen. Über die enge Abstimmung und die gemeinsamen Schritte sind wir aus den Berichten und Briefen des preußischen Rats Asverus von Brandt gut informiert.14
Anwesend waren auf mehreren Reichstagen auch Agenten und Informatoren der preußischen Städte, in erster Linie Danzigs, die bei der Einforderung von Reichssteuern oder Vorladungen vor das Reichskammergericht ebenfalls die polnischen Gesandtschaft en unterstützten. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erschienen auf Reichstagen schließlich Angehörige des preußischen Herrenstandes wie die Truchsessen zu Waldburg oder insbesondere die Dohnas, die den Reichsgrafentitel führten.15 Fabian von Dohna nahm – zeitweise in pfälzischen Diensten – an vier Reichstagen teil, sein Neffe Abraham trat auf dem Warschauer Sejm 1611 wie auch auf dem Regensburger Reichstag 1613 als brandenburgischer Gesandter auf.
In der Forschung werden in Anlehnung an ältere Arbeiten preußische Reichstagsbesucher zumeist völlig losgelöst von den polnischen Teilnehmern behandelt. Diese Perspektive ist für die Beauftragten Herzogs Albrechts und der preußischen Städte unzutreffend, da diese sich politisch eng an die polnischen Gesandtschaft en anlehnen mussten. Sie ist aber auch für die reformierten Dohnas kaum haltbar, da die Einbindung der Familie in die preußischpolnische Ständegesellschaft übersehen wird. So nahm Fabian von Dohna an zumindest sechs Sejmversammlungen teil.16 Sicherlich diskutabel ist, inwieweit sich die preußischen Teilnehmer als Polen ansahen. Bei Fabian von Dohna, der am pfälzischen Hof als „polnischer Ochs“ wahrgenommen wurde, existierten offenbar tief sitzende Ängste: „Aber ich habe von Jugend auf und alle die Zeit meines Lebens und noch ein solche hertzliche Furcht, Widerwillen, ja Schrecken für der Polnischen Nation gehabt, dass ich es nicht genugsamb kann aussprechen.“17 Wichtiger erscheint jedoch eine andere Fragestellung: Die preußischen Reichstagsbesucher waren auch Teil eines innerpolnischen Kommunikationssystems und gaben – insbesondere in ihren engen Kontakten mit reformierten polnischen und litauischen Adligen – ihre Informationen über die Reichspolitik dorthin weiter. „Zeitungen“ von den Reichstagsund Sejmverhandlungen, die sich bis heute in den Resten des Dohnaschen Familienarchivs in Berlin und Olsztyn erhalten haben, belegen dies.18
Eher passive Reichstagsgäste waren junge polnische Adlige, die sich zu Ausbildungszwecken an deutschen Universitäten aufhielten und von dort aus den Reichstag besuchten. Heidelberg, Altdorf und Ingolstadt, Zentren polnischer Studierender im Reich, lagen nicht weit von den Tagungsorten entfernt.
Eine wechselseitige Übernahme von prozeduralen Mustern ist jedoch nicht nachweisbar. Dafür besaßen Sejm und Reichstag zu stark abweichende Strukturen, genannt seien nur auf polnischer Seite die Gesandtenstruktur mit Landboten, die Periodizität und die zeitliche Begrenzung bei den Sejmverhandlungen. Allerdings ist das wohl bekannteste Werk des polnischen politischen Denkens auch im Zusammenhang einer Beschäftigung mit dem Reichstag entstanden: Andrzej Frycz Modrzewskis Schrift über die Verbesserung des Staatswesens »De republica emendanda« (1551) entstand 1549/50 im Anschluss an dessen Aufenthalt auf dem Augsburger Reichstag und suchte gleichgewichtige ständisch-monarchische Verfassungsstrukturen zu entwickeln, die im Kern auf einer Synthese der polnischen wie der römischdeutschen Reichsverfassung aufsetzten.
Aus der polnischen Perspektive zählte der Reichstag zu den Zentralorten europäischer Kommunikation, dem nach dem Heiligen Stuhl in Rom und dem Kaiserhof europaweit Bedeutung zukam. Dies galt so lange, wie der Jagiellonenhof und die Mehrheit der polnischen Eliten Interessen im Reich besaßen, die unabhängig von Rom oder Wien gewahrt werden wollten. Mit der Lockerung dieses Beziehungsgeflechts im Zuge der Konfessionalisierung und der wachsenden Bedeutung „ostpolnischer“ litauischer und ruthenischer aristokratischer Familien verlor der Reichstag im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts für Polen an Bedeutung.
1 Eine klassische Studie: SCHRAMM, Gottfried: Polen – Böhmen – Ungarn: Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Bahlcke, Joachim (Hrsg.): Ständefreiheit und Staatsgestaltung, S. 13–38.
2 SCHILLING, Heinz: Das Alte Reich – ein teilmodernisiertes System als Ergebnis der partiellen Anpassung an die frühmoderne Staatsbildung in den Territorien und europäischen Nachbarländern, in: SCHNETTGER, Matthias (Hrsg.): Imperium Romanum, S. 279–291, hier S. 288.
3 BÖMELBURG, Hans-Jürgen: Die Tradition einer multinationalen Reichsgeschichte in Mitteleuropa.
4 BÖMELBURG, Hans-Jürgen: Grenzgesellschaft und mehrfache Loyalitäten. Die brandenburgisch-preußisch-polnische Grenze 1656–1772, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 55 (2006), H. 1, S. 56–78; Detailstudie: Motsch, Christoph: Grenzgesellschaft und frühmoderner Staat. Die Starostei Draheim zwischen Hinterpommern, der Neumark und Groß polen (1575–1805), Göttingen 2001.
5 WIJACZKA, Jacek: Stosunki dyplomatyczne; Bömelburg, Hans-Jürgen: Die Wahrnehmung des Reichstags in Polen-Litauen, in: LANZINNER, Maximilian/STROHMEYER, Arno (Hrsg.): Der Reichstag, S. 405–437.
6 „Ain grosser h. [Nikolaus von Rosenberg, aulicus] des kg. von Bolad Botschaft, mit vil dienern“ ist vor dem Rat in Nürnberg erschienen und in Freiburg eingetroff en, berichtet über „Türke vor Krakau“. Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, Band 6: Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg. Bearbeitet von Heinz GOLLWITZER, Göttingen 1979, S. 644 (7.7.1498). Vgl. auch: „Die tete ein lateinisch oracion, gar ein cleglich anpringen.“ Frankfurter Protokollant, ebd., S. 657.
7 Überblick anhand des biographischen Lexikons von Małgorzata DUCZMAL: Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
8 Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Band 10: Der Reichstag in Regensburg und die Verhandlungen über einen Friedstand mit den Protestanten in Schweinfurt und Nürnberg 1532. Bearbeitet von Rosemarie AULINGER, 2 Teile, Göttingen 1992, S. 230.
9 400 lat poczty polskiej. Warszawa 1958, S. 14–25 (S. 16: Abdruck der Ordinatio postae Cracovia – Venetias); Zimowski, Lech: Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, Warszawa 1972, S. 78–81. Eine moderne Geschichte der polnischen Kommunikation ist ein Desiderat.
10 AXER, JERZY/MAŃKOWSKI, Jerzy: Korrespondenz von Johannes Dantiscus (1485–1548). Baltische und skandinavische Problematik, in: MERISALO, Outi/SARASTI-WILENIUS, Raija (Hrsg.): Mare Balticum – Mare Nostrum. Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500–1800), Jyväskylä 1994, S. 150–156; Edition: Corpus epistularum Ioannis Dantisci, hrsg. von Jerzy AXER und Anna SKOLIMOWSKA. Warszawa 2004ff.
11 Akta poselskie i korrespondencye Franciszka Krasińskiego 1558–1576, bearbeitet von Ignacy JANICKI, hrsg. von Władysław KRASIŃSKI, Kraków 1872, S. 129, 130.
12 Die Gesandtschaft von 1486 soll ein Bild einer Tochter des Königs von Polen bei sich gehabt und versucht haben, eine Verbindung mit Maximilian herbeizuführen. Heiratsverbindungen wurden auch 1495 diskutiert, vgl. Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Reichstag von Worms 1495. Bearbeitet von Heinz ANGERMEIER, 2 Teile, Göttingen 1981, S. 778f., 1367f., 1378–1380 (Vermittler war Markgraf Friedrich von Brandenburg).
13 Instruktion Sigismund I. an Olbracht Łaski, Piotrków, 6. Februar 1548, in: ŁASKI, Stanisław: Prace naukowe i dyplomatyczne, Wilno 1864, S. CXL-CXLI.
14 Die Briefe und Berichte des Rats und Gesandten Herzog Albrechts von Preussen Asverus von Brandt nebst den an ihn ergangenen Schreiben in dem königlichen Staatsarchiv zu Königsberg. H. 1–4. Hrsg. von Adalbert BEZZENBERGER, Königsberg 1904–1921; H. 5 bearbeitet von Erhard SPRENGEL, Hameln 1953; WIJACZKA, Jacek: Asverus von Brandt.
15 Achatius von Dohna besuchte 1566 den Reichstag zu Augsburg, vgl. Die Selbstbiographie des Burggrafen Fabian zu Dohna (1550–1621), hrsg. von Christian KROLLMANN, Leipzig 1905, S. 4. Fabian von Dohna besuchte mehrfach den Reichstag in Regensburg (1576, 1594, 1598, 1603), vgl. ebd., S. 10, S. 89–91, S. 98f.
16 Fabian von Dohna 1569 Lublin (ebd., S. 7), 1589 Warschau (ebd., S. 65), 1601 Warschau (ebd., S. 95), 1603 Warschau (zusammen mit Abraham, Friedrich und Achatius), 1605 Warschau (Gesandter der preußischen Stände, ebd., S. 100), 1606 Warschau (ebd.). – Abraham nahm 1611 als brandenburgischer Gesandter teil, vgl. Chroust, Anton: Abraham von Dohna. Sein Leben und sein Gedicht auf den Reichstag von 1613, München 1896, S. 66.
17 Die Selbstbiographie des Burggrafen Fabian zu Dohna, S. 13, 26.
18 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Dohna-Schlobitten, K. 3, Nr. 56, 57, 79, 81; BÖMELBURG, Hans-Jürgen: Lojalność w protestancko-kalwińskiej rodzinie stanu panów w Prusach Książęcych: Trzy pokolenia rodziny Dohnów (1540–1625), in: AXER, Jerzy (Hrsg.): Panorama lojalności, S. 46–62, hier S. 57.