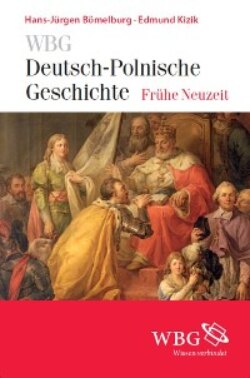Читать книгу WBG Deutsch-Polnische Geschichte – Frühe Neuzeit - Edmund Kizik - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Eine Beziehungsgeschichte in der Frühen Neuzeit (1500–1806)
ОглавлениеDie deutsch-polnische Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte in der Frühen Neuzeit ist von besonderer Bedeutung und Intensität. Sie spielt sich erstmals zwischen zwei Reichsverbänden ab, die nun jeweils die Bezeichnung „deutsch“ und „polnisch“ in ihren Namen tragen: dem Heiligen Römischen Reich „deutscher Nation“ – der Zusatz trat im späten 15. Jahrhundert zu dem älteren Reichstitel hinzu, oft auch kurz als „Altes Reich“ oder „römischdeutsches Reich“ bezeichnet – und der „Krone Polen“ (Korona polska) bzw. der „Polnischen Respublica“ (Rzeczpospolita Polska). Das auch im deutschen Fall ergänzte nationale Attribut, das den sakralen wie imperialen Anspruch der Reichsidee unterhöhlte, macht deutlich, dass nationale Zuordnungen im Humanismus eine neue historisch-gruppenbezogene Grundierung erfuhren und von einem Teil der intellektuellen Eliten in Konkurrenz zueinander formuliert wurden.
Dabei war der jeweilige Herrschaftsraum beider Reiche strittig und wurde in konfliktreichen, aber friedlich ausgetragenen internationalen Diskussionen definiert: Deutschsprachige, in Krakau studierende Humanisten wie Konrad Celtis oder Heinrich Bebel konstruierten in Anlehnung an die antike Geographie des Ptolemäus eine Germania magna, die bis zur Weichsel reichte; polnische Gebildete wie der Posener Bischof Andrzej Krzycki oder Marcin Bielski entwickelten als Antwort eine polnische Nationalgeschichte, die alle Slawen umfasste und die Gebiete bis zur Oder, Elbe oder Weser beschrieb. Der frühneuzeitliche polnisch-litauische Verband reichte bis über den Dnjepr hinaus und gliederte sich große ostkirchliche orthodoxe Territorien ein, die als Teile eines angeblich indigen polnischen Herrschaftsverbandes mit antiker Legitimation angesehen wurden – die polnischen Adligen betrachteten sich als Erben der Sarmatia und Nachfahren der Sarmaten. Die polnisch-katholischen Herrschaftsansprüche in ostkirchlichen Territorien schufen latente Konflikte. So entstanden im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts nationale Argumentationen, die gedruckt wurden und somit zukünftig verfügbar waren.
Beide Staatsverbände – auch das Alte Reich kann mit Georg Schmidt als Reichsstaat bezeichnet werden – weisen in der Frühen Neuzeit eine prinzipielle Gleichberechtigung auf: Ältere Ansprüche einer hierarchisch höheren Stellung des römisch-deutschen Reichs wurden von polnischer Seite konsequent abgelehnt. Mit der Integration des Großfürstentums Litauen in einen immer stärker polnisch geprägten Verband erstreckte sich Polen-Litauen auf über 800.000 km² (1582) und umfasste Teile des heutigen Lettlands, ganz Litauen und Belarus sowie einen großen Teil der heutigen Ukraine und des heutigen Russlands. In beiden Verbänden hatten die Herrscher ähnliche Probleme mit der Durchdringung des Raums unter den schwierigen Bedingungen frühneuzeitlicher Kommunikation: Um von der im Südwesten Kleinpolens liegenden Residenzstadt Krakau bis nach Polock oder Smolensk im Nordosten zu reisen, benötigte man vier Wochen, eine ähnliche Zeit beanspruchte die Reise von Basel bis ins pommersche Stolp. Solche Verbände waren kaum kommunikativ erfassbar und nicht zentral regierbar. Insbesondere die Peripherien waren nur begrenzt beherrschbar und in lockeren Reichslehnverbänden organisiert (Oberitalien, Burgund, Böhmen und Schlesien im Fall des römisch-deutschen Reichs, Preußen, Kurland und Livland im Falle Polen-Litauens). Der deutsche Reichstag und der polnisch-litauische Sejm erfüllten als Nachrichten- und Aushandlungsforen eine vergleichbare Funktion, wobei in beiden zentralen Ständeversammlungen auch die Nachbarn vertreten waren: Der Reichstag wurde im 16. Jahrhundert intensiv von polnischen Delegationen besucht, am Sejm nahmen neben brandenburgischen und habsburgischen Beobachtern auch die deutschsprachigen Eliten des Preußenlandes teil.1
Um 1500 und um 1800 sind deutliche Zäsuren erkennbar. Im frühen 16. Jahrhundert setzten sich neue, dauerhaftere und beschleunigte Kommunikationsformen durch: Frühkapitalistische Handelsnetzwerke erfassten nun auch den deutsch-polnischen Austauschraum, etwa die Bergwerksindustrie im Karpatengebiet (Familien Fugger, Boner, Thurzó) oder die Organisation des Handels mit Agrarprodukten an der Ostsee. Aus den deutschen Gebieten kommend, verbreitete sich das Druckwesen in den großen polnischen Städten, vor allem in Krakau und Danzig. Ein regelmäßiges Postsystem verband Städte wie Wien und Krakau und ermöglichte einen schnelleren Informationsaustausch.
Die zentralen Ständeversammlungen gewannen bedeutende verfassungsrechtliche Kompetenzen: Der Sejm entstand seit 1493 und entwickelte sich zu einem periodischen Aushandlungsforum. Der frühneuzeitliche Reichstag formierte sich seit 1496 und definierte mit den Reichsständen die Machteliten. Die Jahre 1505/06 bilden keine Zäsur, können aber durch Thronwechsel mit dauerhaften Konsequenzen (die formale Übernahme der Herrschaft durch Maximilians Enkel Karl V. in den burgundischen Niederlanden, der Herrschaftsantritt Sigismunds I. in Litauen und Polen) und durch verfassungsrechtliche Festschreibungen (die Konstitution Nihil novi gab dem Sejm in Polen legislative Kompetenzen) die neue Ära symbolisieren.
Das Jahr 1806 dagegen kann sehr wohl als Zäsur betrachtet werden: Mit der Auflösung des Alten Reichs brach der letzte der frühneuzeitlichen Verbände Mitteleuropas zusammen, nachdem Polen-Litauen bereits kurz zuvor in drei Teilungen zwischen Preußen, Österreich und dem Russländischen Reich aufgeteilt worden war (1772, 1793, 1795). Damit verschwanden als „deutsch“ oder „polnisch“ bezeichnete Staatsverbände zugunsten eines preußischen, österreichischen oder russländischen Staates. Gerade die republikanische Öffentlichkeit in Deutschland und Polen sah hier Parallelen, beide Nationen definierten sich um 1800 als „ Kulturnationen“ mit einer Reichsvergangenheit, die auch zukünftig Europa prägen sollten.
Der Raum, in dem sich in der Frühen Neuzeit deutsch-polnische Geschichte abspielt, ist von erheblicher Größe und rechtfertigt den Ansatz einer verflochtenen Geschichte, denn deutsche und polnische Akteure bezogen sich nicht nur aufeinander, sondern agierten auch in den jeweils anderen Reichsgefügen. Der besagte Raum umfasst von Nord nach Süd:
Erstens das seit den 1560er Jahren zeitweise und in seinem südöstlichen Teil (Kurland, Lettgallen) dauerhaft zu Polen-Litauen gehörige südliche Livland mit der Großstadt Riga, das Herzogtum Kurland und Lettgallen, heute die Kernregionen Lettlands. Hier kam es zu umfangreichen Austauschprozessen zwischen deutsch- und polnischsprachigen Adligen, wobei teilweise eine deutsch-polnische Kultur entstand (Familiennamen, Sprachwechsel, Mehrsprachigkeit). Als attraktiv für den Übergang zum Polnischen erwiesen sich einerseits die Karrierechancen am Warschauer Hof, andererseits das Leitbild einer „polnischen Freiheit“, das dem Adel eine dauerhafte Privilegierung versprach (teilweise verbunden mit einem Konfessionswechsel zum Katholizismus). Erst im 18. Jahrhundert bezeichnete eine aufgeklärte Öffentlichkeit, die sich auf das Ideal des wohlgeordneten Staates berief, diese „Freiheit“ als „Unordnung“ oder, mit einer Übernahme aus dem Französischen, als „Anarchie“. Hier kam es zu einem folgenschweren Missverständnis: Während der polnische Adel diese „Freiheiten“ und die „Unordnung“ als unvermeidliche Begleiterscheinungen von Partizipation und Demokratie auffasste, sahen die deutschen Bürger nur „Anarchie“ und „Niedergang“ bis zur sprichwörtlichen „polnischen Wirtschaft “ (→ S. 104).
Zweitens zählten zu dem Austauschgebiet die litauischen Städte und ein Teil der Adels- und Gutsbesitzerfamilien, die intensive Kontakte nach Königsberg unterhielten. In den Städten im Großfürstentum Litauen lebten polnisch-, jiddisch- und deutschsprachige Bevölkerungen nebeneinander (Wilna/Vilnius, Kauen/Kaunas, auch in kleineren Städten wie Tauroggen/Tauragė oder Keidanen/Kėdainai). Hier kam es zu Transferprozessen, wobei sich die deutschsprachige Stadtbevölkerung schrittweise sprachlich polonisierte und staatsrechtlich lituanisierte.
Drittens bildete das Preußenland von Pommerellen bis zur Memel einen Kontakt- und Austauschraum. Die Region zerfiel in das „Preußen königlich polnischen Anteils“ (weiter „königliches“ oder „polnisches Preußen“, nach 1772 „Westpreußen“) und das östliche „Herzogtum“, ab 1701 „Königreich Preußen“. Die Stadtbevölkerung des Preußenlandes war mehrheitlich deutschsprachig, die bäuerliche und adlige Bevölkerung gemischt. In den Metropolen (Danzig, Elbing, Thorn) und kleinen Städten vollzogen sich wechselseitige Akkulturations- und Assimilationsprozesse. Insbesondere der Adel nahm die „polnischen Privilegien“ als ein attraktives Partizipationsmodell wahr und orientierte sich durch die Nähe der Hauptstadt Warschau stärker am polnischen Lebensstil.
Viertens lebte in Schlesien, Großpolen und Hinterpommern seit der mittelalterlichen Ostsiedlung eine gemischte deutsch-polnische Bevölkerung. In der Frühen Neuzeit kam es hier zu Assimilationsprozessen an die Mehrheit, in Oberschlesien an die polnischsprachige, an der mittleren Oder an die deutschsprachige Bevölkerung. Durch neue, auch konfessionell motivierte Migrationen – die Auswanderung protestantischer Bevölkerungen infolge der habsburgischen Bedrückung und die Gründung neuer Städte auf der großpolnischen Seite der Grenze wie Lissa und Unruhstadt, die Einwanderung der katholischen Bamberger – entstanden auch neue deutsch-polnische Verflechtungen.
Fünftens gab es in Kleinpolen und Rotreußen in den Städten und in einigen ländlichen Enklaven gemischte deutsch-polnische Bevölkerungen. Hier kam es in der Frühen Neuzeit auch aufgrund der fehlenden Konfessionsgrenze zu einer Assimilation der deutschen Minderheiten an die polnische Mehrheitsbevölkerung (Krakau, Lemberg, Kamieniec Podolski).
Sechstens besitzen Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit Bedeutung für den deutsch-polnischen Kulturkontakt. In allen drei Regionen waren parallel deutsch- und polnischsprachige Eliten tätig, Polen etwa in Olmütz, wo sie Domkanoniker und Bischöfe stellten, oder in Ungarn und Siebenbürgen, wo Familien wie die Łaski im Gefolge der Jagiellonen sowie der Zápolyas und Báthorys bis ins späte 16. Jahrhundert Politik machten. Schließlich entstand durch die Teilungen Polens nach 1772 ein gänzlich neuer Kontaktraum, da nun deutschsprachige Beamte in preußischen und österreichischen Diensten nach Płock, Białystok oder Lemberg kamen. Die Tätigkeit deutschsprachiger Verwaltungen löste Konflikte sowie Exklusionsprozesse aus und mündete in eine Stereotypie langer Dauer.
Bei der Auswahl der zu behandelnden Themen sind Auswahl und Konzentration unumgänglich: Nach einem Strukturvergleich beider Staatsverbände und einem Blick auf die Beziehungsgeschichte mit dem Schwerpunkt im 16. Jahrhundert (Kap. 1) geht es um die migrationsgeschichtlich in der Frühen Neuzeit bedeutsamen deutsch-polnischen Kulturkontaktzonen (Kap. 2). Durch frühkapitalistische Handelskontakte zogen pfälzische und elsässische Kaufleute nach Krakau und Kleinpolen oder Deutsche und Polen nach Thorn und Danzig. Davon zu trennen ist eine bäuerliche Migration: Das östliche Preußenland wurde nach den großen Kriegen zwischen 1460 und 1560 von Polen aus Masowien neu besiedelt. Für diese Region und die Bevölkerung sollte in späterer Zeit die Bezeichnung „Masuren“ geprägt werden. Das nördliche Großpolen, der Warthe- und der Netzebruch, die pommerellisch-hinterpommersche Grenze wie auch der ostpreußisch-masowische Grenzraum wurden erst im 17. und 18. Jahrhundert dichter besiedelt, was im Zeitalter der „Peuplierung“ eine Konkurrenz zwischen deutschen und polnischen Eliten um ansiedlungswillige Bauern auslösen konnte. Dabei siedelten deutschsprachige Grundherren polnische Bauern ebenso an, wie deutschsprachige Bauern von polnischen Herren geholt wurden; Bedeutung besaß nur der konfessionelle, nicht der sprachliche Faktor. Historische Siedlungsgebiete wie Migrationen führten dazu, dass in der Frühen Neuzeit sowohl polnischsprachige Menschen im Alten Reich lebten – insbesondere in Schlesien und im östlichen Pommern – als auch deutschsprachige Menschen in Polen-Litauen, insbesondere im „polnischen Preußen“ und im südwestlichen Großpolen. Aktuelle vergleichende Untersuchungen europäischer Genome zeigen, dass gerade Deutsche und Polen genetisch eng miteinander verwandt sind, eine Ursache liegt, neben älterem und jüngerem Bevölkerungsaustausch, in diesen frühneuzeitlichen Migrationen.2
Anschließend werden die eng miteinander verflochtenen Wirtschaftssysteme in den Blick genommen (Kap. 3), wobei aus Gründen der europäischen Relevanz die Akzente auf den oberdeutsch-kleinpolnischen Handelsbeziehungen und dem Wirtschaftssystem Ostseeraum liegen. Auf eine nähere Behandlung etwa der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Schlesien bzw. Brandenburg und Großpolen musste leider verzichtet werden.
Auch religiöse Institutionen und Zentren müssen in ihrer Funktion als deutsch-polnische Begegnungsorte berücksichtigt werden (Kap. 4). Die Wittenberger Reformation strahlte früh nach Polen aus, da das Herzogtum Preußen sowie Livland rasch evangelisch wurden. Auch Angehörige polnischer Eliten traten zur neuen Kirche über, allerdings bremsten Verbote König Sigismunds I. die Bewegung. Eine herausragende Bedeutung besitzt Johannes a Lasco (Jan Łaski), der in Emden zum Reformator Ostfrieslands wurde und 1556 nach Polen zurückkehrte, um dort die Reformation zu verbreiten. Die entstehende reformierte Kirche Polens war stark von Schweizer Vorbildern geprägt, blieb allerdings eine Adelskirche. Kontakte zwischen deutschen und polnischen Calvinisten gab es an den protestantischen Gymnasien Danzigs, Elbings und Thorns, an der Universität Königsberg und an den schlesischen Gymnasien in Beuthen und Brieg. Durch die Ausstrahlung der Reformation in den deutschen Ländern und die wachsende Schwäche der polnischen Reformierten gewannen auch im polnischen Kontext die Lutheraner an Gewicht, der protestantische Klerus wurde an deutschsprachigen Universitäten ausgebildet und die evangelisch-lutherische Kirche immer stärker als „deutsche Konfession“ wahrgenommen.
Die katholische Reform entfaltete sich als eine supranationale Bewegung, an der auch italienische Eliten einigen Anteil hatten. Zugleich verbanden sich etwa im Jesuitenorden deutsche und polnische Milieus: Kardinal Stanislaus (Stanisław) Hosius, der selbst aus dem Krakauer deutsch-polnischen Milieu stammte, gründete das erste polnisch-litauische Jesuitenkolleg im deutschsprachigen Braunsberg an der Ostsee im Bistum Ermland; es beherbergte deutsche wie polnische Jesuiten und deren Schüler. Auch am polnischen Hof hatten wichtige Jesuiten einen deutsch-polnischen Hintergrund, waren zweisprachig und im ermländischen und polnischen Milieu verankert.
Durch herausragende Bischöfe und Domherren sowie als internationaler Karriereort spielte das sprachlich gemischte Bistum Ermland eine besondere Rolle. Ermländischer Domherr war der aus Thorn stammende Nicolaus Kopernikus, der das heliozentrische Weltbild entwickelte. Als Bischöfe waren im Ermland der Dichter und Diplomat Johannes Dantiscus, Stanislaus Hosius, der Historiker Martin (Marcin) Kromer oder im 18. Jahrhundert der bedeutende Aufklärungsschriftsteller Ignacy Krasicki tätig. All diese Persönlichkeiten förderten einen deutsch-polnischen Kulturaustausch. Ähnliche Wirkung entfaltete in Schlesien das Bistum Breslau mit dem Residenzort Neisse, an dem Mitglieder der Familie Thurzó sowie der polnischen Wasadynastie als Bischöfe tätig waren.
Die protestantischen und katholischen Milieus schufen spezifische Begegnungsorte und Austauschkanäle, über die deutsch- und polnischsprachige Eliten zusammenfanden. Die in den gemischtsprachigen Regionen tätigenprotestantischen Pastoren wie die in der Mission tätigen Jesuitenpatres sollten zweisprachig sein, da Seelsorge und Missionierung in der Muttersprache erfolgten. Dabei dürfen wir jedoch für die Frühe Neuzeit keinesfalls die in der Epoche des Nationalismus verbreiteten Zuschreibungen von „polnischen Katholiken“ (Polak-katolik) und „deutschen Protestanten“ übernehmen, Konfessions- und Sprachgrenzen deckten sich nicht.
Deutsch-polnische, gemischte Adelskulturen existierten in der Frühen Neuzeit in Kurland und Polnisch-Livland, im Preußenland, im südlichen Großpolen und in Schlesien (Kap. 5). Die schlesischen Piasten in Brieg und Liegnitz pflegten bis zu ihrem Aussterben 1675 auch ihre polnische Geschichte und polnische Traditionen – vielfach in deutscher Sprache.3 Kur- und livländische Familien wie die Denhof-Dönhofffs, die Hylzen-Hülsens, die Manteuffels, Platers und Tyzenhauz-Tiesenhausens spielten in der polnischen und deutschen Geschichte eine wichtige Rolle. Im litauisch-preußischen Kontext können ihnen die Baysen-Bażyńskis, die calvinistischen Radziwiłłs, die Hutten-Czapskis und Prebendow-Przebendowskis an die Seite gestellt werden. Auch die Landesherren der polnischen Lehnsherzogtümer, die Hohenzollern in Königsberg, die Kettler und Biron in Kurland zählten zu einer deutsch-polnischen adligen Hofkultur. Exilkönig Stanisław Leszczyński residierte in Lothringen, neben seinen Verbindungen nach Paris spielte er als Reichsfürst eine Rolle; sein Hof besaß für den pfälzischen und rheinischen Adel Ausstrahlungskraft. Hier wirderkennbar, dass sich das Netzwerk adliger Kontakte über das gesamte Territorium beider Reichsverbände erstreckte.
Ein besonderes und in der deutschen wie polnischen Historiographie vernachlässigtes Thema bildet die sächsisch-polnische Union 1697–1763 (Kap. 6). Die Personalunion intensivierte die Wirtschaftskontakte (hier wäre an Leipzig zu denken), verband die Hof- und Adelseliten und machte die beiden Residenzstädte Dresden und Warschau zu Orten einer deutsch-polnischen Soziabilität, zumeist übrigens in französischer Sprache. Polnische Adlige hielten sich in Dresden auf, ließen sich dort nieder und erwarben Ämter, sächsische Eliten bekleideten Positionen in Warschau. An den Residenzen mit ihrem internationalen Kunstgeschmack entstand ein Markt für Kunsthandwerker, Maler und Architekten. Die sächsisch-polnische kulturelle Verflechtung trug dazu bei, dass in der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791 das Haus Wettin als regierende Erbdynastie für den polnischen Thron festgeschrieben wurde.
Eine deutsch-polnische Geschichte wäre ohne eine Berücksichtigung der preußischen negativen Polenpolitik des 18. Jahrhunderts und der Teilungen
Polens nicht vorstellbar (Kap. 7). An den Teilungen waren auf preußischer, österreichischer, aber auch russländischer Seite (deutschbaltische Diplomaten und Militärs) deutschsprachige Eliten beteiligt. Die in die annektierten Territorien versetzten preußischen und habsburgischen Beamten besaßen oft keine Landes- und Sprachkenntnisse, verachteten die neuen Untertanen und entwickelten eine neue ausgrenzende Stereotypie. Viele der Beamten nutzten ihre privilegierte Position, um sich auf Kosten der polnischen Untertanen zu bereichern.
Insbesondere zwischen protestantischen preußischen Beamten und katholischen polnischen Eliten kam es zu Verteilungskämpfen und Schuldzuweisungen, ein Konflikt, dem das Stereotyp der „polnischen Wirtschaft “ für eine organisatorische und moralisch-hygienische Unordnung entsprang, während die „deutsche Wirtschaft “ als Vorbild dargestellt wurde. Auf polnischer Seite entstanden gegenüber Preußen und Österreichern Wahrnehmungen einer „Fremdherrschaft “, womit die nationalen Frontstellungen des 19. Jahrhunderts vor gezeichnet waren.
Der zweite Teil – „Fragen und Perspektiven“ – ermöglichte es, auch eher vernachlässigte Themen einer Beziehungsgeschichte zu behandeln. Gerade hier kann man über die Akzente streiten, so verzichteten die Autoren etwa auf ein Kapitel zu Wissen und Wissenschaftskontakten, weil dies für drei Jahrhunderte auf 15 Seiten nicht behandelbar schien, obwohl die Relevanz des Themas außer Frage steht. Auch fehlt ein eigener Abschnitt zu deutschen und polnischen Identitäten und Alteritäten. Beide Themen wurden in einzelne Abschnitte integriert und sind über das Register erschließbar.
Diskutiert werden Fragen und Probleme eines Kulturtransfers, der gerade in der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte durch ältere historiographische Hypotheken eines angeblichen „Kulturgefälles“ von West nach Ost belastet ist (Kap. 1). Neuere Forschungen relativieren dies stark, weisen auf das Süd-Nord-Gefälle hin, beschreiben inselhafte Kultur- und Wirtschaftszentren (für die Frühe Neuzeit in der Region Böhmen und Kleinpolen bzw. das Preußen polnischen Anteils) und innere Peripherien. Auch wird die Akteursperspektive betont, was neue Forschungsmöglichkeiten eröffnet.
Ein äußerst ergiebiges, aber durch ältere gesellschaftsgeschichtliche Traditionen zu Unrecht marginalisiertes Forschungsfeld bilden die frühneuzeitlichen deutsch-polnischen Verflechtungen in Sprache und Literatur (Kap. 2). Für die adligen wie städtischen Eliten spielten zum Erwerb von Bildung, Wissen und Sprachkenntnissen Reisen und Universitätsbesuche eine große Rolle. Die polnischen Eliten bereisten seit dem frühen 16. Jahrhundert im Rahmen der grand tour (später „Kavalierstour“ genannt) neben Italien, Frankreich und den Niederlanden vor allem das römisch-deutsche Reich. Reiseziele waren die Städte am Rhein, im Zuge der konfessionellen Aufspaltung besuchten protestantische Adlige die Universitäten Frankfurt an der Oder, Wittenberg und Leipzig sowie die reformierten Zentren Altdorf, Basel, Heidelberg und Herborn. Katholische Adlige lernten um 1600 an den Jesuitenkollegs in Dillingen, Ingolstadt, Regensburg und im habsburgischen Linz. Mit den teilweise mehrjährigen Aufenthalten junger Menschen an deutschen Bildungseinrichtungen und Höfen ging auch das Erlernen der Sprache einher, bis ca. 1640 war Deutsch nach dem Lateinischen die am häufigsten erlernte Bildungssprache in Polen, die dann durch das Französische als lingua franca verdrängt wurde. Auf der anderen Seite lernten deutschsprachige Preußen und Schlesier Polnisch, Danziger Bürgersöhne wurden zum Erlernen des Polnischen nach Bromberg oder Posen geschickt. Auch die Tätigkeit deutschsprachiger Handwerker am Königshof in Krakau oder Warschau ging oft mit dem Erlernen des Polnischen einher.
Die reichen literarischen Verflechtungen von der erstaunlichen polnischen Karriere des Till Eulenspiegel als Dyl Sowizdrzał (Sowiźrzał), über die Kochanowski- und Sarbiewski-Rezeption durch deutschsprachige Leser bis zu den deutsch-polnischen Lebensläufen eines Martin Opitz und Andreas Gryphius verdienen Beachtung. Zu selten wurde bisher von der deutschen Seite die Ausstrahlung einer frühneuzeitlichen polnischen Schrift- und Literatursprache auch auf deutschsprachige Leser wahrgenommen.
Multikulturellen Austauschregionen, die durch ein starkes Regionalbewusstsein bis hin zu abgebrochenen Nationsbildungen (Preußen) geprägt waren, ist ein eigener Abschnitt gewidmet (Kap. 3). Deutsch-polnische Stadtkulturen gab es zahlreich zwischen Ostsee und Karpaten. Die größten Städte des 16. und 17. Jahrhunderts, Danzig, Krakau, Elbing, Thorn, Posen und Lemberg, besaßen durchweg – in unterschiedlichem Mischungsverhältnis – eine deutschpolnische Rechtsstruktur und zweisprachige Bevölkerungen. Prägend waren die Zentren des Buchdrucks Krakau und Danzig, wo Werke in Deutsch und Polnisch, ebenso Sprachlehrbücher, Sprachführer und Lexika gedruckt wurden.
Die in der Frühen Neuzeit in Polen-Litauen an Bedeutung gewinnenden jüdischen Bevölkerungen müssen unter manchen Fragestellungen in eine deutsch-polnische Verflechtungsgeschichte integriert werden (Kap. 4). So besaßen jüdische Gemeinden eigene Kommunikationsnetze, die aus Zentren wie Krakau, Lublin oder Brody nach Prag, Frankfurt oder Worms reichten. Die zahlenmäßig kleinen Gemeinden im Alten Reich waren auf Ausbildungszentren in Polen-Litauen angewiesen: Die Vorfahren des Rabbi Judah Löw ben Bezalel stammten aus Worms, er wirkte als Rabbiner unter anderem in seiner Geburtsstadt Posen und in Prag, wo er 1609 starb. Es gibt viele solcher deutsch-polnischen rabbinischen Karrieren, wobei jüdische Bildung auch für die Eliten im Reich in Polen-Litauen erworben wurde, also ein Wissenstransfer von Ost nach West stattfand.
Während einerseits ein deutscher wie ein polnischer Staatsverband existierten, ist andererseits zu diskutieren, was „deutsch“ und „polnisch“ in den jeweiligen Dokumenten und Kontexten bedeuteten und in welchen Zusammenhängen national argumentiert wurde (Kap. 5). Hier werden bereits frühneuzeitliche Nationalisierungsprozesse nachgezeichnet, zugleich aber auch die Bedeutung regionaler Identitäten und deutsch-polnischer Symbiosen betont. Zwar sprechen auch Danziger Quellen um 1600 durchaus von der „deutschen“ und „polnischen Nation“,4 doch wird die eigene Geschichte als deutsch-polnische Symbiose aufgefasst. Zwar ist die deutsch-polnische Sprachgrenze aufgrund der Unterschiede zwischen beiden Sprachsystemen auch im europäischen Vergleich relativ hart, doch wird in der Frühen Neuzeit weder auf deutscher noch auf polnischer Seite der Sprache eine entscheidende Bedeutung für die Herausbildung einer Nation zugeschrieben. Ein „Preuße“ (Prusak) – gleich ob deutsch- oder polnischsprachig – konnte bis Ende des 18. Jahrhunderts sehr wohl Teil polnischer staatsbürgerlicher Eliten sein, so wie ein schlesischer Piast sich als aus „polnischem Stamm“ und Fürst des römischdeutschen Reichs fühlen konnte.
Am Ende steht schließlich ein vergleichender Blick auf die Auflösung und Aufteilung beider Staatsverbände (1772–1806), deren Parallelität bisher noch zu selten politisch beschrieben und kulturell gedeutet wurde (Kap. 6). Eine Erinnerungsgeschichte von Reich und polnisch-litauischer Republik wird nur angedeutet, da hier bereits neue Forschungsergebnisse vorliegen.5
Eine deutsch-polnische Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte der Frühen Neuzeit hat so in räumlicher wie thematischer Hinsicht eine Fülle von Fragestellungen zu behandeln, die von der Alltagsgeschichte des Zusammenlebens in Städten und Dörfern über Nachbarschaft en und familiäre Beziehungen, ähnliche und doch abweichende kulturelle Praktiken, wenig stabile konfessionelle Mischungsverhältnisse und sprachliche Durchdringungsprozesse bis zur Eliten- und Verfassungsgeschichte zweier Staats verbände reichen. In der tausendjährigen deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte ist das Besondere der Epoche, dass politisch-pragmatisch eine Parität zwischen beiden Staatsverbänden existierte, die von den Zeitgenossen akzeptiert wurde. Der polnische Adel sah sich als gleichwertiger Partner der Reichseliten an, mehr noch, er unterstrich seine Überlegenheit aufgrund seiner besonderen Freiheiten. Obwohl das 17. Jahrhundert eine kriegerische Epoche war, blieb die Grenze zwischen Altem Reich und Polen bis zu den Teilungen unverändert, jadie deutsch-polnische Grenze kann in der Frühen Neuzeit als eine der friedlichsten Grenzen in ganz Europa gelten.
Die deutsch-polnischen Verflechtungen in diesem Zeitraum sind keinesfalls einzigartig, infolge der Verquickung von politischer Geschichte, Sprachbeziehungen und Kulturtransfer können sie in dieser Epoche mit den deutsch-französischen oder besser – wegen der besonderen Bedeutung des Konfessionellen in beiden Beziehungsgeschichten – mit den polnisch-russischen Beziehungen verglichen werden, die sich auf einem ähnlich großen Raum und ebenfalls mit besonderer Intensität abspielten.6 Wenn wir uns auf die deutschpolnischen Beziehungen konzentrieren, so tun wir dies deshalb, weil historiographisch, strukturell und sprachlich nach wie vor Rezeptionsbarrieren bestehen, die nicht leicht zu überwinden sind. Deutsche wie Polen haben hier Pfade vorgezeichnet – erinnert sei insbesondere an den Berliner Historiker Klaus Zernack mit seiner Konzeption der Beziehungsgeschichte und den Posener Germanisten Hubert Orłowski mit seiner Rezeptionsgeschichte. Dennoch ist das Vorhaben riskant, denn die doppelte Perspektive birgt auch Gefahren einer übermäßigen Parallelisierung. Gewonnen werden kann dabei aber ein neuer Blick auf die mitteleuropäische Geschichte, der für beide Nationalkulturen bereichernd ist und zu intensiveren vergleichenden Forschungen anregen sollte.
1 Es gibt in deutscher und polnischer Sprache keine Überblicksdarstellung über die deutsch-polnischen Beziehungen der Frühen Neuzeit, sondern nur problemorientierte Studien. Für weiterführende Informationen zu Polen-Litauen: Polen in der europäischen Geschichte, Bd. 2 Frühe Neuzeit [im Druck]; außerdem WIJACZKA, Jacek: Stosunki polsko-niemieckie w XVI–XVIII wieku.
2 „Genanalyse: Europäer sind eine große Familie“. Spiegel-online, 08.05.2013.
3 BAHLCKE, Joachim: Deutsche Kultur mit polnischen Traditionen. Die Piastenherzöge Schlesiens in der Frühen Neuzeit, in: WEBER, Matthias (Hrsg.): Deutschlands Osten – Polens Westen, S. 83–112.
4 BUES, Almut (Hrsg.): Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg.
5 HAHN, Hans-Henning /TRABA, Robert (Hrsg.): Deutsch-Polnische Erinnerungsorte.Band 3: Parallelen.
6 ZERNACK, Klaus: Polen und Russland.