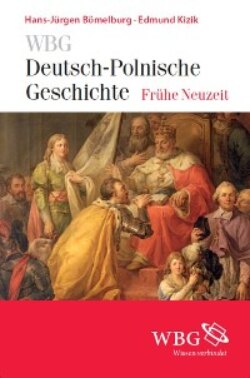Читать книгу WBG Deutsch-Polnische Geschichte – Frühe Neuzeit - Edmund Kizik - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Wirtschaftssysteme und Handelskontakte
ОглавлениеDie deutschen und polnischen Wirtschaftsstrukturen sind in der Frühen Neuzeit über zwei Handelswege miteinander verbunden: Erstens erfolgte im Ostseehandel auf dem Fluss- und Seeweg ein Austausch von Massengütern und Agrarprodukten. Zweitens wurden in der mitteleuropäischen Gebirgslandschaft zwischen Lemberg, der Zips, Kuttenberg (Kutná Hora) und Krakau vor allem Bergbauprodukte (Silber, Kupfer) für einen mitteleuropäischen Markt abgebaut, aus Podolien und Rotreußen importierte man infolge des Bevölkerungswachstums in Mitteleuropa Viehherden bis nach Sachsen und ins Rheinland.
Durch die Grenzveränderungen im 15. und 16. Jahrhundert veränderten sich die Bedingungen für den Warenaustausch: Die Eingliederung des Königlichen Preußens mit Danzig und dem Kulmer Land (1466) gab der wirtschaftlichen Entwicklung Polens vom 16. bis zum 18. Jahrhundert erhebliche Impulse. Die Beherrschung der unteren Weichsel und die Zugehörigkeit der Hansehäfen in Danzig und Elbing zu Polen ermöglichte einen freien Zugang zum Ostseehandel und den Export überschüssiger Agrarprodukte und Güter der Waldwirtschaft über die Flößerei auf der Weichsel und über die Ostsee. Dem stand in Westeuropa ein wachsender Bedarf an Agrarerzeugnissen für die steigende Bevölkerung in den urbanisierten Zentren vor allem der Niederlande gegenüber. Die bäuerlichen Erträge in Zentralpolen und im Königlichen Preußen waren ausreichend hoch, um einen Export zu erlauben. In Danzig und den anderen preußischen Handelszentren verdreifachten sich schon im 15. Jahrhundert die Preise für Getreide, Mehl und das allgemein konsumierte Bier, während die Preise für Handwerkserzeugnisse geringer anstiegen. Ähnlich sah die Preisentwicklung in Krakau aus, wo man 1580 für Butter fünf Mal mehr zahlen musste als zu Beginn des Jahrhunderts, während sich Handwerkserzeugnisse nur um das 2,5fache verteuerten. Der Öffnung dieser Preisschere folgten im frühen 17. Jahrhundert Preissprünge gerade bei Lebensmitteln und Holz, die insbesondere den Produzenten in Ostmitteleuropa beträchtliche Gewinne bescherten, zumal sich auch die polnischen Städte, deren Bevölkerung nicht zuletzt infolge von Migration wuchs, am Konsum beteiligten.
Die Preissteigerungen im Ostseeraum mündeten in eine stärkere Produktion für den Markt und erhöhte Exporte. Während 1470 über Danzig kaum 2200 Lasten Getreide (1 Last = 2190 kg) verschifft wurden, waren es 1490 schon 9500 Lasten. Zwischen 1530 und 1583 kam es zu einem beispiellosen Anstieg der Ausfuhr von 10 200 auf 62 800 Lasten.36 Dies war nur dank des Aufbaus einer Infrastruktur in Polen möglich – die Landwirtschaft stellte sich stärker auf den Export ein, ausgebaut wurde ein für den Markt produzierendes Vorwerkssystem, bei dem Gesinde und Bauern Frondienste leisten mussten; entlang der gesamten Weichsel entstanden Getreidespeicher, in Danzig die Speicherinsel. Die hier im 16. Jahrhundert geschaffenen Strukturen prägten Polen-Litauen wie West- und Mitteleuropa bis ins 19. Jahrhundert, sie bedeuteten erstens die Entstehung eines Frühkapitalismus in Westeuropa, vor allem in den Niederlanden, und zweitens in Ostmitteleuropa den Ausbau eines Systems, das in der Forschung als „zweite Leibeigenschaft “ charakterisiert worden ist: Rechtlich verloren die Bauern teilweise ihre persönliche Freiheit, wurden an die Scholle gebunden und mussten auf den Vorwerken Frondienste leisten. Der Adel sicherte sich durch politischen Druck das Monopol an Landbesitz und wurde im 16. Jahrhundert zum größten Nutznießer des neuen wirtschaftlichen Systems. Seine Gewinne teilte er vor allem mit den Bürgern der Städte Danzig, Elbing, Thorn, Königsberg und Riga, die als Vermittler im überregionalen Handel auftraten. Der Wirtschaftsraum zwischen Augsburg und Nürnberg, Krakau und Lemberg sowie den ungarischböhmischen Zentren (Leutschau/Levoča/Lőcse, Kuttenberg, Prag) war im frühen 16. Jahrhundert durch den Bergbau und die gewerbliche Produktion geprägt. Rheinische, Augsburger und Nürnberger Handelshäuser unterhielten in Krakau Filialen und schickten Familienmitglieder dorthin – auf diesem Wege kamen die Fugger und Boner nach Krakau. Als Handelspartner der Fugger agierten in diesen Netzwerken die aus Oberungarn stammenden Thurzós. Insbesondere die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und Krakau bzw. Posen waren im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert ausgesprochen eng.37
Während sich der Silber- und Kupferbergbau auf Böhmen und Oberungarn konzentrierte, wurden in Kleinpolen vor allem Blei und Salz abgebaut. Blei und das für die Färberei und die Glasproduktion wichtige Bleioxid (Massikot, Bleigelb) wurden vor allem in Olkusz abgebaut und von dort aus im 16. und frühen 17. Jahrhundert zu den Hütten in Böhmen und Sachsen transportiert.38 Ungarisches Kupfer gelangte im 16. Jahrhundert über die Weichsel und Danzig nach Hamburg, später jedoch über Böhmen und die Elbe. Ein wichtiges gewerbliches Produkt stellte Salpeter dar, das als Ausgangsprodukt für die Sprengstoffproduktion der Kontrolle durch den Sejm unterlag. Im Dreißigjährigen Krieg unterstützte König Sigismund III. die Habsburger unter anderem dadurch, dass er den Export von Salpeter nach Böhmen freigab. Polnisches, vor allem in den Bergwerken in Wieliczka und Bochnia gewonnenes Salz wurde auch in Böhmen und Schlesien vertrieben.
An der Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit spielten die mitteleuropäischen Gebirge mit ihren Gold-, Silber- und Kupfervorkommen für die europäische Münzproduktion eine Schlüsselrolle. Das böhmische und oberungarische Silber versorgte auch den polnischen Markt, 1526 und 1528 vereinheitlichte der Sejm die polnische Münzproduktion durch einen festgelegten Münzfuß, nach dem auch die preußischen Städte ihre Münzen schlugen. Die polnischen Goldmünzen (Dukaten) besaßen einen ähnlichen Münzfuß wie die böhmischen und ungarischen Dukaten (Florin), zwischen den Silbermünzen bestand ein vergleichbares Verhältnis. Mit der Überschwemmung des europäischen Rohstoffmarktes durch spanisches Silber aus Südamerika verlor dieses mitteleuropäische Bergbau- und Münzsystem nach und nach an Bedeutung. Erhalten blieben im 17. und 18. Jahrhundert in Polen vor allem der Salz- und Bleiabbau, jedoch besaßen Städte wie Prag oder Krakau nicht mehr die überregionale Ausstrahlung auf die europäische Wirtschaft wie noch um 1500. Die Beteiligung Kleinpolens am europäischen Fernhandel war deshalb nach 1550 rückläufig.
Wichtig blieb in der ganzen Frühen Neuzeit der Viehhandel zwischen Süd polen und dem Alten Reich. Ochsen- und Rinderherden wurden aus Podolien, manchmal sogar aus der Walachei bis nach Sachsen und an den Rhein getrieben.39 Von besonderer Bedeutung waren der Jahrmarkt in Jarosław an der ruthenisch-polnischen Sprachgrenze und der Viehmarkt im schlesischen Brieg, wo jeweils die Herden ihre Besitzer wechselten. Nach zeitgenössischen Schätzungen wurden in Jarosław jährlich 40.000 Ochsen verkauff, von denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts jährlich 20.000 Ochsen auf den Viehmarkt nach Brieg gelangten.40
Grundsätzlich lässt sich der deutsch-polnische Wirtschafts- und Warenaustausch in der Frühen Neuzeit nicht quantifizieren. Während die Unterlagen für den Getreideexport über die Ostseehäfen erhalten sind, waren die Zollregister für den Handel über Land bereits in historischer Zeit unvollständig und verbrannten 1944 bei der Zerstörung Warschaus durch die Deutschen. Aus älteren Arbeiten und erhaltenen Teilüberlieferungen lässt sich nur die Struktur des Warenaustauschs, nicht jedoch das Volumen des Güterverkehrs ermitteln. Deutlich erkennbar ist, dass vor allem Agrarprodukte und Rohstoffe aus Polen ausgeführt, dagegen gewerbliche Waren und handwerkliche Produkte aus dem Reich eingeführt wurden. Massenhaft aus Polen ausgeführt wurden Häute, Pelze und Wachs, eingeführt vor allem schlesische Textilien, Papier und handwerkliche Metallprodukte, für die sich im Polnischen nach einem der wichtigsten Produktions- und Handelsorte der Begriff „Nürnberger Waren“ (norymberszczyzna) einbürgerte. Werkzeuge und Metallprodukte wie Sensen und Messer wurden auch aus Österreich und Böhmen importiert. Allein im Jahr 1534 kamen über die Zollstation Posen 71.000 Sensen nach Polen.
Auf der Basis fragmentarischer Daten geht die Forschung davon aus, dass die Handelsbilanz zwischen dem Reich und Polen-Litauen im 16. und 17. Jahrhundert in etwa ausgeglichen war. Von den sich verbessernden terms of trade durch die steigenden Preise für die Agrarprodukte profitierte vor allem der polnische Adel: Geschätzt wurde, dass ein Adliger für dieselben Agrarerzeugnisse im letzten Jahrzehnt vor 1600 etwa 90 % mehr Produkte erwerben konnte als zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Im späten 17. und im 18. Jahrhundert verschlechterte sich die Handelsbilanz zu Ungunsten Polens. Hierfür waren mehrere Faktoren verantwortlich: Erstens schottete das Monopol der Danziger Kaufleute die polnischen Händler von den Märkten im Ostseeraum ab. Das zentralpolnische städtische Bürgertum verfügte im 17. Jahrhundert nicht über die politischen, rechtlichen und finanziellen Instrumente, um mit dem ausländischen Handel und den günstig eingeführten Importprodukten konkurrieren zu können. Im 17. Jahrhundert gelangen Krakauer oder Warschauer Bürgerfamilien nicht mehr die Karrieren, wie sie im 16. Jahrhundert noch die Boners oder Baryczkas machten. Auch die Danziger und Elbinger Kaufleute verloren im späten 17. Jahrhundert ihre Position im Ostseehandel zugunsten von Niederländern und Engländern. Die Danziger und Elbinger Kaufleute beschränkten sich im Großen und Ganzen auf die Vermittlungstätigkeit in den eigenen Häfen, für die sie ein Monopol besaßen.
Zweitens verloren auch im Handel über Land polnische Kaufleute an Bedeutung, da sie selten weiter als bis Breslau wirtschaftliche Beziehungen unterhielten. Einflussreich waren die Krakauer jüdischen Kaufleute, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts bereits mehr als 10 % des polnischen Handels mit Schlesien abwickelten.41 Erst die sächsisch-polnische Union (1697–1763) brachte einen Umschwung, da die auf Synergien ausgerichtete staatliche Wirtschaftspolitik (→ S. 81) den Absatz von polnischen Produkten in Sachsen ankurbelte. Polnisch-jüdische Kaufleute nutzten nun verstärkt Leipzig und die dortigen Messen als Drehscheibe im West-Ost-Handel.
Diese ökonomische Struktur verfestigte sich noch im 18. Jahrhundert, als die deutschen Territorialstaaten westlich der polnischen Grenzen, vor allem Brandenburg-Preußen, eine strikt merkantilistische Warenpolitik einführten und den Import von Fertigprodukten aus dem Osten mit hohen Zöllen belegten.
Die trotz der jeweils verschiedenen Entwicklungspfade in enger Verflechtung ablaufende Handelswirtschaft zwischen dem westlichen Europa und Ostmitteleuropa schuf ein System wechselseitiger Spezialisierungen: Polen konzentrierte sich durch den Ausbau der kultivierten Fläche und die Intensivierung der Landwirtschaft auf eine Produktionssteigerung bei Agrarprodukten, während sich in Westeuropa durch Investitionen eine diversifizierte gewerbliche Produktion entwickelte. Die polnischen Akteure, an erster Stelle der Adel, gewannen durch ihre wirtschaftliche Machtposition die Möglichkeit, eine stadtbürgerliche Konkurrenz auszuschalten (vgl. die einzelnen Bestimmungen des Sejms, die bürgerlichen Landerwerb verhinderten), eine Besteuerung der eigenen Erträge zu blockieren und so den Aufbau eines Fiskalstaats zu behindern.
Im römisch-deutschen Reich verstärkte diese Strukturierung des Güteraustauschs die Vorstellung von Polen als dem „Speicher Europas“, der für die ostdeutschen Territorialstaaten (insbesondere Brandenburg-Preußen) Abschöpfungsmöglichkeiten bereithielt. Dass dieser Entwicklungsweg in Exklusionsprozesse und wirtschaftshistorische Sackgassen führte, war den damaligen Akteuren nicht bewusst. Das Bürgertum der preußischen Städte, vor allem Danzigs, konnte sich durch die Gewinne aus der Vermittlungstätigkeit beim Export der Agrarprodukte und eine abgesicherte Position der Städte in der Landesverfassung gegen eine Exklusion und Deklassierung zur Wehr setzen. Nur die Danziger Kaufleute durften die oft von jüdischen Faktoren in die Speicherstadt gebrachten Agrarprodukte aufkaufen und an niederländische oder englische Schiffe weiterverkaufen.
Die adligen Akteure in Polen waren zwar mit der mächtigen Position der Danziger Bürger unzufrieden, konnten aber deren Position, die sich auf beträchtliche finanzielle Mittel und mächtige Festungswerke stützte, nicht erschüttern. Zugleich ermöglichten die Einnahmen aus dem Handel mit Agrarprodukten ein bequemes Leben und gaben die Möglichkeit, kunsthandwerkliche Produkte zu erwerben oder die eigenen Residenzen auszubauen. Einer der einflussreichsten polnischen Schriftsteller der Renaissance, der Calvinist Mikołaj Rej, führte aus, dass der Adel stolz darauf sei, dass „wir Polen mit wenig Arbeit und geringen Bemühungen ihre [der Ausländer] kunstvollen Arbeiten und ihre Mühen mit Leichtigkeit uns aneignen können“.42
Drei Generationen später, im Jahr 1632, konstatierte der Krakauer Domherr und Schriftsteller Szymon Starowolski: „Im Handwerk können unsere Leute nicht sehr gut arbeiten, aber seit alten Zeiten arbeiten sie mit fremden Handwerkern zusammen und nutzen ihre Dienste in nicht geringer Zahl.“43 Gerade aus dem deutschen Sprachraum, aber auch aus Italien und den Niederlanden kamen zahlreiche Kunsthandwerker, Maler und Architekten nach Polen, die wiederum Arbeitstechniken und handwerkliche Errungenschaft en mitbrachten.
Inwieweit diese ostmitteleuropäische Wirtschaftsform die bäuerliche Bevölkerung auszehrte, ist in der aktuellen Forschung umstritten. Einerseits muss darauf hingewiesen werden, dass es Bauernaufstände etwa in Süddeutschland, in Thüringen und im preußischen Samland (1525) gegeben hat, nicht aber in Zentralpolen. Gerade für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts ist die relativ günstige Lage der polnischen Bauern verbürgt, die teilweise auch von der Agrarkonjunktur profitieren konnten. Im späten 16. und vor allem im 17. Jahrhundert gibt es Hinweise darauf, dass der Adel die bäuerliche Bevölkerung gezielt ausbeutete. Anzelm Gostomski erklärte in seinem Hausväterbuch, es sei „die Arbeit der Bauern das größte Einkommen in Polen“.44 Der adlige Schriftsteller Hieronym Morsztyn verkündete dann nach 1600, wie er mit den Bauern umgehe, sei seine Angelegenheit, und im Falle einer Widersetzlichkeit solle das Haus des Bauern zugesperrt und dieser selbst am bloßen Leib mit der Peitsche bestraft werden. Der Topos einer bäuerlichen Unfreiheit in Polen verbreitete sich im 18. Jahrhundert in ganz Europa und wurde auch von deutschen bürgerlichen Reisenden (seltener von Adligen) beschworen. Wie die tatsächliche Lage der Bauern aussah, muss jedoch von Region zu Region differenziert betrachtet werden. Der „polnische Bauer“ spielte eine wichtige Rolle in Rückständigkeitsdiskursen über Polen, ist aber eher eine Gegenfolie aufgeklärter Autoren, die sich an den kritisierten Zuständen abarbeiteten, als eine wirtschaftshistorisch nachweisbare Realität. Im 18. Jahrhundert wurden die aufstrebenden Residenzstädte Dresden und Berlin, in denen sich zahlungskräftige Personen befanden, für polnische Einwanderer und Wirtschaftsunternehmer zunehmend attraktiv. Ein solcher war Johann Ernst Gotzkowsky (Gockowski), der in seiner Autobiographie formulierte: „Mein Vater war ein Polnischer von Adel, und durchgehends als ein ehrlicher Mann bekannt.“45 Adam Gockowski war ein Kleinadliger aus der Region Konitz. Nach dem Tod seiner Eltern wuchs Johann Ernst Gotzkowsky in Dresden auf und kam 1724 zu seinem älteren Bruder nach Berlin. Er eröffnete eine Handelsfirma, stieg zu einem Hoflieferanten auf und zog im Auftrag Friedrichs II. Handwerker und Kunsthandwerker nach Berlin. Durch Lieferungen für den preußischen Hof erwarb er ein Vermögen. Er eröffnete in Berlin eine Porzellan- und Seidenmanufaktur, handelte im Auftrag des Hofes mit Kunstwerken (unter anderem kaufte er die Gemälde für die Galerie in Sanssouci) und baute mit der Zeit eine eigene Kunstsammlung auf.46 Im Siebenjährigen Krieg verhandelte Gotzkowsky mit den russischen Besatzungstruppen, führte eine Minderung der Kontributionen herbei, beteiligte sich aber auch an Getreidespekulationen mit russischen Generälen. Dies führte 1763 zu seinem Bankrott. Um seine Schulden bezahlen zu können, verkaufte er seine Gemäldesammlung, die die Zarin Katharina II. zum Grundstock der Eremitage in Petersburg bestimmte. Die Porzellanmanufaktur wurde von Friedrich II. aufgekauft und bildete den Anfang der Königlichen Porzellan Manufaktur (KPM), Gotzkowsky selbst starb verarmt.
36 SAMSONOWICZ, Henryk: Miejsce Gdańska w gospodarce europejskiej w XV w., in: CIEŚLAK, Edmund (Hrsg.): Historia Gdańska, 5 Bde. Gdańsk, Sopot 1978–1997, Bd. 2, 1454–1655, S. 107, 110–115; BOGUCKA, Maria: Zmiany w handlu bałtyckim na przełomie XVI i XVII w., in: ebd., S. 445–464.
37 SIMSCH, Adelheid: Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und Posen im europäischen Wirtschaftsverkehr des 15. und 16. Jahrhunderts, Wiesbaden 1970.
38 MOLENDA, Danuta: Eksport polskiego ołowiu na rynki niemieckie w XVI i XVII w. – rola Gdańska, in: KOWECKI, Jerzy /TAZBIR, Janusz (Hrsg.): Ludzie, kontakty, kultura XVI– XVIII w., Warszawa 1997, S. 65–71.
39 HORN, Maurycy: Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII w., in: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 24 (1962), S. 73–88; BASZANOWSKI, Jan: Z dziejów handlu polskiego w XVI–XVIII w. Handel wołami, Gdańsk 1977.
40 GULDON, Zenon /WIJACZKA, Jacek: Handel Polski ze Śląskiem i z Niemcami w pierwszej połowie XVII wieku, in: WIJACZKA, Jacek (Hrsg.): Stosunki polsko-niemieckie, S. 179– 203, hier S. 191.
41 KAZUSEK, Szymon: Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku, Kraków 2005, S. 265–314.
42 REJ, Mikołaj: Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszą, in: REJ, Mikołaj: Zwierciadło, Kraków 1568.
43 Simonis Starovolsci Polonia sive status Regni Poloniae descriptio, Coloniae 1632.
44 GOSTOMSKI, Anzelm: Gospodarstwo, hrsg. von Stanisław INGLOT, Wrocław 1951, S. 115; LIPIŃSKI, Edward: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku, Wrocław 1975, S. 86.
45 GOTZKOWSKY, Johann Ernst: Geschichte eines patriotischen Kaufmannes. 1768, in: Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins, Heft 7, Berlin 1873, S. 6. Volltext: http://opus.kobv.de/zlb/volltexte/2012/13843 (01.12.2012).
46 FRANK, Christoph: Die Berliner Gemäldesammlungen Gotzkowsky, Eimbke und Stein, in: NORTH, Michael (Hrsg.): Kunst sammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, S. 11–194; SCHEPKOWSKI, Nina Simone: Johann Ernst Gotzkowsky. Kunstagent und Gemäldesammler im friderizianischen Berlin, Berlin 2009.