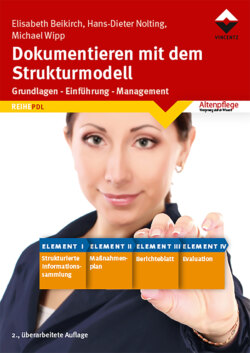Читать книгу Dokumentieren mit dem Strukturmodell - Elisabeth Beikirch - Страница 10
Оглавление1 Konzertierte Aktion zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation und Entlastung für die Pflege – Hintergründe und Anlass
Historie und Rückblick
ELISABETH BEIKIRCH, HILDEGARD ENTZIAN, MICHAEL WIPP / Im Rahmen der über ein Jahrzehnt geführten Debatte zur Entbürokratisierung der Pflege hatte das Thema Pflegedokumentation von Anfang an eine herausragende Rolle. Ein ausufernder Zeitaufwand für die Pflegedokumentation bei gleichzeitig nicht erkennbarem Nutzen für den Pflegealltag war seit vielen Jahren ein Dauerthema im Rahmen der Umsetzung der Pflegeversicherung, der aufsichtsrechtlichen Qualitätsprüfungen auf Landesebene und der Diskussion über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege alter Menschen. Eine breite Gruppe von Pflegekräften empfand den Zeitaufwand für die täglichen Dokumentationsanforderungen als „Wahnsinn“, eine ihnen oktroyierte praxisferne Anforderung, die sie von der Pflege und Beschäftigung mit den auf Unterstützung angewiesenen pflege- und hilfebedürftigen Menschen abhielt.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben vielfach gezeigt, dass Einrichtungen auf Kritik von Prüfinstanzen an der Pflegedokumentation in aller Regel mit „mehr Dokumentation“ reagieren und seltener mit einer fachlich fundierten Anpassung. Eine Ursache für diese Entwicklung wird in den unterschiedlichen Grundlagen zu suchen sein, die Einfluss auf die Dokumentationsgestaltung nehmen:
■ Pflegewissenschaftliche, pflegefachliche Erkenntnisse
■ Rechtliche Anforderungen (Bund und Länder)
■ Prüfkriterien, Empfehlungen und Auflagen der Prüfinstanzen (MDK und Aufsichten)
■ Gestaltung und Handhabung in den Diensten und Einrichtungen
Im Zeitraum von 1996 bis 2007 gab es auf Bundes- und Landesebene umfangreiche Modellvorhaben und Aktivitäten (Leitfaden/Musterdokumentation/Standards etc.) zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation (vgl. Tabelle 1). In mehreren Ländern wurden bereits vor mehr als 10 Jahren Modellprojekte zur Entwicklung und Erprobung vereinfachter Dokumentationsverfahren finanziell gefördert (z. B. Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein). Diese Modellprojekte wurden extern begleitet, zum Teil auch juristisch bewertet und evaluiert. Sie waren allerdings untereinander nicht abgestimmt. Trotz guter Ergebnisse und Erfahrungen in den Projekten haben sich diese bürokratieärmeren Verfahren in den Ländern nicht durchgesetzt. Dies lag sicherlich nicht an der Qualität der Ergebnisse, dass diese Konzepte und Vorschläge für eine effiziente Pflegedokumentation in der Fläche nicht verankert wurden, sondern an einer Reihe von Verquickungen ganz unterschiedlicher Bedingungsfaktoren. Vielfach wurde hierfür der Einfluss der Prüfinstanzen (MDK/Aufsichten der Länder) auf die Dokumentation angeführt sowie vielfältige gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Eine ebenso große Rolle spielte aber auch die Frage, inwieweit das Qualitätsmanagement der Pflegeeinrichtungen, die Bildungsträger, und die Träger selbst die Umsetzung der Ergebnisse dieser Modellvorhaben in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich unterstützten oder sie in Frage stellten. Sich widersprechende juristische Aussagen und ein teilweise mangelndes Interesse von Dokumentationsherstellern trugen ebenso dazu bei und so wurden die Ergebnisse im zeitlichen Verlauf verwässert. Insgesamt war dieser Mix von Faktoren, der sich regional auch sehr unterschiedlich darstellte, landesintern kaum zu durchbrechen. In einer der späteren Expertensitzungen wurde resümiert: Es brauchte wohl einer bundesgesteuerten massiven Intervention, um tatsächlich bundesweit einen stabilen Durchbruch bei der Pflegedokumentation zu erzielen.
KURZ GESAGT: Diese Modellprojekte haben allerdings bereits vor einem Jahrzehnt gezeigt, dass auf der Grundlage der Regelungen des SGB XI, der Vereinbarungen der Selbstverwaltung sowie der aufsichtsrechtlichen Regelungen in den Ländern eine bürokratiearme Dokumentation prinzipiell möglich und umsetzbar ist.
Dennoch soll an dieser Stelle auch ausdrücklich erwähnt werden, dass eine Reihe von Pflegeeinrichtungen sich auf der Grundlage der Ergebnisse aus den oben erwähnten Modellvorhaben mit Fragen der effizienten Pflegedokumentation im Laufe der Zeit auseinandergesetzt und ihren eigenständigen Weg zu einer schlanken Pflegedokumentation bei Einhaltung fachlicher Qualitätsstandards gefunden haben. Vielleicht erhalten sie durch die Ergebnisse aus dem aktuellen Entbürokratisierungsprojekt noch weitere Anregungen, um ihre Dokumentationspraxis zu optimieren oder ihr Vorgehen wird im Wesentlichen bestätigt.
Tabelle: Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
| Beauftragung | Inhalt |
| Forschungsbericht 261 im Auftrag des BMAS, 1996 | Die Bedeutung des Pflegeplanes für die Qualitätssicherung in der Pflege |
| Projekt im Auftrag des Bayerischen Sozialministeriums, 2003 | Entbürokratisierung der Pflegedokumentation einschließlich Rechtsgutachten |
| Projekt im Auftrag des Sozialministeriums RheinlandPfalz | Musterdokumentation für den stationären Bereich 2004, (2. Auflage 2008); ambulanter Bereich 2006, (2. Auflage 2011) |
| Modellvorhaben im Auftrag des Sozialministeriums Schleswig-Holstein, 2004 | Das schleswig-holsteinische Modell: Vereinfachte Pflegeplanung und -dokumentation einschließlich Rechtsgutachten |
| Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS), 2005 | Grundsatzstellungnahme Pflegeprozess und Pflegedokumentation |
| BMG und BMFSFJ, Runder Tisch Pflege, AG III Entbürokratisierung, 2005 | Empfehlung zur Entwicklung einer Leitlinie oder Expertenstandard zur Pflegedokumentation |
| Gutachten im Auftrag des BMFSFJIdentifizierung von Entbürokratisierungspotenzialen… (2006) | Umfangreiche Empfehlungen zur Entbürokratisierung in der Pflege durch ein Kompetenzteam u. a. auch zur Pflegedokumentation |
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), 2006 | Entbürokratisierung – ein Märchen wird wahr Diskurs mit zentralen Akteuren aus Politik, Verbänden, Praxis und Wissenschaft zum ‚Kooperativen Aufsichtshandeln‘ und Dokumentation |
| Modellvorhaben im Auftrag des Sozialministeriums Nordrhein-Westfalen – Näher am Menschen, 2007 | Referenzmodell, Teilberichte 4 und 6: Grundsätze zur Ausgestaltung verbesserter Formen der Dokumentation anhand von vier Schwerpunkten |
| Arbeitsgemeinschaft Entbürokratisierung Pflegedokumentation in Hamburg, 2007 | Erstellung eines Pflegedokumentationsmodells für das Land Hamburg |
| Initiative Neue Qualität der Arbeit, inqa.de, 2010 | Handlungshilfe für die Praxis: Entbürokratisierung in der Pflege mit Schwerpunkt Pflegedokumentation und Qualitätsmanagement |
| Arbeitsgruppe im Auftrag des Sozialministeriums in Rheinland-Pfalz, 2011 | Zwei Musterdokumentationen für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen |
| Bericht der Bundesregierung Erfüllungsaufwand im Bereich Pflege (Statistisches Bundesamt), 2013 | Umfangreiche Erhebungen zu Kosten und Aufwand von Antragsverfahren in der Pflege, u. a. eine Analyse der jährlichen Kosten für die Pflegedokumentation in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen (SGBXI) |
| Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Beauftragung einer Ombudsperson zur Entbürokratisierung der Pflege, 2011/2014 | Entwicklung Lösungsstrategien u. a. Fokus Pflegedokumentation und Praxistest‚ Strukturmodell zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in 5 Bundesländern |
| Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Einrichtungs- und Kostenträgern und den Ländern, 2015/2017 | Bundesweite Implementierungsstratgie zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen der Langzeitpflege (SGB XI) |
Arbeitsgruppe „Entbürokratisierung“ im Rahmen des ‚Runden Tisch Pflege‘
Auch der ‚Runde Tisch Pflege‘ – eine gemeinsame Initiative der Bundesministerien für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) und für Familie Senioren Frauen und Jugend (BMFSFJ) – ging 2005 auf die Beschwerden aus der Praxis ein und griff in der Arbeitsgruppe III ‚Entbürokratisierung‘ das Thema Pflegedokumentation auf und empfahl unter Punkt 3.2:
„Der Runde Tisch Pflege fordert, eine übergreifende Leitlinie für eine Dokumentation des Pflegeprozesses in Abstimmung mit den Prüfkriterien des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur Pflegedokumentation zu erarbeiten und zu verabschieden, die für alle ambulanten Dienste und stationären Einrichtungen nachvollziehbare und überprüfbare Kriterien an die Hand gibt.“
In der Begründung hierzu wurde u. a. ausgeführt: „Gegenwärtig sind zahlreiche Projekte und Initiativen zur Weiterentwicklung von Pflegedokumentationssystemen zu beobachten. Grundsätzlich sind jene Aktivitäten zu begrüßen, welche einen fachlich begründeten Beitrag leisten. Aufgrund der Vielfalt der Ansätze sind die Aktivitäten jedoch zu bündeln. Es mangelt an einer verbindlichen Leitlinie zum Thema ‚Pflegedokumentation‘ Daher sollte geprüft werden, einen Expertenstandard ‚Dokumentation des Pflegeprozesses‘ zu erstellen, der als gemeinsame Aufgabe des Pflegemanagements und der Pflegefachkräfte sowie weiterer beteiligter Berufsgruppen anzuerkennen und umzusetzen wäre.“
In einem begleitenden Gutachten im Auftrag des BMFSFJ zur ‚Identifizierung von Entbürokratisierungspotenzialen in Einrichtungen der stationären Altenhilfe in Deutschland‘ wurden von einem Kompetenzteam im Rahmen einer wissenschaftlichen Analyse u. a. zum Thema Entbürokratisierung der Pflegedokumentation umfangreiche Merkmale der Über-, Unter- und Fehldokumentation sowie diverse Schnittstellenproblematiken identifiziert und Handlungsempfehlungen für Veränderungen ausgesprochen (2006). Hier finden sich unter Punkt 5.2 zum Thema Pflegedokumentation folgende Ausführungen:
„Eine Zentrierung der Pflegedokumentation auf die für eine fachgerechte und individuelle Pflege erforderlichen Inhalte ist nötig. Dazu bedarf es einerseits einer Reduzierung des Umfangs der Dokumentation und andererseits einer Vervollständigung der Inhalte. Um dieses leisten zu können, braucht die Praxis Orientierungshilfen.
Benötigt werden ERSTENS HANDLUNGSLEITLINIEN zur Pflegedokumentation, die den Verantwortlichen Anhaltspunkte für Auswahl und Gestaltung des Pflegedokumentationssystems und Dokumentationsregeln liefern. Sie sollten zudem Grundlage des fachlichen Dialogs von Heimen und Prüfinstanzen sein. Diese Handlungsleitlinien
■ werden zeitnah benötigt, um die Situation in den Heimen zu stabilisieren und der Vergeudung von Ressourcen in zahllosen Einzelprojekten entgegen zu wirken,
■ sollen theoretisch fundiert und praxisnah formuliert sein und den Pflegeleitungen konkrete Umsetzungsbeispiele (aber nicht Formulare) an die Hand geben,
■ sollen ein plausibles Spektrum von Pflegeproblemen abdecken. Gegenwärtig verändern sich Pflegesituationen jeweils dann und nicht immer zum Vorteil, wenn ein Thema in der Fachöffentlichkeit aktuell diskutiert wird,
■ sollen ein Mindestmaß an Einheitlichkeit der Pflegedokumentation in der stationären Altenhilfe fördern. Zurzeit finden Mitarbeiterinnen oft bei Stellenwechsel ihnen unbekannte Dokumentationssysteme vor, in die sie sich mit hohem Aufwand einarbeiten. Den Ausbildungsstätten wird von Heimseite vielfach die unzulängliche Vermittlung von Dokumentationswissen vorgeworfen. Hier könnten Handlungsleitlinien eine Verbesserung und Annäherung bewirken.
Gebraucht werden ZWEITENS QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE für Pflegeleitungen, um diese fachlich und in ihrer Leitungsposition zu stabilisieren. Diese Qualifizierungsangebote sollen
■ pflegefachliche und Dokumentationskenntnisse festigen und erweitern. Die Anfälligkeit für Dokumentationsmoden, die Neigung zur ‚sicheren‘ Dokumentation, die Ausrichtung an den Erwartungen der Prüfinstanzen können nur abgebaut, die notwendige inhaltliche Arbeit kann nur geleistet werden, wenn die Pflegeleitung fachlich ‚sattelfest‘ ist.
■ auf die Pflegedokumentation bezogene Fragen der Mitarbeiterführung und -entwicklung beinhalten.
■ das Thema Pflegedokumentation im organisatorischen Kontext behandeln. Oft muss parallel am Pflegesystem, an den Arbeitszeitregelungen, an der Gestaltung der Dienstübergaben, am Delegationsverfahren etc. gearbeitet werden, um die Pflegedokumentation nachhaltig zu verbessern.“
In der Zusammenfassung wird an anderer Stelle u. a. festgestellt: „Überdokumentation bindet Zeit und frustriert die Pflegenden, die Pflegedokumentation und pflegerisches Tun als nicht zusammengehörend erleben. Sie fördert das mechanische ‚Abarbeiten‘ von Dokumentationspflichten ohne die erwartete Sicherheit zu bieten.“ Zehn Jahre später spielen alle diese Aspekte – mit kleinen Veränderungen – im Rahmen der Implementierungsstrategie immer noch eine gleich große Rolle.
Im Sinne des eingeforderten Handlungsleitfadens war sicherlich die Grundsatzstellungnahme des Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) im Jahr 2005 zum Thema Pflegeprozess und -dokumentation für viele Pflegeeinrichtungen von Bedeutung. In dem Vorwort finden sich folgende Ausführungen:
„Ziel dieser Grundsatzstellungnahme ist es, den Pflegefachkräften in den Einrichtungen, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Mitarbeitern der Medizinischen Dienste eine praxisverbessernde und „entbürokratisierende“ Arbeitshilfe anzubieten. Basis ist der Stand des Wissens zum Thema Pflegeprozess und die gesetzlichen Regelungen (u. a. Krankenpflegegesetz) vor dem Hintergrund der zunehmenden Eigenständigkeit der Pflege.
Die aktuell in Zusammenhang mit Entbürokratisierungspotenzialen in Pflegeeinrichtungen geführte Diskussion um Planung und Dokumentation von Pflege ist kein neues Thema. In einigen Bundesländern sind zwischenzeitlich Initiativen zur Neugestaltung der Dokumentationssysteme in Gang gekommen. Im Unterschied dazu legt diese Grundsatzstellungnahme den Fokus auf die inhaltliche Ausgestaltung des Pflegeprozesses und seiner Dokumentation.
Das hier vorgelegte Papier flankiert damit die bereits in einigen Bundesländern bestehenden Initiativen zur Pflegdokumentation.“
In dieser Grundsatzstellungnahme wurden bereits Hinweise zu unterschiedlichen Modellen der fachlichen Ausgestaltung des Pflegeprozesses (4-, 5- und 6-schrittiges Modell) und Grundlagen einer fachgerechten Pflegedokumentation zusammengestellt. Es wurde für die nachfolgenden Ausführungen eine klare Präferenz für den 6-phasigen Pflegeprozess ausgesprochen. Diese Stellungnahme zielte nicht auf eine Musterdokumentation ab, sondern sollte den Pflegeeinrichtungen Hilfestellung und Orientierung für eine fachgerechte Gestaltung ihrer Pflegedokumentation bieten. Sie hat aber sicherlich ganz maßgeblich die Standardisierung und Gestaltung der Dokumentationssysteme der Hersteller mit beeinflusst. Dennoch geriet auch diese Stellungnahme aus dem Blickwinkel der Aufmerksamkeit als durch das Pflege-Weiterent-wicklungsgesetz (2008) vielfältige neue Bedingungen geschaffen wurden.
Pflegedokumentation im Kontext der externen Qualitätssicherung im SGB XI
Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde das Konzept der Qualitätssicherung im SGB XI grundlegend neu ausgerichtet und um mehrere Elemente gleichzeitig erweitert:
■ die Verpflichtung zur Vereinbarung von Maßstäben und Grundsätzen zur Pflegequalität und der Regelung von Anforderungen an eine praxistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und die Pflegequalität fördernde Pflegedokumentation, die über ein für die Pflegeeinrichtungen vertretbares und wirtschaftliches Maß nicht hinausgehen dürfen“ (§ 113 SGB XI) sowie
■ an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement „ (§ 113 SGB XI),
■ Regelungen zur Entwicklung von verbindlichen Expertenstandards (§ 113 a SGB XI), die im Bundesanzeiger veröffentlicht werden,
■ eine jährliche unangemeldete Regelprüfung, in die die Ergebnisqualität integriert wird (§ 114 Abs. 2 SGB XI) und
■ die Verpflichtung der Pflegekassen zur Veröffentlichung von Transparenzberichten für den Verbraucher, in denen auch Aspekte der Lebensqualität darzustellen sind (§ 115 Abs. 1a SGB XI).
In der Folge bestand für die Vertragsparteien gemäß § 113 SGB XI die Herausforderung, diese neuen Elemente in die zu erstellenden Qualitätsprüfrichtlinien (QPR) und in die Transparenzkriterien einfließen zu lassen und zugleich eine Verschränkung zwischen beiden Instrumenten herzustellen. Dies hatte enorme Auswirkungen an die Anforderungen des Pflege- und Qualitätsmanagements sowie auf Art, Umfang und inhaltliche Ausrichtung der Pflegedokumentation in den Pflegeeinrichtungen. Die Pflegedokumentation erfuhr deshalb eine so große Bedeutung, weil sie nunmehr das zentrale Instrument wurde, mit dem die Pflegequalität entlang der Kriterien der QPR und der Pflegetransparenzvereinbarungen ambulant und stationär (PTVS/PTVA) von den Einrichtungen dargelegt werden konnte. Zwar waren auch sogenannte Inaugenscheinnahmen bei pflegebedürftigen Personen vorgesehen, welche jedoch stichprobenartig erfolgten. Die Pflegedokumentation wurde in ihrer Relevanz als „Beweismittel“ dadurch kaum geschwächt.
Die Prüfkriterien und der Stellenwert der Pflegedokumentation im Prüfverfahren führten in den Einrichtungen zu einer (selbstgewählten) Dokumentationspraxis, die aus Sicht der Pflegenden primär kontrollbezogen ausgerichtet war und in dieser Ausprägung und ihrem Umfang für den beruflichen Alltag nur von begrenztem Nutzen. Dies ging einher mit der Wahrnehmung, dass pflegefachliche Kompetenz und berufliche Erfahrung von untergeordneter Bedeutung waren. Im Praxistest stellte sich später heraus, dass die meisten Pflegefachkräfte eine sehr distanzierte Haltung zur Pflegedokumentation hatten und sie nicht mehr als ihr eigentliches Arbeitsinstrument zur Steuerung des Pflegeprozesses ansahen.
Darüber hinaus wurde angeführt, dass mündlich vorgetragene Erkenntnisse zum Leistungsgeschehen im veränderten Prüfverfahren nicht akzeptiert wurden, wenn sie nicht unmittelbar aus der Pflegedokumentation hervorgingen, selbst bei nicht zu beanstandender Bewertung des Zustandes und zur Zufriedenheit des Pflegebedürftigen („was nicht dokumentiert ist, ist nicht geschehen“). In der Konsequenz konnte dies zu einer negativen Beurteilung (Notengebung) führen, ohne dass für den Verbraucher und für die Allgemeinheit deutlich wurde, ob es sich um einen Versorgungs- oder einen Dokumentationsfehler handelte.
In den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen gab es auch vor 10 Jahren bereits einen breiten Konsens für eine professionell ausgestaltete Pflegedokumentation und eine interne sowie externe Qualitätssicherung. Hierzu hatten auch die Vorgaben zur Qualitätsentwicklung im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz und der hohe Fachverstand sowie die beratende Funktion der Medizinischen Dienste maßgeblich beigetragen. Dennoch bot der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) eine ideale Projektionsfläche für alles, was mit überbordender Dokumentation zu tun hatte, egal woher die Anforderungen stammten. Dabei waren nicht selten auch Vorgaben der Träger, der eingekauften Dokumentationssysteme oder Anweisungen des Qualitätsmanagements für einen hohen Dokumentationsaufwand verantwortlich.
Die Kritik der Pflegenden an einer ausufernden Pflegedokumentation u. a. auch durch parallele Prüfverfahren von MDK und Aufsichten der Länder mit zum Teil unterschiedlichen Aussagen zur Dokumentationspraxis sowie damit einhergehender fehlender Zeit für die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen wurde im Zuge der laufenden Entbürokratisierungsdebatte wiederholt bestätigt. In den Jahren 2009 bis 2011 verstärkte sich durchgängig der Eindruck, dass sich die Thematik trotz der Empfehlungen des „Runden Tisch Pflege“ und trotz aller Modellvorhaben weiter verschärft hatte. Nicht selten wurden die Politik aber auch die zentralen Akteure der Selbstverwaltung (Einrichtungs- und Kostenträger) aufgefordert „diesen Wahnsinn zu stoppen“. Selbst engagierte Bürgerinnen und Bürger und Selbsthilfeinitiativen schalteten sich in die Entbürokratisierungsdebatte ein und forderten, dass die Pflegekräfte von „Schreibarbeiten“ entlastet werden müssten.
Bestellung einer unabhängigen Ombudsperson zur Entbürokratisierung der Pflege durch den Gesundheitsminister im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Im Jahr 2011 wurde der zuständige Bundesgesundheitsminister erneut mit massiven Forderungen zur dringend notwendigen Entbürokratisierung in der Pflege konfrontiert. Es bestand ein breiter Konsens in der Fachöffentlichkeit darüber, dass die Pflegedokumentation auch in Folge des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes (2008) und Regelungen der Aufsichten der Länder ein überbordendes Ausmaß im Pflegealltag angenommen hatte. Insbesondere die Positionen von Pflegeeinrichtungen und der verschiedenen Prüfinstanzen standen sich in puncto einer angemessenen Dokumentation vielerorts „unversöhnlich“ gegenüber und es herrschte diesbezüglich ein „Klima“ des allgemeinen Misstrauens.
Der damalige Minister berief eine unabhängige Ombudsfrau im BMG zur Entbürokratisierung der Pflege, die in ihrem Zwischenbericht (2012) u. a. als ein zentrales Problem im pflegerischen Alltag einen völlig überhöhten Dokumentationsaufwand in ambulanten und stationären Einrichtungen der Langzeitpflege (SGB XI) wie folgt skizzierte:
■ Fehlende Übersichtlichkeit und Orientierung zur Steuerung des Pflegeprozesses (Methoden/Instrumente) und geringes Vertrauen in die Fachlichkeit der Pflegenden.
■ Ungeklärte Fragen (und Mythen) zum notwendigen Dokumentationsumfang aus haftungs- und vertragsrechtlicher Sicht, insbesondere im Kontext des Risikomanagements, Regressforderungen der Kostenträger und Nachweispflichten (stationär) zu durchgeführten Leistungen (sog. ‚angstgetriebene Pflegedokumentation‘).
■ Unterschiedliche Auffassungen der Vertragsparteien zu Konzepten der Transparenz im Leistungsgeschehen gegenüber Kostenträgern und Verbrauchern (QPR und Transparenzkriterien).
■ Geringe Akzeptanz bei den Pflegenden in Bezug auf Art und Umfang der etablierten Prüfverfahren und der Kriterien zur öffentlichen Darstellung der Pflegequalität von Pflegeeinrichtungen (Notengebung).
■ Unterschiedliche Anforderungen an die Pflegedokumentation im Rahmen der externen Qualitätssicherung gemäß SGB XI und der Wohnpflegegesetze der Länder (parallele Prüfungen).
Die Ursachen hierfür waren vielfältig und sowohl durch trägerinterne als auch externe Faktoren bestimmt. Sie gingen einher mit der Umsetzung mehrerer zentraler politischer Entscheidungen: die Föderalisierung des Heimrechts und in der Folge 16 verschiedene Prüfleitfäden, die Neuausrichtung der Externen Qualitätssicherung (QPR), die Einführung einer Qualitätsberichterstattung (Transparenzkriterien) im SGB XI sowie die Einführung von Expertenstandards und die Anforderungen des Gesetzgebers zur Darlegung von Lebensqualität, Selbstbestimmung und Individualität pflegebedürftiger Menschen. Hinzu kamen die nicht zählbaren einrichtungsintern entstandenen Anforderungen und trägerorientierten Dokumentationsanforderungen.
Eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes (2013) ergab, dass Pflegekräfte rund 13 Prozent ihrer Arbeitszeit pro Schicht allein für die Pflegedokumentation aufwendeten. Die jährlichen Kosten für die Pflegedokumentation in Einrichtungen der Langzeitpflege (SGB XI) wurden in Höhe von ca. 2,7 Milliarden Euro beziffert. Davon entfielen allein in der stationären Pflege rund 1,9 Milliarden Euro auf Einzelleistungsnachweise.
Der enorme Umfang der Pflegedokumentation verringerte einerseits die Zeit für die direkte Pflege und Betreuung und belastete die Pflegefachkräfte in ihrem beruflichen Alltag erheblich und verursachte andererseits erhebliche Kosten. Es musste dringend ein Lösungsweg gefunden werden, da dieser Missstand die Arbeitsbedingungen und die Motivation der Pflegenden beeinflusste und damit auch die Attraktivität der Arbeit in der Langzeitpflege maßgeblich beeinträchtigt wurde. Ein Befund, der angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege von erheblicher Bedeutung war.
Die Pflegedokumentation – ein zentrales Thema der Entbürokratisierung in der Pflege
Es erfolgte der Auftrag an die Ombudsfrau, sich im Rahmen der Entbürokratisierung der Pflege ganz auf die Pflegedokumentation zu konzentrieren und für die damit im Zusammenhang stehenden Themen einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Zu beachtende Dimensionen der Pflegedokumentation stellten sich damals im Wesentlichen wie folgt dar:
■ Sicherstellung der Kommunikation und Steuerung des Pflegeprozesses (Methoden /Instrumente/Fachlichkeit),
■ (Haftungs-) Rechtliche Aspekte im Kontext der Risikoeinschätzung und Regressforderungen,
■ Transparenz gegenüber dem Verbraucher sowie interne Verfahren der Qualitätssicherung und Bedeutung der Pflegedokumentation für alle an der Pflege und Betreuung Beteiligten,
■ Anforderungen im Rahmen der externen Qualitätssicherung (SGB XI) und der Wohnpflegegesetze der Länder,
■ Qualifikationsmix in den Pflegeeinrichtungen und die Fachlichkeit der Pflegenden,
■ Spezielle Rahmenbedingungen der einzelnen Versorgungssegmente (stationär/ambulant/Tagespflege/Kurzzeitpflege).
In den Prozess der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation wurde die Expertise von allen Stakeholdern in einer Expertengruppe eingebunden: vertreten waren die Praxis und das Management aus den Versorgungsbereichen, die Pflegewissenschaft mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die Prüfinstanzen auf Bundes- und Landesebene und die privaten und freigemeinnützigen Verbände. In einer zusätzlichen Unterarbeitsgruppe wurden die speziellen Aspekte der ambulanten Pflege bearbeitet.
Weitere fachliche Expertise von Kostenträgern, Juristen, Berufsverbänden, der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, von größeren Trägerorganisationen sowie verschiedenen Referaten im BMG wurden zu einzelnen Zwischenergebnissen punktuell eingebunden.
Einerseits gab es eine rasche Verständigung, dass die vielfach von der Praxis gewünschte Erarbeitung einer ‚Musterdokumentation‘ fachlich nicht zielführend und auch nicht sinnvoll wäre, um die Vielfalt der Versorgungsstrukturen und trägerspezifischen Vorgehensweisen zu berücksichtigen. Andererseits sollten sich die Experten dennoch auf eine Grundstruktur und Prinzipien der Dokumentation (sogenannte ‚Minimalita‘ einer Pflegedokumentation) verständigen, die fachlichen und juristischen Überprüfungen Stand hält. Dies sollte den Einrichtungen Sicherheit und die gewünschte Orientierung bieten, aber auch die von einer breiten Fachöffentlichkeit und bereits dem ‚Runden Tisch Pflege‘ geforderte Verständigung und Abstimmung im Prüfgeschehen zwischen den Heimaufsichten der Länder und den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK) sowie dem Prüfdienst der PKV erleichtern.
Ziele der Entbürokratisierung und Entwicklung einer schlanken Pflegedokumentation (Strukturmodell)
Folgende Ziele waren mit der Erarbeitung eines Lösungsvorschlags durch die Expertengruppe zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation verbunden:
■ Verständigung zu einer Grundstruktur der Pflegedokumentation, die fachlichen und rechtlichen Aspekten Stand hält (keine Musterdokumentation) und Akzeptanz bei allen zentralen Akteuren findet,
■ Praxistauglichkeit und Zeitersparnis ohne fachliche Standards zur Steuerung des Pflegeprozesses zu vernachlässigen,
■ Anschlussfähigkeit im Hinblick auf Reformvorhaben in der Pflege (neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff/Begutachtungsinstrument),
■ Aufhebung des Eindrucks für Prüfinstanzen zu dokumentieren und Beendigung der Entwicklung einer „angstgetriebenen Dokumentation“,
■ Berücksichtigung vorliegender Ergebnisse aus Modellvorhaben auf Bundesund Landesebene sowie Gutachten zur Thematik Pflegedokumentation und Entbürokratisierung.
Die Neuausrichtung der Pflegedokumentation auf der Grundlage des erarbeiteten Strukturmodells greift auf erprobte fachwissenschaftliche und juristische Wissensstände aus den letzten 15 Jahren zurück. Insofern wurde auf viele bekannte Informationen zurückgegriffen, was mitunter zu dem Hinweis führt, dass das Strukturmodell nichts „wirklich Neues“ ist. In der Tat ist das Strukturmodell eine Weiterentwicklung auf der Basis der vorhandenen Erkenntnisse, die inhaltlich überarbeitet und deren Wirkung entlang von festgelegten Prinzipien im Vorgehen noch klarer herausgestellt wurden.
Die vier Elemente des Strukturmodells folgen einer konsequenten Ausrichtung der Pflegedokumentation an einer personzentrierten Pflege und sind aufeinander bezogen. Sie beinhalten eine veränderte Dokumentationspraxis zum Einstieg in den Pflegeprozess, die Konzentration der Verlaufsbeobachtung auf Abweichungen und aktuelle Ereignisse sowie die Abkehr von schematischen Routinen bei der Risikoeinschätzung und der Evaluation. Das Strukturmodell beinhaltet einen entscheidenden Durchbruch im Hinblick auf Zeitersparnis und Förderung der Fachlichkeit sowie den Einbezug aller an der Pflege und Betreuung Beteiligten. Bei konsequenter Anwendung der Prinzipien des Strukturmodells und entsprechenden Schulungen aller Beteiligten geht dies nach bisherigen Erkenntnissen einher mit einer besseren Orientierung und Übersichtlichkeit sowie größerer Mitarbeiterzufriedenheit. Der hier skizzierte Entwicklungsprozess mit seinen Entscheidungen und Begründungen wird im Folgenden noch einmal knapp zusammenfassend beschrieben (vgl. auch Abschlussbericht zum Praxistest).
Zur Entwicklung des Strukturmodells
Schritt eins:
Das Strukturmodell wurde in Anlehnung an die Ergebnisse aus einem Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Bedeutung der Pflegeplanung für die Qualitätssicherung der Pflege (Nr. 261/1996) entwickelt. Der Vorschlag der Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin Prof. U. Höhmann war bereits damals, den Pflegeprozess in vier Schritte zu gliedern (WHO Modell) und den Ausgangspunkt des Dialogs mit der pflegebedürftigen Person konsequent aus dem Blickwinkel des auf Pflege- und Betreuung angewiesenen Menschen abzubilden. Erst dann sollte die pflegefachliche Perspektive einfließen und daraus in einem Verständigungsprozess das Ergebnis für die Versorgungsplanung abgeleitet werden (personzentrierter Ansatz). Diese Grundidee wurde in das Strukturmodell in Form der Strukturierten Informationssammlung aufgenommen. Sie wurde mit den Expertengruppen entlang der gegenwärtigen Rahmenbedingungen in der Pflege und den Anforderungen an eine effiziente Pflegedokumentation für die ambulante und die stationäre Pflege jeweils angepasst.
Schritt zwei:
Darüber hinaus wurde die Entscheidung getroffen, sich in der SIS®von dem in der Praxis etablierten ATL Modell nach Roper, Logan und Tierney (1996) bzw. dem AEDL Modell von Krohwinkel (1993) zu lösen und sich grundsätzlich von einem schematischen Ankreuzverfahren bei der Situationseinschätzung und der Pflegeplanung zu trennen. Pflege- und betreuungsrelevante biografische Daten sollten hierin integriert und nicht auf einem extra Bogen erfasst werden. Die in der Praxis vielfach angewandten umfangreichen Biografiebögen wurden im Hinblick auf die Bedeutung der Dokumentation pflege- und betreuungsrelevanter biografischer Angaben zur Steuerung des individuellen Pflegeprozesses als wenig zielführend eingeschätzt.
Zudem wurde das Ziel verfolgt, die neue Pflegedokumentation zu anderen aktuellen Themen in der Pflege (neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff/Begutachtungsinstrument) und künftigen Entwicklungen (verändertes Verfahren der Qualitätssicherung) anschlussfähig zu machen.
Schritt drei:
Ergänzend fand eine kritische Auseinandersetzung zu bekannten Vorgaben des Qualitätsmanagements, insbesondere der schematischen Anwendung von Assessmentinstrumenten, Skalen und diversen Protokollen zur Risikoeinschätzung und auch in Folge von Prüfereignissen statt. Hierbei wurde deutlich, dass es ebenfalls einer fachlichen Aufarbeitung zum Verständnis und der praktischen Anwendung von Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) bedarf. Zusätzlich spielten Unsicherheiten in Bezug auf eine sachgerechte Dokumentation im Hinblick auf haftungsrechtliche Aspekte aus Sicht der Träger eine große Rolle. Es war von Bedeutung hierfür (erneut) eine tragfähige Lösung herauszuarbeiten, da beide Aspekte von den Pflegenden und den Trägern ganz maßgeblich als eine wesentliche Ursache für den überbordenden Dokumentationsaufwand genannt wurden.
Grundstruktur zur Neuausrichtung der Pflegedokumentation
Abb.1: Pflegeprozess und Darstellung der neuen Pflegedokumentation sowie Vorgaben des Qualitätsmanagements (Wipp/Beikirch, 2012)
Darüber hinaus sollte durch das Strukturmodell – angepasst für die ambulante und stationäre Pflege - eine Basis geschaffen werden, um eine grundsätzliche Verständigung aller zentralen Akteure auf Landes- und Bundesebene zu Art und Umfang der Pflegedokumentation (Grundstruktur) und die Herstellung von Verbindlichkeit zu erreichen (Verfahrenssicherung).
Damit waren die wesentlichen Eckpunkte zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in der Langzeitpflege wie in der Abb. 1 dargestellt festgelegt.
Zielsetzung und Aufbau der Strukturierten Informationssammlung (SIS®)
Eine Herausforderung war die konzeptionelle Umsetzung des Einstiegs in den 4-phasigen Pflegeprozess in Form einer Strukturierten Informationssammlung, die den Pflege- und Betreuungsbedarf eines Menschen wie auch seine Risikofaktoren für das Eintreten von Pflegebedürftigkeit als Grundlage pflegerischen Handelns individuell erfasst.
Den individuellen Wünschen und Vorstellungen pflegebedürftiger Personen zu einem selbstbestimmten Leben (auch bei gesundheitlichen Einschränkungen), den eigenen Wahrnehmungen zur Situation und den persönlichen Vorstellungen von Hilfe und Pflege sollte bewusst Raum gegeben werden. Diese narrativ ermittelten Informationen sollten „ungefiltert“ dokumentiert werden. An diesem Punkt wurden die Unterschiede der ambulanten und der stationären Pflege in den Expertenteams deutlich: Das Verständnis, die „ungefilterte“ persönliche Sichtweise und die individuellen Vorstellungen der Betroffenen an den Beginn der Anamnese zu stellen, war für die Pflegefachkräfte der ambulanten Pflege sehr viel selbstverständlicher als für diejenigen aus der stationären Pflege.
In Anlehnung an die konzeptionelle Vorgehensweise aus dem oben genannten Forschungsvorhaben, Erfahrungen mit Fragestellungen aus einer Untersuchung zur Relevanz des ‚Kontrollbesuchs‘ (§ 37 Abs. 3 SGB XI) bei Pflegebedürftigen und Expertenschilderungen zu praktischen Erfahrungen mit Fragestellungen bei der Pflegeplanung von psychisch Kranken, wurde im Ergebnis das ‚Feld B‘ (Eingangsfragen an die pflegebedürftige Person) gebildet. Es wurde weiterhin entschieden, dieses Feld bewusst von den sechs Themenfeldern zur Dokumentation der „fachlichen Perspektive“ (Feld C1) abzusetzen.
Einen breiten Raum nahm die Diskussion ein, wie das erste Element des Pflegeprozesses – die Informationssammlung – auf eine fachwissenschaftliche Grundlage gestellt und trotzdem erreicht werden kann, dass der Dokumentationsumfang übersichtlich und praxistauglich bleibt. Nach Vorstellung und Diskussion verschiedener Varianten (z. B. pflegediagnostische Verfahren, Clusterung der AEDL-Systematik, Struktur der Pflegecharta etc.) wurde sich schließlich dafür ausgesprochen, sich an die Themenfelder des 2017 in Kraft gesetzten Begutachtungsinstruments anzulehnen.
Folgender konzeptioneller Gedanke war hierfür leitend: Den in dem Begutachtungsinstrument formulierten Themengebieten zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit lag die wissenschaftliche Analyse von (inter-) national bekannten Instrumenten zur Erfassung von Pflege- und Hilfebedarf zugrunde. Diese Untersuchung wurde von einer Expertengruppe des Instituts für Pflegewissenschaft (Universität Bielefeld, u. a. Prof. K. Wingenfeld und Prof. A. Büscher) im Rahmen der Entwicklung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begutachtungsassessments (NBA) durchgeführt.
Das heißt, es lag eine fundierte wissenschaftliche Grundlage von Themenfeldern vor, durch die sich ein individueller Pflege- und Hilfebedarf gut identifizieren lässt. In einem Anlagenband zum Bericht des NBA waren aus den pflegewissenschaftlichen Literaturrecherchen zusätzlich ausführliche fachliche Hinweise zur praktischen Nutzung für die Pflegeplanung zu finden. In Zusammenarbeit mit der Expertengruppe wurden entlang der acht Module des NBAs für die Themenfelder in der SIS®fünf pflegerelevante (Kontext) Kategorien gebildet:
1. Kognition und Kommunikation
2. Mobilität und Bewegung
3. Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
4. Selbstversorgung
5. Leben in sozialen Beziehungen
Für den ambulanten Sektor wurde die Thematik „Haushaltsführung“ als sechste Kategorie hinzugefügt. Nach dem Praxistest kam für die stationäre Pflege ebenfalls eine sechste Kategorie mit den Themen „Wohnen und Häuslichkeit“ hinzu.
Mit dieser Entscheidung war eine verantwortbare wissenschaftsbasierte Strukturierung der Informationssammlung definiert, von der angenommen werden konnte, dass die für die Pflege relevanten Themenkomplexe im Kontext der Versorgung pflegebedürftiger Menschen berücksichtigt sind. Um den Pflegefachkräften Hinweise und eine Anleitung für die Umsetzung der SIS®zu geben, wurden für jedes Themenfeld „Leitfragen“ formuliert. Sie sollten die Entwicklung eines einheitlichen Verständnisses bei der praktischen Anwendung und Umsetzung der Themenfelder sicherstellen (vgl. Teil II, Kap. 4).
Zielsetzung und Aufbau der Risikoeinschätzung als Bestandteil der Strukturierten Informationssammlung (SIS®)
Im Mittelpunkt der Debatte um eine „überbordende“ Pflegedokumentation war aus Sicht der Pflegefachkräfte kein Thema so „angstbesetzt“ und offensichtlich fremdbestimmt wie der sach- und fachgerechte Umgang mit der Einschätzung von pflegesensitiven Risiken und Phänomenen und deren Dokumentation. Die Diskussion hierzu war geprägt durch viele Spannungsfelder, aus denen heraus jeweils Anforderungen an die Pflegedokumentation gestellt wurden. Es betraf haftungsrechtliche Aspekte, Instrumente und Verfahren der externen Qualitätssicherung, fehlendes fachliches Wissen und Missverständnisse in der Übermittlung der Funktion und praktischen Anwendung der Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) und anderer Instrumentarien sowie vielerorts schematischen und wenig zielführenden Vorgaben des internen Qualitätsmanagements.
Insofern war es unabdingbar, diese Thematik im Rahmen einer bürokratiearmen Pflegedokumentation aufzugreifen und ein rationales, fachwissenschaftlich begründetes und praxisnahes Vorgehen vorzuschlagen. Dies sollte u.a. aktuelle Erkenntnisse aus der Überarbeitung der Expertenstandards des DNQP und jüngste Regelungen im Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) aufgreifen (Datentriangulation). Damit war zusätzlich die Erwartung verbunden, dass die Verantwortlichen auf allen Ebenen ihre bisherige Praxis der internen und der externen Qualitätssicherung in diesem Punkt überprüfen. Unter maßgeblicher konzeptioneller Federführung von Prof. M. Roes wurde in der Expertengruppe für die Risikoeinschätzung in der ambulanten und der stationären Pflege je eine Matrix (Feld C2) entwickelt. Mittels eines einfachen – hier gezielt eingesetzten – Ankreuzverfahrens sollte eine erste fachliche Einschätzung von der Pflegefachkraft zu möglichen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (in den Kategorien Dekubitus, Sturz, Schmerz, Inkontinenz, Ernährung sowie einem bei Bedarf ‚individuell‘ zu benennenden Risikos) im Kontext der fünf Themenfelder der Strukturierten Informationssammlung vorgenommen werden. Diesem Vorschlag lagen folgende Überlegungen zugrunde:
Bedingt durch die singuläre Bearbeitung der unterschiedlichen Probleme eines pflegebedürftigen Menschen (u. a. durch die ATL/AEDL Grundstruktur) geht der Zusammenhang und die Wechselwirkungen dieser pflegerelevanten Aspekte verloren. Durch die Matrixstruktur werden pflegerelevante Phänomene (wie Dekubitus, Sturz etc.) mit pflegerelevanten Kontextkategorien (wie Kognition/Kommunikation, Mobilität/Bewegung etc.) zusammenhängend betrachtet.
Eine Risikoeinschätzung erfolgt in diesem Fall vor dem Hintergrund miteinander korrespondierender Risiken (wie z. B. Sturz mit Mobilität/Bewegung oder Schmerz mit krankheitsbedingten Anforderungen). Im Anschluss daran kann – auf Grundlage der SIS®(inkl. Matrix zur Risikoeinschätzung) – der Handlungsbedarf im Maßnahmenplan dokumentiert werden. Der fachlich begründeten Entscheidung für individuelle Versorgungssituationen wird somit Raum gegeben (Personzentrierung). Darüber hinaus sollte die Matrix für einen Plausibilitätscheck aller bis dahin dokumentierten Informationen in den Themenfeldern der SIS® dienen.
Im Praxistest galt es nun zu erproben, inwieweit für die Pflegefachkräfte und das Pflege- und Qualitätsmanagement dieses Vorgehen verständlich und praktisch anwendbar ist und ob es dazu beiträgt, die Bedeutung der Fachlichkeit von Pflegefachkräften in diesem Entscheidungsprozess (wieder) stärker zum Tragen kommen zu lassen. Die bisherige Praxis eines eher schematischen Umgangs mit Assessments und Skalen sollte kritisch überprüft werden, zugunsten individuell begründeter Entscheidungen und zeitlich befristeter Beobachtungen mittels kurzfristig gesetzter Evaluationsdaten.
BEISPIEL
Aus dem Praxistest
Ein Seniorenzentrum in der Nähe von Karlsruhe war eine der Einrichtungen, die sich an dem Praxistest des Bundesministeriums für Gesundheit von Mitte 10/2013 bis Mitte 01/2014 beteiligt haben. Die Pflegedokumentation hatte auch in dieser Pflegeeinrichtung aufgrund der bekannten vielfältigen Auslöser eine Eigendynamik entwickelt, zunehmend losgelöst von ihrer eigentlichen Zielsetzung. Dabei waren die Bewohner immer mehr aus dem primären Blickfeld verschwunden: Ergebnis: Frustrierte und verunsicherte Mitarbeiter und die Prüfereignisse wurden in den Fokus gerückt, nicht der Bewohner.
Damit der Praxistest gelingen konnte, wurde in dieser Pflegeeinrichtung eine Arbeitsgruppe mit einer Projektverantwortlichen Person eingesetzt, um das Projekt zu steuern. Alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe hatten sich schon vorher sehr mit der Thematik der Pflegedokumentation auseinandergesetzt und waren an einer Reduzierung auf das erforderliche Mindestmaß sehr interessiert. Die Aufgabe der eingesetzten Arbeitsgruppe bestand nun darin, die Informationen und Hintergründe zu dem Projekt den anderen Mitarbeitern des Hauses zu übermitteln und sie in die neue Dokumentationspraxis einzuführen. Es galt, in drei Monaten bei mindestens 10 pflegebedürftigen Personen eine Pflegedokumentation nach den Prinzipien des Strukturmodells umzusetzen und auf Praxistauglichkeit und Zeitersparnis zu überprüfen.
Erfahrungen im Laufe des Praxistests
Das Gespräch mit Bewohnern und Angehörigen und Reaktion:
■ Bei Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner in die Pflegeeinrichtung wurden diese im Rahmen des Einzugsgespräches über den Praxistest informiert und um ihr Einverständnis der Einbindung gebeten. Danach wurde mit dem Erstgespräch begonnen. Je weiter das Gespräch fortgeschritten war, desto mehr konnte festgestellt werden, dass das Verhältnis zwischen Pflegekraft und Bewohner immer vertrauter wurde. Die Bewohner und deren Angehörigen äußerten alle, dass deutlich spürbar sei, dass wieder der Mensch selbst im Mittelpunkt stehe und nicht die Dokumentation. Die Bewohner wurden im Zeitraum ihres Aufenthaltes immer wieder zu ihrer Zufriedenheit befragt und äußerten sich dahingehend, dass sie sich sehr freuen würden, wenn in Zukunft durch weniger Schreibarbeit wieder mehr Zeit für alle verfügbar sei.
■ Reaktion der beteiligten Pflege(fach)kräfte auf das Projekt:
Nach dem ersten Reflexionstreffen im Rahmen des Praxistests fand in der Einrichtung mit dem Geschäftsführer ein Treffen aller beteiligter Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter statt, in dem sie berichten konnten, wie sie den Verlauf des Praxistests bisher beurteilten und wie sie mit dem neuen Verfahren zurechtkämen.
■ Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beurteilten diesen Praxistest sehr positiv, da deutlich mehr Zeit für die Bewohner und Bewohnerinnen vorhanden sei, als dies bei der gegenwärtig praktizierten Dokumentationsform der Fall sei. Dennoch waren sie sehr skeptisch, ob der Praxistest eine Chance habe, da schon viele Projekte in der Vergangenheit gestartet wurden, aber keines letztlich langfristig umgesetzt wurde. Die Mitarbeiter äußerten im Verlauf des Praxistests die Hoffnung, dass dies in Zukunft „ihre“ Dokumentation würde und diese Dokumentation für alle Mitarbeiter der Pflege bundesweit zur Verfügung stehen solle.
■ Treffen mit der Heimaufsicht und dem MDK; Reaktionen:
Die Einrichtung hatte die für die Pflegeeinrichtung zuständige Heimaufsichtsbehörde eingeladen und die Projektverantwortliche stellte die neue Pflegedokumentation vor. Der Vertreter der Behörde äußerte, dass er es sehr mutig fände, dass die Pflegeberichte stark reduziert werden, aber es juristisch einwandfrei sei. Auch er betonte, dass es im SGB XI keine Vorgaben gibt, die ausdrücklich vorschreiben, wie eine Pflegedokumentation auszusehen hat.
■ Im Monat darauf wurde eine Vertreterin des MDK eingeladen. Sie betonte, dass gestiegene rechtliche Auseinandersetzungen in der Langzeitpflege zusätzliche Anreize in die falsche Richtung gesetzt hätten, so umfassend zu dokumentieren, damit für alle denkbaren Situationen „vorgesorgt“ sei.
■ Beide, Heimaufsicht und MDK äußerten, dass Sie es sich für die Bewohner und die Pflegenden wünschen würden, dass wieder mehr Zeit da wäre und hofften sehr stark, dass die Ergebnisse aus dem Praxistest zu einer erfolgreichen Entbürokratisierung führen würden. Die Pflegeeinrichtung erlebte innerhalb der Projektphase große Unterstützung seitens dieser Prüfbehörden, was eine ermutigende Erfahrung und für die weitere Akzeptanz des Strukturmodells von Bedeutung war.
Zwischenfazit
Abschließend zu den Hintergründen dieser knappen Entstehungsgeschichte des Strukturmodells sei das Fazit des Deutschen Pflegerats (DPR) in seiner Stellungnahme vom Januar 2015 wiedergegeben:
„Die Ombudsfrau für Entbürokratisierung in der Pflege entwickelte zusammen mit Experten ein Strukturmodell sowie eine Strukturierte Informationssammlung, das den Pflegedokumentationsaufwand deutlich reduziert, wissenschaftlich fundiert ist, den haftungsrechtlichen und leistungsrechtlichen Anforderungen nach SGB V und SGB XI genügt und sowie gleichzeitig der Pflegefachlichkeit Raum gibt.
Damit ist ein Meilenstein gelungen: Pflegefachpersonen arbeiten nicht länger in einer Engführung durch Checklisten, die abzuhaken sind, und das Führen von‚Nachweisheften‘ für regelhaft durchgeführte Prüfungen oder potenzielle Gerichtsverfahren. Durch das Strukturmodell verfügen sie vielmehr über ein ‚Arbeitsinstrument‘, das zugleich ihre Professionalität fordert: Denn nun müssen sie begründen und vertreten – auch gegenüber der externen Qualitätssicherung – welche Maßnahmen sie durchführen oder nicht durchführen und mit welchem Ziel sie diese Maßnahme beim konkreten Pflegebedürftigen abgeleitet haben.
Das Strukturmodell und die Strukturierte Informationssammlung stellen eine Verständigung der maßgeblichen Akteure und Institutionen über die unverzichtbaren Grundanforderungen an die Pflegedokumentation dar. Diese Grundanforderungen basieren auf nachvollziehbaren Kriterien, folgen einer schlüssigen Logik und sind wissenschaftlich begründet.
Der Deutsche Pflegerat schlägt vor, diesem neuen Arbeitsinstrument eine Chance zu geben und es jetzt – auch im Rahmen des bundesweiten Implementierungsprojektes – zu erproben. Es wird die Pflege verändern und sie ein Stück zu ihren Wurzeln zurückführen. Durch die Anwendung des Strukturmodells können Erfahrungen gesammelt werden, die bei Bedarf Anpassungen ermöglichen.“
Zu erwartende Wirkungen der neuen Pflegedokumentationspraxis
Durch die Einführung des Strukturmodells mit den vier Elementen wird eine gemeinsame Sichtweise (professionsübergreifend) aller an der Pflege und Betreuung Beteiligten gefördert.
Die Anwendung des Strukturmodells schafft u. a. Grundlagen für die (Weiter-) Entwicklung einer Fachsprache und unterstützt die Einführung von bundesweiten Indikatoren für die Qualitätsdarlegung und -berichterstattung.
Eine „Standardisierung“ von Pflegedokumentationssystemen auf der Grundlage der Prinzipien des Strukturmodells erleichtert insbesondere beim Wechsel des Arbeitsortes die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich bietet sie schnelle Orientierung für Aushilfskräfte und bei dem Einsatz von Pflegenden aus Personalagenturen.
Das Strukturmodell mit seinen vier Elementen liefert ohne großen Aufwand im Rahmen des Pflegeprozesses, insbesondere durch die Elemente 1(SIS®) und 3 (Berichteblatt) Informationen und Orientierung zur Entscheidung für einen Antrag auf Überprüfung eines vorliegenden Pflegegrades (vgl. Teil IV, Kap. 8).
Die Strukturierte Informationssammlung kann insbesondere in der ambulanten Versorgung den pflegebedürftigen Personen übergeben werden (Transparenz) und ist hilfreich für den Verbraucher bei einem Wechsel des Pflegedienstes. Sie kann für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Überleitung aus dem Krankenhaus und anderer Versorgungsbereiche eventuell Wirkung entfalten.
Bundesweite Verständigung auf ein Konzept zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, Beteiligung aller Akteure und politische Unterstützung
Voraussetzung hierfür war die im Laufe des Jahres 2013 erreichte Verständigung auf ein einheitliches (fachlich und juristisch belastbares) Konzept einer bürokratiearmen oder „schlanken“ Pflegedokumentation (Strukturmodell). In den geführten Gesprächen kristallisierte sich schnell heraus, dass für eine Akzeptanz in der Praxis und für eine breite Implementierung in der Fläche es gelingen musste, diesen fachlichen Konsens in Form einer „Konzertierten Aktion“ mit allen zentralen Akteuren durch ein bundeseinheitliches Vorgehen abzusichern und dass alle Beteiligten einen Beitrag im Rahmen ihrer Verantwortung dazu leisten mussten.
In diesem Zusammenhang wurde von dem Geschäftsführer des MDS der inzwischen „legendäre“ Begriff „Re-Set“ Pflegedokumentation geprägt. Hierdurch sollte zum Ausdruck kommen, dass die beschriebene problematische Entwicklung einer überbordenden Pflegedokumentation nicht „irgendwie“ verbessert werden konnte, sondern Prinzipien einer effektiven und effizienten Pflegedokumentation von Grund auf neu gedacht und zukunftssicher gestaltet werden mussten. Ganz entscheidend war dabei, dass sowohl der MDK als auch der MDS diese Entwicklung mit getragen und das Strukturmodell von Anfang an mit entwickelt und die bundesweite Umsetzung unterstützt haben (vgl. Teil IV, Kap. 7).
Nachdem sich das Strukturmodell in einem Praxistest (2013/2014) bewährt hatte, wurde vom BMG die Erarbeitung einer Handlungsanleitung in Auftrag gegeben, die in Zusammenarbeit mit Praxistesteilnehmern und weiteren fachpraktischen Experten und Expertinnen von Bildungsträgern und öffentlichen sowie privaten Institutionen erstellt wurde. Hierauf haben die zentralen Informations- und Schulungsunterlagen des Projektbüros Ein-STEP später aufgebaut.
Um das Entbürokratisierungsprojekt im Vorfeld politischer Entscheidungen zum Vorgehen weiter voranzutreiben, wurde in einer beispiellosen Initiative von den Einrichtungs- und Kostenträgern (BAGFW, bpa und GKV-SV) auf Bundesebene im Herbst 2014 die Erarbeitung einer bundesweiten Implementierungsstrategie zur Umsetzung des Strukturmodells, in Absprache mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, beauftragt. Dieses Konzept beinhaltete: eine zentral gesteuerte Kommunikations- und Organisationsstruktur auf Bundes- und Landesebene, Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten für ein bundeseinheitliches Vorgehen und die Einrichtung eines zentralen Projektbüros zur Informationssteuerung.
Dieses Konzept wurde in dem bereits etablierten Lenkungsgremium Ende 2014 beschlossen. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung sagte hierfür seine volle politische Unterstützung sowie eine erhebliche finanzielle Förderung zu. Unter dem Motto: „Mehr Zeit für die Pflege“ startete in Zusammenarbeit mit den Einrichtungs- und Kostenträgern, den Prüfinstanzen und den Ländern die bisher größte bundespolitische Aktion zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation.
Die besondere Rolle der Bundesverbände der Trägerorganisationen
Voraussetzung für die gesamte Entwicklung bis zu diesem Punkt und die Umsetzung der Implementierungsstrategie war das hohe finanzielle und organisatorische Engagement der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) (vgl. Geleitwort). Beide Organisationen hatten schon bei der Durchführung des Praxistests eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Verlauf gespielt und übernahmen nun auch im Rahmen der Steuerung des Gesamtvorhabens anteilig erhebliche finanzielle und organisatorische Verantwortung. Darüber hinaus beteiligten sich alle anderen privaten Bundesverbände sowie regionale Trägerorganisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenso mit Nachdruck an der Umsetzung des Strukturmodells. Das Projektbüro Ein-STEP, bei der IGES GmbH in Berlin, hatte im Auftrag des Pflegebevollmächtigten die Verantwortung für die fachliche Umsetzung der Implementierungsstrategie sowie die Etablierung entsprechender Strukturen.
Unterstützung der Länder im Rahmen des Entbürokratisierungsprojektes
Die Länder hatten es ausdrücklich begrüßt, dass die vom Bundesministerium für Gesundheit eingesetzte Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege am Ende der letzten Legislaturperiode vom BMG den Auftrag erhielt, die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation voranzutreiben. Im Juli 2013 hatte die Ombudsfrau Empfehlungen zur Gestaltung eines Strukturmodells in einem eigens hierfür einberufenen Lenkungsgremium vorgelegt. In das damit verbundene Abstimmungsverfahren wurden alle relevanten Umsetzungspartner eingebunden.
Ein wichtiges Teilziel zur Akzeptanzgewinnung für das vorgeschlagene Verfahren vor Ort war die Verständigung der Vertragspartner nach § 113 SGB XI im August 2013, die Empfehlungen in einem 3-monatigen Praxistest zu erproben. Der Verlauf dieses vom BMG initiierten Projekts der „Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation“ hatte gezeigt, dass für eine merkbare Vereinfachung der Pflegedokumentation vor Ort nicht allein ein fachlich und rechtlich fundiertes Verfahren entwickelt werden musste. Erst durch die gemeinsame Verantwortungsübernahme für die Gestaltung der Implementierungsstrategie aller Beteiligten im Lenkungsgremium und durch die Verschränkung des Lenkungsgremiums auf Bundesebene mit den Kooperationsgremien auf Landesebene konnte ein Durchbruch bei der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation bundesweit erreicht und ein beachtlicher Erfolg dieser gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen der Implementierungsstrategie erzielt werden.
Die Länder wurden im September 2013 offiziell in diesen Prozess eingebunden und haben für die 90. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) im November 2013 einen Antrag zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation eingebracht. Die Bundesregierung wurde darin aufgefordert, den eingeschlagenen Weg zur Entbürokratisierung in der Pflege durch die Beibehaltung der auslaufenden Ombudsstelle über den September 2013 hinaus fortzusetzen mit dem Ziel, konkrete und praxisnahe Leitlinien für die unterschiedlichen Versorgungsbereiche (vollstationäre und ambulante Einrichtungen, Tages- und Kurzzeitpflege) für eine fachgerechte und effiziente Pflegedokumentation vorzulegen und deren Implementierung zu unterstützen.
Zusätzlich sollte geprüft werden, ob durch eine Weiterentwicklung der Qualitätsprüfungs-Richtlinien und der Pflege-Transparenzvereinbarungen die Zusammenarbeit und die arbeitsteilige Vorgehensweise zwischen MDK bzw. PKV-Prüfdienst und den für die Aufsicht zuständigen Behörden der Länder verbessert und die Dokumentation optimiert werden können.
Die Bundesregierung wurde außerdem aufgefordert, notwendige gesetzgeberische Schritte zu prüfen, damit für alle Beteiligten mehr Klarheit über die rechtlichen und fachlichen Anforderungen an die Pflegedokumentation hergestellt wird. In diesen Prozess wollten die Länder eingebunden werden.
Eine wichtige Funktion für die Akzeptanzgewinnung bei Diensten und Einrichtungen hatte im gesamten Prozess das Lenkungsgremium mit seinen Beschlüssen und Protokollen auf Bundesebene; zunächst unter Leitung des BMG und ab 2014 durch den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Mit den korrespondierenden Kooperationsgremien in den Ländern und den Aktivitäten der Trägerverbände ist eine breite Information erfolgt und Transparenz hergestellt worden.
Unterstützung der bundesweiten Implementierungsstrategie
In einem Umlaufbeschluss für die 92. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (2015) begrüßten die Länder die Empfehlungen des Lenkungsgremiums vom 13.03.2014, die weitere Umsetzung des Projektes vorzusehen.
■ Sie erkennen in dem Beschluss der Vertragsparteien nach § 113 SGB XI vom 04.07.2014, mit denen für den leistungsrechtlichen Bereich eine verlässliche Grundlage für die Implementierung geschaffen wurde.
■ Sie bekräftigten ihre Absicht, die erforderliche Übereinstimmung des im Praxistest erprobten Verfahrens zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation mit den ordnungsrechtlichen Regelungen der bestehenden Landesgesetze herzustellen.
■ Sie bitten die Bundesregierung, die Schulung und Beratung der für die Durchführung der entsprechenden ordnungsrechtlichen Regelungen in den Landesgesetzen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Implementierungsstrategie frühzeitig und ausreichend zu berücksichtigen.
Die Länder begleiten bis heute in Zusammenarbeit mit den Landespflegeausschüssen die Implementierungsstrategie.
Im Beschluss des Lenkungsgremiums vom 09.07.2014 wird u. a. empfohlen, die Umsetzung der Implementierungsstrategie in den Ländern auf die Grundlage eines Beschlusses der auf Landesebene relevanten Gremien – Landespflegeausschuss – zu stellen und ein regionales Gremium einzurichten, das die Umsetzung begleitet und sich eng mit der Bundesebene abstimmt, um eine möglichst einheitliche Vorgehensweise zu erreichen. Dabei sollen vor allem die Einrichtungsund Kostenträger, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, die für das Wohnpflegerecht zuständigen Aufsichten, das für die Pflege zuständige Ministerium und die den Praxistest tragenden Verbände sowie Expertise aus dem Bereich der beruflichen Bildung beteiligt werden (siehe Abb. 2).
Nach dem Umsetzungskonzept der Implementierungsstrategie berät und empfiehlt das Kooperationsgremium im Rahmen der Beschlüsse des Lenkungsgremiums:
■ Zum Stand der Umsetzung im Bundesland und regionalem unterstützenden Handlungsbedarf, z. B. der Teilnahme von Pflegeeinrichtungen
Abb. 2: Relevante Akteure in den Kooperationsgremien der Länder im Rahmen der Implementierungsstrategie
■ Zu den fachlichen und organisatorischen Erkenntnissen aus der Umsetzung mit Bildungsträgern und mögliche Auswirkungen auf einschlägige landesspezifische Vorgaben
■ Zur Förderung des Dialogs zwischen den Prüfinstanzen, z. B. im Hinblick auf Vorgaben landesseitiger Prüfrichtlinien und zum gegenseitigen Verständnis mit den Einrichtungsträgern im Kontext der Implementierung des Strukturmodells
■ Über Erkenntnisse zu rechtlichen Aspekten der Umsetzung und ggf. Identifizierung von landesseitigem Handlungsbedarf auf gesetzlicher und/oder untergesetzlicher Ebene.
In der 9. Sitzung des Lenkungsgremiums 29.06.2016 wurde vom Projektbüro berichtet, dass in allen Bundesländern auf der Grundlage von Beschlüssen der jeweiligen Landespflegeausschüsse ein Kooperationsgremium eingerichtet wurde. In der Arbeit der Kooperationsgremien kristallisierte sich sehr schnell die Berücksichtigung des Strukturmodells in den Ausbildungen zur Altenpflegerin, zum Altenpfleger als ein vordringliches Thema heraus.
Mitte Juni 2016 haben sich die für das Aufsichtsrecht zuständigen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ihrer jährlichen Besprechung auch mit der Umsetzung des Strukturmodells befasst. Es wurde aus keinem Land von „echten“ Problemen in der Umsetzung gesprochen, auch nicht von schlechteren Überprüfungsergebnissen.
Unterstützung durch Regelungen des Gesetzgebers und Beschlüsse der Selbstverwaltung für eine effiziente Pflegedokumentation
Der Gesetzgeber und die Vertragspartner gemäß § 113 SGB XI haben in beiden Legislaturperioden immer wieder zur Einordnung der Pflegedokumentation Klarstellungen vorgenommen und den Prozess der Entbürokratisierung unterstützt. Zum Thema gleichwertige Faktoren im Rahmen von Qualitätsprüfungen wurde Folgendes in das SGB XI (PNG 2013) aufgenommen: „Bei der Beurteilung der Pflegequalität sind die Pflegedokumentation, die Inaugenscheinnahme der Pflegebedürftigen und Befragungen der Beschäftigten […] sowie der Pflegebedürftigen […] angemessen zu berücksichtigen“ (§ 114a Abs.3 SGB XI).
Mitte 2014 wurde durch einen als Presseerklärung kommunizierten Beschluss der Vertragspartner nach § 113 SGB XI festgestellt, dass eine Pflegedokumentation entlang der Prinzipien des Strukturmodells mit den geltenden „Maßstäben und Grundsätzen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität“ sowie den Qualitätsprüfrichtlinien (QPR) des Spitzenverbands Bund der Pflegekassen vereinbar ist. Dies bedeutete konkret, dass es sich bei dem Strukturmodell um „[…] eine praxistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und die Pflegequalität fördernde Pflegedokumentation […]“ handelt, die „[…] über ein für die Pflegeeinrichtung vertretbares und wirtschaftliches Maß […]“ nicht hinausgeht (§ 113 Abs. 1, Satz 4 Nr. 1 SGB XI).
Eine Überprüfung landesrechtlicher Regelungen zu den Anforderungen an eine Pflegedokumentation ergab, dass auch diese einer Einführung des Strukturmodells in der Langzeitpflege nicht entgegenstehen.
Im Jahr 2016 (PSG II) erfolgte auf Initiative des Pflegebevollmächtigten eine weitere Klarstellung des Gesetzgebers zur Nutzenstiftung der Zeitersparnis: „[…] zeitliche Einsparungen…, die Ergebnis der Weiterentwicklung der Pflegedokumentation… sind […], führen diese nicht zu einer Absenkung der Pflegevergütung, sondern wirken der Arbeitsverdichtung entgegen.“ (§ 113 Abs. 1 Satz 6 SGB XI).
In den Begründungen zum zweiten Pflegestärkungsgesetz, zu den Änderungen im § 113, Absatz 1, Satz 3 findet sich folgender Absatz „Mit dem Strukturmodell wird der Praxis nun erstmals eine verlässliche, das heißt mit den Kosten- und Einrichtungsträgern sowie den Prüfinstanzen konsentierte und hinsichtlich wichtiger Rechtsfragen geprüfte Richtschnur zur angemessenen und sachgerechten Gestaltung der Pflegedokumentation an die Hand gegeben. Auf dieser Grundlage kann überflüssiger Dokumentationsaufwand erheblich reduziert werden, ohne fachliche Standards zu vernachlässigen, die Qualität der pflegerischen Versorgung zu gefährden oder haftungsrechtliche Risiken aufzuwerfen.
Die Entbürokratisierung der Pflegdokumentation wurde zusätzlich engagiert durch eine juristische Expertengruppe (ehrenamtlich) von Anfang an unterstützt. Sie gab zu grundsätzlichen Fragen aus haftungs-, sozial- und berufsrechtlicher Sicht im Kontext der Pflegedokumentation entsprechende Stellungnahmen ab (sog. „Kasseler Erklärungen“, vgl. Teil I, Kap. 3). Dieser unabhängige Sachverstand war mehrmals in schwierigen Phasen des Projektes ausgesprochen klärend und hilfreich. Es war zugleich Ausdruck der großen Aufmerksamkeit, die die Entbürokratisierungsstrategie im Laufe dieser Entwicklung auch in juristischen Kreisen erfahren hatte. Sie war darauf ausgerichtet, durch einschlägige Publikationen einen Beitrag zum Gelingen des Vorhabens zu leisten und die Gerichte zu wesentlichen Aspekten der Pflegedokumentation zu erreichen, um auf aktuelle Entwicklungen in diesem Zusammenhang aufmerksam zu machen.
Fortsetzung der Implementierungsstrategie ab Mitte Juni 2016
Die in der 12. Sitzung des Lenkungsgremiums angekündigte Fortführung der Implementierungsstrategie bis Ende Oktober 2017 wurde von allen Beteiligten als gute Chance bewertet, um noch mehr Einrichtungen für die Umstellung ihrer Dokumentation zu überzeugen und den angestoßenen Prozess zu verstetigen. Die Fortführung wurde in gemeinsamer Federführung des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung und der freigemeinnützigen sowie der privaten Trägerverbände auf Bundesebene durchgeführt und finanziert. Durch die Übernahmen der Kosten für den Praxistest durch alle freigemeinnützigen und privaten Bundesverbände war die Erprobungsphase für die Tages- und Kurzzeitpflege und eine anschließende Implementierungsphase abgesichert.
Da in den gemeinsamen Absprachen eine Finanzierung der Regionalkoordinatorinnen des Projektbüros zur Schulung und Begleitung in der Erprobungsphase in den Bereichen der Kurzzeitpflege und der Tagespflege nicht berücksichtigt werden konnte, wurde die Bitte um eine mögliche Finanzierung bis Ende 2016 an die Länder herangetragen. In den Kooperationsgremien der Länder gab es einen breiten Konsens darüber, dass der Praxistest ohne Regionalkoordinatoren u. a. zu mehr Unsicherheit bei den Pflegekräften, zu einer höheren Fehleranfälligkeit und zu einem Mehraufwand im Abstimmungsprozess mit dem Projektbüro führen würde. Da es den Ländern ein wichtiges Anliegen ist, die Pflegekräfte in den Einrichtungen und Diensten für die Beteiligung an dem „Entbürokratisierungsprojekt“ zu motivieren und vorhandene Hemmnisse zu beseitigen, hat sich die Mehrheit der Länder für eine aktive Beteiligung an der Erprobungsphase ausgesprochen und in diesem Rahmen – trotz erheblicher Umsetzungsschwierigkeiten – die Finanzierung der Regionalkoordinatoren sichergestellt. Aus Sicht der Länder sollte alles getan werden, um möglichst viel Vertrauen und Sicherheit zu schaffen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege sich mit Überzeugung und gut begleitet für den neuen Weg der Dokumentation auch in der Tages- und Kurzzeitpflege entscheiden können.
Fazit
Aus Sicht aller Beteiligten ist wesentlich für den Erfolg des Projekts die Tatsache, dass das Thema Pflegedokumentation ein bundespolitisch längerfristig hoch aufgehängtes und aktuell gehaltenes Thema mit bundes- und landespolitischen Strukturen geworden ist. Mit gemeinsamem Engagement dazu beizutragen, dass die Pflegedokumentation auf das für eine fachgerechte und individuelle Pflege notwendige Maß beschränkt wird, haben die Bundesregierung, Länder und Kostenträger auch im Rahmen der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege in der letzten Legislaturperiode zugesagt. Die Verbände haben zugesagt, weiterhin den Bürokratieaufwand und die daraus entstehenden Belastungssituationen von Pflegekräften im Alltag genauer zu analysieren und Wege aufzuzeigen, wie die Pflegeeinrichtungen diese reduzieren können (vgl. Vereinbarung VII.4: Pflegekräfte sollen stärker von Bürokratie entlastet werden).
Aus Sicht der Länder sollten alle Anstrengungen unternommen werden, damit dieses Projekt einen größtmöglichen Erfolg in der Praxis erfährt und mehr Zeit für Pflege geschaffen wird.
Ausblick bundesweite Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
In der auslaufenden Legislaturperiode (2017) wie auch in der letzten Legislatur sind weitreichende Anstrengungen bei allen Beteiligten zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation unternommen worden. Mittlerweile ist das Strukturmodell aus dem pflegerischen Alltag vieler Pflegeeinrichtungen nicht mehr wegzudenken. Diese insgesamt positive Bilanz verkennt nicht, dass es auch Kritik am Strukturmodell selbst aber auch der Implementierungsstrategie gab und gibt. Hiermit gilt es, sich weiterhin konstruktiv und im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer laufenden Evaluation auseinanderzusetzen.
Die vorbehaltlose Unterstützung der Politik sowie das vertrauensvolle Zusammenspiel zwischen den Einrichtungs- und Kostenträgern, dem MDS, den Prüfinstanzen, den Ländern sowie die Verständigung auf eine zentrale Steuerung waren entscheidende Faktoren dieses ersten bundesweiten Entbürokratisierungsprojekts in der Pflege. Hierdurch konnten gleich mehrere Themen der Entbürokratisierung systematisch bearbeitet und grundlegende Fragen geklärt werden. Es bedarf der erhöhten Aufmerksamkeit aller Beteiligten, diese Ergebnisse auf Bundes- und Landesebene zu festigen. Hierbei wird es ganz wesentlich auch auf die weitere Begleitung der Einrichtungen und Dienste, auf weitere Schulungen zu einzelnen fachlichen Themen bei der Umsetzung des Strukturmodells und die Entwicklung der Fachlichkeit sowie die Zusammenarbeit aller an der Pflege und Betreuung Beteiligten ankommen. Insbesondere sollten bei der Umsetzung der vielfältigen neuen gesetzlichen Regelungen (Ergebnisindikatoren, Personalbemessungssystem, Assessment Lebensqualität etc.) Synergien auf der Grundlage einer „schlanken“ Pflegedokumentation zur Voraussetzung gemacht und eingefordert werden. Bei der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze tragen alle Beteiligten die Verantwortung dafür, dass der mit dem Strukturmodell eingeschlagene Weg einer praxisnahen, pflegefachlich fundierten und bürokratiearmen Dokumentation nicht verlassen wird. Jetzt muss es gemeinsames Ziel sein, dass Dokumentationsverfahren mit dem Strukturmodell zu verstetigen und im Implementierungsprozess auftretende fachliche, juristische und organisatorische Fragen unter den Beteiligten zu klären, damit eine „überbordende“ Dokumentation endgültig Vergangenheit wird.
Literatur
Arbeitsgruppe Bürokratie in der Pflege Rheinland-Pfalz: Musterdokumentation für die stationäre Pflege (Hrsg.): Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz., 2. Auflage 2008.
Arbeitsgruppe Bürokratie in der Pflege Rheinland-Pfalz: Musterdokumentation für die ambulante Pflege. (Hrsg.): Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz., 2011
Beikirch, Elisabeth; Breloer-Simon, Gabriele; Rink, Friedhelm; Roes, Martina: Praktische Anwendung des Strukturmodells – Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege, Abschlussbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, 2014.
Beikirch, Elisabeth: Entwicklung einer Implementierungsstrategie (IMPS) zur bundesweiten Einführung des Strukturmodells für die Pflegedokumentation der stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen (Hrsg.): GKV-Spitzenverband, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfleg (BAGFW) e.V., Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)., Eigenverlag, 2014.
Brodersen, Hannes; MDK Schleswig-Holstein; Weiß, Thomas: Das schleswig-holsteinische Modell der „Vereinfachten Pflegeplanung und -dokumentation“ - Ergebnisse des Modellprojekts. (Hrsg.): Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein, 2005.
Bruckner, Uwe; Ziegler, Gerdi; Theis, Sylvia et al.: Grundsatzstellungnahme Pflegeprozess und Dokumentation. Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Pflege, (Hrsg): Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e. V. (MDS), Eigenverlag, 2005.
Büscher, Andreas; Holle, Bernhard: Pflegeberatung nach § 37 Abs. 3 SGB XI: Unterstützung häuslicher Pflege- arragements. In: Monitor Pflege 1 (3): 15-19, 2015.
Deutscher Pflegerat (DPR): Der DPR unterstützt das Strukturmodell zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege. Positionspapier, 2015. (im Internet unter: http://www.deutscher-pflegerat.de/Fachinformationen/2015-01-19-DPR_Entbuerokratisierung.pdf, zuletzt aufgerufen am 05.04.2017)
Göpfert-Divivier, W.; Mybes, U.; Igl, G.: Identifizierung von Entbürokratisierungspotenzialen in Einrichtungen der stationären Altenpflege in Deutschland; Abschlussbericht des Kompetenzteams im Auftrag des BMFSFJ, 2006.
Höhmann, Ulrike; Weinrich, Heidi; Gätschenberger, Gudrun: Die Bedeutung des Pflegeplanes für die Qualitätssicherung in der Pflege. Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Forschungsbericht 261, 1996.
Statistisches Bundesamt (DESTATIS): Erfüllungsaufwand im Bereich Pflege, Antragsverfahren auf gesetzliche Leistungen für Menschen, die pflegebedürftig oder chronisch krank sind. Projektreihe Bestimmung des bürokratischen Aufwands und Ansätze zur Entlastung, Im Auftrag der Bundesregierung 2013.
Wingenfeld, Klaus, Heitmann, Dieter, Korte-Pötters, Ursula; Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW); Rehling, Brigitte Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt a. M. (ISS); Menke, Marion; Vogelwiesche, Uta; Kuhlmann, Andrea; Kowalski, Ingo; Schnabel, Eckart Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund (FFG): Vom Referenzmodell zum Referenzkonzept – Teilbericht 6, Abschlussberichte der Beteiligten Institute. Im Auftrag des: Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2004-2006.
Wipp, Michael; Buschkämper, Renate; Kamm, Johannes: Abschlussbericht – Projekt „Entbürokratisierung der Pflegedokumentation“ Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, 2002-2003. (im Internet: http://www.yumpu.com/de/document/view/29511512/projekt-quotentba-1-4-rokratisierung-der-pflegedokumentationquot-bayern; zuletzt aufgerufen 06.04.2017)