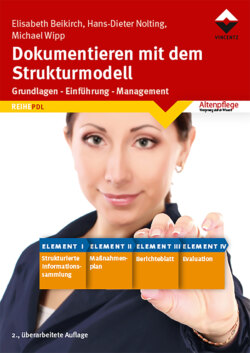Читать книгу Dokumentieren mit dem Strukturmodell - Elisabeth Beikirch - Страница 11
Оглавление2 Die pflegewissenschaftliche Fundierung des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit und des Strukturmodells
ANDREAS BÜSCHER / Eine der vielfältigen Diskussionen rund um die Veröffentlichung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation bezieht sich auf die pflegewissenschaftliche Fundierung des Modells und der Themenfelder bei der Strukturierten Informationssammlung (SIS®). Die offensichtliche Ähnlichkeit dieser Themenfelder mit dem neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit und den Modulen des Neuen Begutachtungsassessments zur Bestimmung der Pflegebedürftigkeit, auf dessen Grundlage seit dem 01.01.2017 die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit durch die Medizinischen Dienste der Krankenversicherungen (MDK) im Rahmen der Pflegeversicherung erfolgt, führten zu der Vermutung, dass vorrangig pragmatische und sozialpolitisch motivierte Überlegungen zu dieser Festlegung geführt haben und ihnen eine pflegewissenschaftliche Begründung fehle. Tatsächlich waren es jedoch inhaltliche und pflegewissenschaftlich begründete Überlegungen, die zur Auswahl der Themenfelder im Strukturmodell geführt haben. Das Ziel dieses kurzen Beitrags ist es, die pflegetheoretischen Grundlagen zu skizzieren, die leitend für die Entwicklung des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit und die Konzeption des Begutachtungsverfahrens waren und auf dieser Basis Hinweise zur pflegetheoretischen Fundierung des Strukturmodells und der Strukturierten Informationssammlung zu geben. Zum besseren Verständnis erfolgen zu Beginn einige Ausführungen zur pflegetheoretischen Fundierung des Pflegeprozesses.
Theoretische Fundierung des Pflegeprozesses
Die Pflegedokumentation gilt als Informationsgrundlage für die Gestaltung des Pflegeprozesses. Sie ist ein Mittel der innerprofessionellen Kommunikation und zur Verständigung mit den Pflegeempfängern. Innerhalb des Pflegeprozesses kommt dem ersten Schritt, der unter den verschiedenen Bezeichnungen Informationssammlung, Ersteinschätzung oder Assessment beschrieben werden kann, eine hohe Bedeutung zu, da durch ihn die Grundlage für die Ausgestaltung des Pflegeprozesses gelegt wird. Es gilt seit langem als gängiger Standard in der pflegewissenschaftlichen Auseinandersetzung, dass die Orientierung an einem Pflegemodell beziehungsweise einer Pflegetheorie für die Gestaltung des Pflegeprozesses hilfreich und daher in hohem Maße empfehlenswert ist. Pflegetheorien helfen dabei, ein Pflegeverständnis zu entwickeln und sich auf eine Sichtweise auf den pflegebedürftigen Menschen zu verständigen. Vielfach wurde diese Erkenntnis jedoch vorrangig technisch-funktional betrachtet und umgesetzt. Eine inhaltliche Diskussion über ein theoretisch basiertes Pflegeverständnis und daraus abzuleitende Konsequenzen für die Pflegepraxis wurden nur selten berichtet. Entsprechend führte die im Rahmen der externen Qualitätsprüfung der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung formulierte Anforderung, die Pflege und den Pflegeprozess an einem Pflegemodell auszurichten, vielfach zu einer formalisierten Einführung pflegetheoretischer Ansätze, ohne deren tiefere Bedeutung und die entsprechenden Konsequenzen für die Pflegepraxis zu diskutieren.
Zwar gibt es auch Beispiele für eine gelungene Anwendung und Umsetzung eines pflegetheoretisch basierten Pflegeprozesses, insbesondere auf der Grundlage des Modells der fördernden Prozesspflege nach Monika Krohwinkel (2013). Als zunehmend problematisch hat sich jedoch die spürbare Kluft zwischen dem somatisch verkürzten Begriff der Pflegebedürftigkeit und dem umfassenden Pflegeverständnis herausgestellt, welches vielen Pflegetheorien zugrunde liegt. Oftmals entstand dadurch der Eindruck einer zunehmenden Kluft zwischen Theorie und Praxis, da die Bezüge zwischen Theorie und Pflegerealität immer weniger zu erkennen waren. Dies führte in der Praxis zu einem eher technischen Umgang mit Pflegetheorien und ihrer Funktion zum Verständnis und zur Unterstützung von Pflegeprozessen. Spielten Pflegetheorien zu Beginn der Akademisierung der Pflege in Deutschland eine bedeutende Rolle, so ist mittlerweile die deutsche Diskussion zu pflegetheoretischen Grundlagen der Pflegepraxis weitgehend zum Erliegen gekommen.
Pflegetheoretische Grundlagen des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit
Im Zuge der Überlegungen zur Entwicklung eines neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit wurden pflegetheoretische Modelle jedoch wieder herangezogen. Sie wurden genutzt, um die Frage zu beantworten, warum ein Mensch der pflegerischen Hilfe bedarf, also pflegebedürftig ist (Wingenfeld et al. 2007). Hilfreich waren dabei vor allem die Arbeiten von Meleis (1991), die Vorschläge zur Systematisierung der Pflegetheorien erarbeitet hat. Sie unterscheidet bedürfnisorientierte, interaktionsorientierte und ergebnisorientierte Pflegetheorien.
Zu den bedürfnisorientierten Pflegetheorien zählen die Arbeiten von Abdellah, Henderson und Orem. In ihren Arbeiten kommt den Problemlagen, auf die sich pflegerisches Handeln richtet, ein zentraler Stellenwert zu: Pflege wird notwendig aufgrund fehlender Ressourcen des Individuums, gesundheitlich bedingte Probleme oder Anforderungen autonom zu bewältigen. Die Problemlagen werden in den Arbeiten als Pflegeprobleme, Beeinträchtigungen der selbständigen Ausübung von Lebensaktivitäten oder als Selbstpflegedefizit beschrieben. Der Fokus der interaktionsorientierten Pflegetheorien liegt auf der Kommunikation, Beziehungs- und Rollengestaltung, auf Aushandlungsprozessen zwischen Pflegekraft und Patient/Pflegebedürftigem sowie auf dem Krankheitserleben. Betont wird die Fähigkeit des Patienten/Pflegebedürftigen, seinen Bedarf interaktiv einschätzen und ausdrücken zu können. In den ergebnisorientierten Theorien geht es um die Erhaltung oder Wiederherstellung einer Balance, Stabilität oder „Homöostase“ im Lebensverlauf als Ergebnis pflegerischen Handelns. Der Pflege kommt dabei eine externe Regulationsfunktion zu, sofern die Patienten/Pflegebedürftigen das Gleichgewicht nicht selbst herstellen können.
Trotz der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Pflegetheorien bestehen Gemeinsamkeiten im Hinblick auf ein Verständnis von Pflegebedürftigkeit. Diese bestehen vor allem in der Abhängigkeit von personeller Hilfe, die entsteht, wenn ein Missverhältnis zwischen gesundheitsbedingten Einbußen, Belastungen und Anforderungen einerseits und den individuellen Ressourcen zu ihrer Bewältigung anderseits existiert. Gemeinsam ist den Ansätzen auch, dass die Abhängigkeit sich nicht nur auf körperliche Verrichtungen, sondern ebenso auf psychische und soziale Dimensionen bezieht.
Neben den Pflegetheorien wurden auch andere Ansätze zur Beschreibung von Pflegebedürftigkeit wie Theorien zur Krankheitsbewältigung, Stellungnahmen nationaler und internationaler Organisationen sowie sozialpolitische Beschreibungen herangezogen und analysiert (Wingenfeld et al. 2007). Im Ergebnis wurden Elemente eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs identifiziert, nach denen ein Mensch als pflegebedürftig zu bezeichnen wäre, wenn er
■ infolge fehlender personaler Ressourcen, mit denen körperliche oder psychische Schädigungen, die Beeinträchtigung körperlicher oder kognitiver/psychischer Funktionen, gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen kompensiert oder bewältigt werden könnten,
■ dauerhaft oder vorübergehend
■ zu selbständigen Aktivitäten im Lebensalltag, selbständiger Krankheitsbewältigung oder selbständiger Gestaltung von Lebensbereichen und sozialer Teilhabe
■ nicht in der Lage und daher auf personelle Hilfe angewiesen ist (Wingenfeld et al. 2007, S.43).
Auf Basis dieser Elemente galt es, den neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit zu konkretisieren und ein Instrument zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit zu entwickeln. Ein entscheidender Aspekt dabei war die Frage, welche Aktivitäten im Lebensalltag und welche Lebensbereiche als relevant für das Bestehen von Pflegebedürftigkeit angesehen werden können. Dazu wurde eine Vielzahl an pflegewissenschaftlichen Systematisierungsvorschlägen herangezogen, um zu identifizieren, welche Aktivitäten und Lebensbereiche unabdingbar für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit sind. Neben den bereits genannten Pflegetheorien wurden zu diesem Zweck auch Pflegediagnosensysteme, die Internationale Klassifikation der Pflegepraxis (ICNP) und verschiedene Assessmentinstrumente herangezogen. Letztendlich wurden sechs Aktivitäten und Lebensbereiche identifiziert, die seit dem 01.01.2017 nach § 14 SGB XI entscheidend für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit sein sollen. Im Begutachtungsinstrument sind diese Aktivitäten und Lebensbereiche als sechs Module enthalten:
1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
Zur Begründung der Auswahl dieser Aktivitäten und Lebensbereiche führen Wingenfeld et al. (2008, S. 25 ff.) aus, dass diese auch Kernbestandteil anderer, international gebräuchlicher Assessmentinstrumente und Klassifikationssysteme sind. So wird die Mobilität, verstanden als Selbständigkeit bei der Fortbewegung und Lageveränderungen des Körpers, in nahezu allen komplexeren Assessmentinstrumenten berücksichtigt, da Beeinträchtigungen der Mobilität häufig auslösend für die Abhängigkeit von personeller Hilfe sind.
Zentral für die selbständige Lebensführung sind kognitive und kommunikative Fähigkeiten, bei denen es sich streng genommen um Funktionen und eine Aktivität oder einen Lebensbereich handelt. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen werden in allen Verfahren, die auf die Erfassung aller wesentlichen Aspekte der Pflegebedürftigkeit zielen, erfasst. Die international vielfach als „self care“ bezeichnete Selbstversorgung, zu der die Aktivitäten Körperpflege, Kleiden, Essen und Trinken sowie Ausscheidungen gehören, ist Inhalt vieler Instrumente zur Bestimmung von Pflegebedürftigkeit. Die Intention des Bereichs Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen und Belastungen ist ebenfalls die Erfassung der individuellen Selbständigkeit, auch wenn im bundesdeutschen Kontext eine Ähnlichkeit mit verordnungsfähigen Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach SGB V besteht. Krankheitsbewältigung wird hier als Aktivität angesehen und für die autonome Lebensführung bei chronischer Krankheit als wichtig erachtet. Der letzte Bereich thematisiert zentrale Aspekte der Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte.
Auf Basis dieser knappen Ausführungen kann zusammenfassend gesagt werden, dass die theoretischen Grundlagen des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit und des Begutachtungsinstruments im Grundsatz eine relativ große Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Ansätzen zur Bestimmung oder Erhebung von Pflegebedürftigkeit aufweisen. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Aktivitäten und Lebensbereiche, auf die sich der neue Begriff der Pflegebedürftigkeit bezieht, den Kernbereich der individuellen Problemlagen abbilden, aufgrund derer ein Mensch als pflegebedürftig – also in seiner Selbständigkeit beeinträchtigt und auf personelle Hilfe angewiesen – ist. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit entspricht somit einem pflegewissenschaftlich begründeten Verständnis von Pflegebedürftigkeit.
Bedeutung für das Strukturmodell
Was bedeuten diese Ausführungen nun für die Gestaltung des Pflegeprozesses und die Pflegedokumentation?
Wie bereits ausgeführt besteht der erste Schritt des Pflegeprozesses in der Sammlung und Bewertung von Informationen zur Situation des pflegebedürftigen Menschen. Die pflegefachliche Herausforderung besteht nun darin, die relevanten Informationen für die Gestaltung des Pflegeprozesses zu erheben. Pflegetheorien leisten in diesem Zusammenhang eine gute Systematisierungs- und Interpretationshilfe. Die Bestandteile des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit gehen nicht auf eine bestimmte Pflegetheorie zurück, sondern basieren auf einer Synthese verschiedener pflegewissenschaftlicher Grundlagen und integrieren die verschiedenen Sichtweisen. Sie fassen die Aktivitäten und Lebensbereiche zusammen, die in der Regel für die Beeinträchtigung der individuellen Selbständigkeit verantwortlich sind und daher den Ausgangspunkt des Pflegeprozesses bilden. In anderen Worten ausgedrückt: es kann davon ausgegangen werden, dass eine Person, die der pflegerischen Hilfe bedarf, Beeinträchtigungen der Selbständigkeit in mindestens einem – oftmals auch in mehreren - der sechs Bereiche aufweist. Die Aufgabe der professionellen Pflege ist es daher, im Rahmen der Ersteinschätzung und Informationssammlung herauszufinden, in welchen Bereichen in welcher Intensität welche Beeinträchtigungen vorliegen. Vor diesem Hintergrund erklären sich der Aufbau und die Themenfelder der Strukturierten Informationssammlung im Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation. Sie unterstützen und leiten die Informationssammlung in den für die Pflegebedürftigkeit relevanten Themenfeldern.
Das dem neuen Begriff zugrunde liegende Verständnis von Pflegebedürftigkeit als Beeinträchtigung der Selbständigkeit unterstreicht auch die Bedeutung der so genannten Risikoeinschätzung im Rahmen des Pflegeprozesses und den Zusammenhang zu den sechs Themenfeldern. Die individuelle Beeinträchtigung der Selbständigkeit in zentralen Bereichen wie der Mobilität oder hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten zieht nicht nur die Notwendigkeit personeller Hilfe in diesen Bereichen nach sich, sondern geht mit der Entstehung weiterer Problemlagen beziehungsweise Risiken einher. Aus fachlicher Sicht ist somit im Zuge der Einschätzung im Pflegeprozess auch die Frage zu beantworten, ob die individuelle Beeinträchtigung potenzielle Risiken mit sich bringt oder diese bereits bestehen. In den Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) werden umfangreiche Hinweise zur Einschätzung dieser Risiken gegeben. Viele dieser Hinweise beziehen sich auf bestehende Probleme im Bereich der Mobilität, Kognition und Selbstversorgung. Eine umfassende Einschätzung zu diesen Themenfeldern liefert somit bereits wertvolle Hinweise auf Vorkommen, Intensität und Ausmaß möglicher Risiken wie Entstehung eines Dekubitus, Problemen mit der Ernährung oder der Kontinenzförderung.
Die Parallelen in den inhaltlichen Themenfeldern von neuem Begriff der Pflegebedürftigkeit und Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation sind nicht auf Basis der eingangs erwähnten pragmatischen und sozialpolitischen Überlegungen entstanden, sondern ergeben sich aus einer fachlich begründeten Sicht auf die Definition von Pflegebedürftigkeit und ihren Konsequenzen für die Gestaltung des Pflegeprozesses. Sie haben keinen Ausschließlichkeitsanspruch, erfüllen jedoch die Bedingungen einer pflegetheoretisch begründeten Sichtweise.
Zum Abschluss dieses Beitrags sei noch einmal kurz auf die Frage eingegangen, ob die Parallelen zwischen neuem Begutachtungsverfahren und Strukturmodell nicht dazu genutzt werden könnten, sich auf die Begutachtung zu begrenzen und auf das Strukturmodell zu verzichten. Bereits in den Grundlagenarbeiten für den Beirat zur Entwicklung eines neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit (Wingenfeld et al. 2008) wurde auf Möglichkeiten hingewiesen, die Ergebnisse aus der Begutachtung der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung zur Bestimmung der Pflegebedürftigkeit für die Pflegeplanung zu nutzen. Damit war jedoch keinesfalls intendiert, dass die Begutachtung die Informationssammlung im Rahmen des Pflegeprozesses ersetzen soll. Stattdessen wurde darauf hingewiesen, dass eine Begutachtung vor dem Hintergrund des erweiterten Begriffs der Pflegebedürftigkeit zahlreiche nützliche Informationen für den Pflegeprozess liefert. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die Informationen aus der Begutachtung ebenso wie andere Informationsquellen kritisch gesichtet und ausgewertet werden sollten. Dieser Schritt ist vor allem zu Beginn der pflegerischen Versorgung, wenn nur wenige Informationen vorliegen, für eine erste Einschätzung wesentlicher Bedarfslagen hilfreich. Die Begutachtung kann jedoch die fachgerechte pflegerische Einschätzung nicht ersetzen. Diese bleibt Aufgabe der Pflegefachkräfte in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen und -diensten. In bereits länger andauernden Pflegebeziehungen werden die Begutachtungsergebnisse der zuständigen Pflegefachkraft ohnehin wenige Informationen liefern, die sie nicht bereits durch längere Erfahrung und eigene, direkte Beobachtung bzw. die Aktualisierung ihrer eigenen pflegerischen Einschätzung erhalten hat. Es sind vor allem Informationen zu individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten, zur Biografie, zu den allgemeinen Lebensbedingungen sowie zu den Faktoren, die Pflegebedürftigkeit beeinflussen, und zu ihrem individuellen Wechselspiel, die vom neuen Begutachtungsinstrument nicht erfasst werden und die es in der pflegefachlichen Einschätzung zu erfassen gilt. Denn die Begutachtung verfolgt ein anderes Ziel als die individuelle Pflege: die Feststellung, ob und in welchem Maße eine Person Leistungen der Sozialversicherung zustehen.
Literatur:
Krohwinkel, M. (2013): Fördernde Prozesspflege mit integrierten ABEDLs: Forschung, Theorie und Praxis. Bern: Huber
Meleis, A. (1991): Theoretical Nursing: Development & Progress. 2. Auflage. New York: Lippincott
Wingenfeld, K.; Büscher, A.; Schaeffer, D. (2007): Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten. Studie im Auftrag des Modellprogramms nach § 8 Abs. 3 SGB XI im Auftrag der Spitzenverbände der Pflegekassen. Bielefeld: Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld
Wingenfeld, K.; Büscher, A.; Gansweid, B. (2008): Das neue Begutachtungsassesment zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Studie im Auftrag des Modellprogramms nach § 8 Abs. 3 SGB XI im Auftrag der Spitzenverbände der Pflegekassen. Bielefeld: Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld