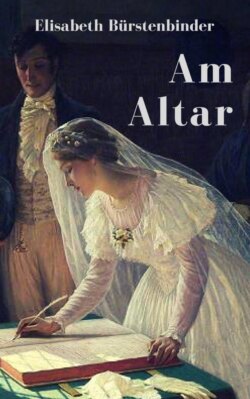Читать книгу Am Altar - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDer Herbstmorgen war grau und trübe. Der Nebel lagerte noch feucht und dicht auf der Erde, er hing in schweren Tropfen an den dunklen Tannenzweigen und deckte als leichter weißer Reif den Boden der kleinen Waldlichtung, die inmitten der umfangreichen S.’schen Forsten lag. Am Rande der Lichtung stand ein junger Bursche von vielleicht sechszehn oder siebzehn Jahren in der groben Uniform, wie sie die Leute des königlichen Försters gewöhnlich trugen, eine gedrungene kräftige Gestalt, die Jagdtasche an der Seite, das Gewehr auf der Schulter. Er schien augenblicklich jedoch keine Jagdzwecke zu verfolgen, sondern stand ruhig an einen Baum gelehnt und blickte mit gleichgültiger Miene in den Wald hinaus, als ein fernes Geräusch seine Aufmerksamkeit erregte. Es klang wie der Galopp von Pferden, der immer näher kam und in einiger Entfernung von der Wiese plötzlich aufhörte; statt dessen vernahm man Fußtritte, gedämpfte Stimmen wurden laut, Sporen klirrten; gleich darauf rauschten die Gebüsche und mehrere Offiziere traten auf den freien Platz.
„Wir sind die Ersten, scheint es!“ sagte der eine von ihnen, ein schöner hochgewachsener Mann in der Uniform eines Cavallerierittmeisters, indem er flüchtig den Ort musterte.
Einer seiner Begleiter zog die Uhr. „Erst drei Viertel auf Acht! Wir sind zu scharf geritten; vor Acht werden sie schwerlich hier sein. Ihr hättet übrigens keinen schlechtern Morgen wählen können; der verdammte Nebel hindert ja überall!“
Der Rittmeister zuckte leicht die Achseln. „Bah! Auf unsere Distance sieht man klar genug. Wer von Euch hat die Pistolen?“
„Halt!“ rief plötzlich einer der jüngeren Officiere. „Wir sind nicht allein! Wer steht dort?“ Er wies auf den jungen Jäger am andern Ende der Wiese, der die Ankommenden mit einem raschen scharfen Blick gemustert hatte, aber, ohne sich weiter um sie zu kümmern, stehen geblieben war.
„Irgend ein Jägerbursche,“ sagte der Rittmeister gleichgültig hinübersehend. „Indessen, er scheint hier Posto gefaßt zu haben. Saalfeld, sieh zu, daß Du den Menschen wegbringst; er könnte uns stören.“
Der Angeredete folgte der Weisung, indem er über die Wiese schritt und die Unterhandlung mit dem Betreffenden einzuleiten begann; diese schien aber nicht das gewünschte Resultat zu haben, denn nach Verlauf von fünf Minuten kehrte der Lieutenant aufgeregt und hochroth im ganzen Gesicht zu seinen Cameraden zurück.
„Nun? Was giebt es?“ trat ihm der Rittmeister entgegen.
„Der Mensch will nicht fort!“ rief Saalfeld heftig. „Er ist widerspenstig und unverschämt im höchsten Grade; wir werden ihn zwingen müssen!“
„Damit er Lärm macht, uns seine Cameraden oder gar den Förster auf den Hals hetzt und dadurch vielleicht das ganze Recontre in Frage stellt, nicht wahr? Mit Zwang ist hier nichts auszurichten; Du wirst den Burschen mit Deiner brüsken Manier gereizt und uns wieder unnöthige Schwierigkeiten bereitet haben. Ich werde selbst mit ihm sprechen.“ Damit schritt der Rittmeister, von den übrigen Officieren gefolgt, auf den Jäger zu und redete ihn leutselig an.
„Hast Du hier an dem Orte irgend etwas zu thun, mein Junge?“
„Nein!“ lautete die sehr lakonische Antwort.
„Oder wartest Du vielleicht auf den Förster oder auf sonst Jemand?“
„Nein!“
„Nun, dann wirst Du uns wohl auch ohne Schwierigkeit den Platz räumen. Wir beabsichtigen hier Schußwaffen zu probiren und wünschen dabei ungestört zu sein. Hier ist ein Trinkgeld für Deine Gefälligkeit; geh jetzt und laß uns allein!“
Die Worte wurden mit ruhiger, freundlicher Herablassung, aber doch in einem Tone gesprochen, der keinen Widerspruch zuließ, und die ganze Art und Weise hatte etwas so Imponirendes, daß das Gehorchen sich von selbst zu verstehen schien; aber ob der Jägerbursche nun zu Denen gehörte, die sich nicht imponiren ließen, oder ob die brüske Art des Lieutenant Saalfeld, der im Tone des Befehls seine Entfernung verlangt, ihn in der That gereizt hatte, – er kümmerte sich durchaus nicht um den dargebotenen Thaler, sondern entgegnete trocken:
„Danke, Herr Officier! Ich bleibe hier!“
„Aber ich sage Dir doch, daß wir hier Schießübungen vornehmen wollen!“ In der Stimme des Rittmeisters verrieth sich bereits einige Ungeduld.
„Meinetwegen!“ war die kaltblütige Antwort. „Mich hindert das nicht.“
„Aber uns!“ rief der Officier, nun auch gereizt werdend. „Wir wünschen überhaupt keinen Zuschauer, Du hörst es ja!“
Der junge Jäger lehnte sich ruhig wieder an seinen Baum. „Ja, das höre ich. Ich bleibe aber nun einmal hier. Wenn also durchaus Einer von uns gehen muß, so –“
„Unverschämter Bursche!“ brauste Lieutenant Saalfeld auf und legte die Hand an seinen Degen. Der junge Mensch trat einen Schritt zurück, sah ihn von oben bis unten an, nahm dann langsam sein Gewehr von der Schulter und untersuchte den Hahn desselben. So ruhig und kaltblütig diese Bewegung auch ausgeführt wurde, den Officieren trat doch das Herausfordernde derselben vor Augen; sie nahmen eine drohende Haltung an, und der Widerspenstige hätte seinen Trotz vielleicht arg büßen müssen, wäre der Rittmeister nicht dazwischen getreten; auch er war offenbar heftig gereizt, aber er beherrschte sich.
„Keine Gewaltthätigkeiten!“ sagte er leise, doch in sehr entschiedenem Tone. „Das Forsthaus ist nicht allzu weit entfernt und Ihr wißt, daß wir allen Grund haben, Aufsehen zu vermeiden. Wenn der Bursche durchaus nicht fortzuschaffen ist, so bleibt uns nichts anderes übrig als das Terrain zu wechseln. Seht zu, daß Ihr einen andern geeigneten Platz im Walde ausfindig macht, während ich unsere Gegner hier erwarte.“
Die Officiere zeigten indeß sehr wenig Lust, sich dieser Anordnung zu fügen, sie waren im höchsten Grade aufgebracht und es bedurfte des ganzen Ansehens ihres Cameraden, sie von Gewaltschritten gegen den unwillkommenen Störer abzuhalten, der vollkommen gleichgültig und unbewegt dreinschaute, als ginge ihn die Sache nicht im mindesten an. Es gab ein heftiges Hin- und Herreden, das erst durch die Ankunft dreier anderer Herren unterbrochen wurde. Sie blieben befremdet stehen, als sie den Wortwechsel auf der Wiese vernahmen, und blickten fragend auf die Officiere. Lieutenant Saalfeld trat sogleich höflich auf sie zu.
„Ich bedaure, meine Herren, Sie von einem sehr unangenehmen Zwischenfall in Kenntniß setzen zu müssen. Wir fanden bei unserer Ankunft hier diesen Menschen vor, der sich starrköpfig weigert, den Platz zu räumen, und auf keine Weise fortzuschaffen ist. Es wäre ein Leichtes, ihn mit Gewalt wegzubringen, aber Sie begreifen – der Lärm, den der Bursche erheben würde – es ist empörend!“
„Allerdings sehr unangenehm!“ stimmte einer der neuen Ankömmlinge bei. „Könnte man nicht – aber ich vergesse, die Herren einander vorzustellen. Herr Doctor Ried, der die Güte haben wird, uns seinen ärztlichen Beistand zu leihen – Herr Baron von Saalfeld, der Secundant des Grafen Rhaneck.“
Die Herren verneigten sich und der Arzt warf einen Blick hinüber nach dem Störenfried.
„Der da?“ sagte er kopfschüttelnd. „Da geben Sie nur die Hoffnung auf, ihn mit Güte oder Gewalt fortzubringen, Herr Baron. Ich kenne den Burschen, es ist der Sohn des Unterförsters Günther. Der läßt sich zur Noth todtschlagen, wenn es nicht anders geht, aber wegbringen von dem Platze, auf dem er sich einmal vorgenommen hat, stehen zu bleiben, läßt er sich nicht, das ist vergebene Mühe.“
Saalfeld unterdrückte einen halblauten Fluch. „Graf Rhaneck schlug allerdings vor, das Terrain zu wechseln, aber es wäre doch unerhört, müßten wir der Unverschämtheit eines solchen Menschen weichen –“
„Das ist nicht nöthig!“ nahm jetzt der jüngste der zuletzt Gekommenen, der bisher schweigend zugehört, das Wort. „Lassen Sie ihn hier, wenn er durchaus nicht fortzubringen ist. Herr Doctor, da Sie den jungen Menschen kennen, so haben Sie wohl die Güte, ihn unter Ihre Obhut zu nehmen, damit er uns nicht etwa stört oder verräth. In einer Viertelstunde ist unsere Angelegenheit abgethan, verborgen kann der Ausgang doch nicht bleiben, und – jetzt keinen Aufschub weiter, ich bitte dringend darum.“
Saalfeld vernahm mit augenscheinlicher Befremdung den Vorschlag, der so sehr gegen das Herkommen stritt, dennoch ging er, ihn seinem Freunde mitzutheilen. Wider Erwarten willigte der Rittmeister sofort ein.
„Er hat Recht!“ sagte er hastig. „Nur jetzt keinen Aufschub, der neue Störung bringen könnte. Der Doctor mag für den Burschen einstehen. Triff Deine Vorbereitungen, Saalfeld.“
Der Arzt war inzwischen zu dem jungen Günther getreten und blieb dicht vor ihm stehen. „Guten Morgen, Bernhard!“
„Guten Morgen, Herr Doctor!“ erwiderte der Angeredete, höflicher als man es, seinem früheren Benehmen nach, ihm hätte zutrauen sollen.
„Warum in aller Welt willst Du den Platz hier durchaus nicht räumen?“ examinirte der Arzt, indem er mit einem halb zornigen, halb verwunderten Blick den sechszehnjährigen Burschen maß, der allein den fünf Officieren die Spitze bot.
[3] „Ich will nicht!“ war die gleichgültige Antwort, in der doch zugleich ein störrischer Trotz lag.
„So? Höre, Bernhard, es ist ein Glück, daß du nächstes Jahr in die Stadt und zum Militär kommst. Man wird Dir Dein ‚Ich will nicht!‘ mit der Disciplin wohl etwas austreiben, und gnade Dir Gott, wenn einer von den Officieren dort Dein Vorgesetzter wird, Du würdest den Trotz arg zu büßen haben, wie Du ihn jetzt schon büßen müßtest, hätten die Herren nicht allen Grund – ja so, das brauchst Du nicht zu wissen. Nun aber sei einmal vernünftig! Das Hierbleiben hast Du durchgesetzt, jetzt bleibst Du aber ruhig hier an meiner Seite stehen und rührst Dich für’s Erste nicht. Hast Du mich verstanden?“
Die leise, aber nachdrückliche Strafpredigt, so ernstlich sie auch gemeint sein mochte, wurde doch in einem so väterlichen Tone, mit so unverkennbarem Wohlwollen gehalten, daß sie ihre Wirkung auf den jungen Starrkopf keineswegs verfehlte. Ihm genügte es augenscheinlich, daß er den Officieren gegenüber seinen Platz behauptet hatte, und er fügte sich jetzt der ihm gewordenen Anweisung, ohne eine Miene zu verziehen.
„Nun?“ fragte der Begleiter des Arztes herantretend.
„Ich nehme den Störenfried auf mich, er wird uns nicht hindern. Wenn es also durchaus sein muß –“
Der Andere unterdrückte einen Seufzer. „Sie wissen wohl, daß es hier keine Wahl giebt. Also auf Ihre Verantwortung – darf ich bitten, Herr von Saalfeld?“
Die Secundanten maßen die Schritte ab und luden die Waffen. Was die beiden Parteien hier auf den Kampfplatz geführt, war sicher nicht eine gewöhnliche, vielleicht in der Hitze oder Uebereilung gefallene Beleidigung und die Nothwendigkeit einer Genugthuung dafür. Man sah es an dem furchtbaren Ernst auf all den Gesichtern ringsum, an dem entsetzlich kleinen Raum, auf dem die Kugeln gewechselt werden sollten, vor Allem an der Haltung der beiden Gegner, daß es sich hier um Leben und Tod handelte. Sie standen abgewendet von einander, noch hatte Keiner dem Anderen einen Blick gegönnt, selbst die alte Sitte des Grußes vor dem Zweikampfe war unterblieben, die Verneigung hatte nur den beiderseitigen Begleitern gegolten. Der Rittmeister stand mit verschränkten Armen und folgte schweigend den Vorbereitungen, aber selbst diese ruhige Haltung vermochte nicht die Erregung zu verbergen, in der er sich sichtlich befand. Die Stirn war dunkelroth, die Lippen zuckten bisweilen leise, und doch bedurfte es nur eines Blickes in das Gesicht des Mannes, um zu wissen, daß die bevorstehende Gefahr keinen Antheil an dieser Erregung hatte. Der Muth, den schon sein Stand ihm zur Pflicht machte, sprach zu deutlich aus diesen kühnblitzenden Augen, aus diesem schönen lebensvollen Antlitz, das nur durch Eins entstellt ward, durch eine tiefe Falte zwischen den Augenbrauen, die erst dort stand, seit der Gegner den Kampfplatz betreten, und sich mit jeder Minute tiefer in die Stirn grub, der sie ein eigenthümlich hartes und feindseliges Gepräge lieh.
Sein Gegner in bürgerlichem Anzug war bedeutend jünger als er, eine hohe schlanke Gestalt, ein blasses ernstes Gesicht, mit tiefschwarzem Haar und tiefen dunklen Augen. Die Züge redeten von angestrengter geistiger Arbeit, von Nachtwachen und dumpfer Stubenluft, vielleicht auch von Sorgen und Entbehrungen, sonst mochten sie wohl leidenschaftlich aufflammen können, jetzt lag eine starre finstere Ruhe darauf, die eisig Alles gefangen hielt, was sich vielleicht früher darunter geregt und gezuckt hatte. Er schenkte den Vorbereitungen wenig oder gar keine Aufmerksamkeit; an den Stamm der großen Eiche gelehnt, die inmitten des Platzes stand, blickte er unbeweglich hinaus in den verschleierten Wald. Schon kämpfte die Sonne mit dem Nebel, aber noch vermochte sie nicht, ihn zu durchdringen, es lagerte noch ringsum schwer und grau wie Todesschatten. Der Morgenwind strich mit leisem Wehen über das braune Haidekraut und flüsterte in dem Wipfel der Eiche, von der die welken Blätter niedersanken; eins davon streifte feucht und kalt die Stirn des unten Stehenden. Er blickte schweigend nieder auf das fallende Laub und dann wieder hinein in den Nebel, der vor ihm wogte.
Die Vorbereitungen waren geendigt, die Gegner empfingen die Waffen und nahmen ihre Plätze ein. Zum ersten Male begegneten sich jetzt ihre Augen und vorbei war es mit der finsteren Ruhe des Jüngeren, vorbei mit all der mühsam erkämpften und bis hierher behaupteten Selbstbeherrschung. Was jetzt in seinem Antlitz aufflammte, das war eine so furchtbare Drohung, ein so wilder tödtlicher Haß, daß man wohl sah, hier galt es Tödten oder Fallen, es gab kein Drittes, aber die furchtbare Erregung drohte verhängnißvoll für ihn zu werden, die Waffe bebte in seiner Hand.
Ihm gegenüber stand der Officier. Nicht die Kugel, das Auge des Gegners war es, was er gefürchtet, und unter diesem Auge stieg langsam eine flammende Röthe in seinem Gesicht auf, wo eine tödtliche Scham mit verhaltenem Ingrimm kämpfte, aber zugleich trat jener grausame Zug auf der Stirn schärfer und deutlicher hervor und die Waffe hatte fest und sicher die tödtliche Richtung, als das Zeichen gegeben ward.
Der jüngere schoß zuerst, die Kugel flog dicht an dem Haupte des Officiers vorüber und riß ihm die Epaulette von der linken Schulter, er selbst stand unverletzt, in der nächsten Secunde krachte auch sein Schuß – ein halb erstickter Schrei, ein Niederstürzen, ein hervorquellender Blutstrom – das Duell war zu Ende.
Der Arzt und der Secundant waren zu dem Gefallenen geeilt und Ersterer untersuchte die Wunde, auch die Officiere waren näher getreten und warteten schweigend das Resultat der Untersuchung ab; nach einigen Minuten blickte der Arzt auf und zuckte ohne zu sprechen die Achseln.
„Tödtlich?“ fragte der Rittmeister halblaut.
„Ja!“
Da schlug der Verwundete noch einmal das Auge auf und heftete es auf den Fragenden. Es war nur ein einziger Blick, der brechende Blick eines Sterbenden, aber es mußte etwas Furchtbares darin stehen, der Officier zuckte zusammen, er war todtenbleich geworden und wendete sich hastig ab.
„Meine Herren, ich lasse den Verwundeten in Ihrer Obhut! Wenn meine Cameraden Ihnen in irgend einer Weise Beistand leisten können –“
Der Arzt machte eine abwehrende Bewegung. „Was hier noch zu thun ist, dazu reichen wir Beide allein aus. Gehen Sie, meine Herren, und überlassen Sie das Weitere uns.“
„Dürfen wir Ihnen vielleicht unseren Wagen – ?“ fragte Saalfeld.
„Ich danke, wir haben den unsrigen gleichfalls in der Nähe. Sorgen Sie nicht, das hier noch Mögliche wird geschehen!“
Die Officiere grüßten schweigend und entfernten sich, die Sporen klirrten, die Gebüsche rauschten, dann vernahm man den Hufschlag der Pferde, der sich weiter und weiter entfernte, endlich ward es still.
Und still war es jetzt auch auf der Wiese, der Sterbende lag bewußtlos mit geschlossenen Augen, sein Secundant kniete neben ihm, mit den Armen seinen Kopf stützend, der Arzt stand an der anderen Seite und zählte die Pulsschläge, die nur seine geübte Hand noch zu finden vermochte, auf einmal fühlte er leise seinen Arm berührt, der junge Günther stand neben ihm.
„Unser Haus ist nicht weit,“ flüsterte er, „wenn Sie vielleicht –“ ein Blick auf den Verwundeten vollendete den Satz.
„Danke, mein Junge!“ gab der Arzt in demselben Tone zurück, „aber es ist zu spät, hier kann nichts mehr helfen.“
Der Secundant blickte auf. „Aber, Doctor, wollen wir ihn denn hier auf dem feuchten Waldboden sterben lassen? Wir könnten ihn doch wenigstens in’s Forsthaus tragen.“
„Nein!“ sagte der Arzt bestimmt. „Er hält den Transport nicht aus, die erste Bewegung hat den Tod zur Folge, und übrigens stirbt es sich grade so leicht oder so schwer unter freiem Himmel, als zwischen vier engen Wänden. In wenig Minuten ist ohnedies alles vorüber.“
Die Unterredung war im leisen Flüstertone geführt worden, jetzt trat eine Pause ein, keiner der drei Männer sprach, schweigend erwarteten sie das Nahen des Todes. Man vernahm nichts als die immer schwächer und schwächer werdenden Athemzüge des Sterbenden, dann noch ein letztes tiefes Aufathmen, ein Aufzucken, ein erneutes Hervorbrechen des Blutstromes – es war vorüber.
Der Secundant ließ langsam den Kopf seines Freundes niedergleiten, er hatte den Todeskampf mit keiner Bewegung gestört; jetzt, wo nichts mehr zu schonen war, brach die Fassung des jungen Mannes zusammen; der Arzt ehrte seinen Schmerz, er winkte dem jungen Günther, sich mit ihm zurückzuziehen, erst in einiger Entfernung von der Gruppe blieben sie stehen.
[4] „Nun, Bernhard,“ die sonst so freundliche Stimme des Doctors hatte einen Klang tiefer Bitterkeit, „also Du hast es mit Deinem Starrkopf wirklich durchgesetzt, ein Duell mit anzusehen. Bist Du nun zufrieden?
Bernhard blickte ihn an, sein vorhin so ruhiges Gesicht war bleich, die Gleichgültigkeit, die er während des ganzen Streites mit den Officieren bewahrt hatte, war jetzt völlig geschwunden.
„Das war ja – ein Mord!“ sagte er langsam.
„So? Meinst Du? Nun, dann sahest Du wenigstens, daß er in vollster Ordnung, mit aller gegenseitigen Höflichkeit und Einwilligung vor sich ging, und daß wir Anderen dabei standen, ohne auch nur die Hand zur Rettung zu rühren. Die Herren in der Stadt haben ein Privilegium auf diese Art Mord, mein Sohn!“
„Aber weshalb schossen sie beide?“ fragte Bernhard, das Auge noch immer unverwandt auf den Todten gerichtet.
„Hm, das ist schwer zu erklären, wenigstens Dir gegenüber. Es handelte sich um eine tiefe, eine tödtliche Beleidigung, die mit Blut gesühnt werden sollte. Wie sie gesühnt ward, das hast Du ja soeben gesehen! Der Beleidigte wußte nicht mit Pistolen umzugehen, deshalb fehlte er, und der Beleidiger war ein trefflicher Schütze, deshalb schoß er den Gegner nieder – man nennt das auf deutsch ‚seiner Ehre genug thun‘, merke Dir das!“
Mit diesen in schneidendem Tone gesprochenen Worten wandte der Arzt sich von ihm und trat wieder zu der Gruppe. Der Secundant hatte sich inzwischen etwas gefaßt, er stand auf.
„Wir werden ihn jetzt wohl in den Wagen tragen müssen, Doctor! Wollen Sie mich auf einem schweren Gange begleiten? Sie wissen, wohin ich mit der Leiche fahre; ich habe nicht den Muth, allein hinzutreten mit einer solchen Nachricht!“
Der Arzt reichte ihm die Hand. „Ich komme mit Ihnen! Freilich ist’s ein schwerer Gang, noch dazu hier, wo mit dem einen Leben Alles zusammenbricht. Wollte Gott, wir hätten die Stunde erst hinter uns!“
Sie hoben den Todten empor, Bernhard legte unaufgefordert mit Hand an und Niemand wehrte ihm; langsam traten die Männer mit ihrer Last den Rückweg an und schlugen die Richtung nach dem in einiger Entfernung wartenden Wagen ein. –
Still und einsam lag die kleine Waldwiese, wo sich vor kurzem noch so viel Leben geregt, wo eins davon sich verblutet hatte. War es der letzte Act eines längst begonnenen Drama’s, was sie soeben gesehen, oder der erste eines eben beginnenden – wer konnte Auskunft darüber geben? Die Sonne kämpfte sich allmählich durch den Nebel, er wallte und wogte hin und her und verschwebte endlich als blauer Duft fern im Walde. Siegreich behaupteten die Strahlen ihre Bahn, hellbeschienen standen die riesigen Föhren mit ihren rothen Stämmen und hoben die starren Häupter empor in die klare duftige Herbstluft, und goldene Lichter spielten auf dem herbstlich bunten Laub der Eiche. Die Sonne schmolz den Reif vom Boden und mit ihm die Spuren der Fußtritte, die einzigen Spuren des stattgehabten Kampfes. Nur dort, wo der Todte gelegen, zeichnete sich in schwachen Umrissen, aber noch deutlich erkennbar, ein dunkler Fleck auf dem Rasen ab; es sah aus, als sei ein Schatten dort zurückgeblieben, der Schatten irgend eines unsichtbaren Gegenstandes, der unverrückbar und geisterhaft mitten in dem hellen Sonnenscheine lag.
Ein leichter offener Jagdwagen, von zwei munteren Braunen gezogen, rollte im schärfsten Trabe den Waldweg entlang, der von der Eisenbahnstation E. hinein in das Gebirge führte. Der Herr, welcher von seinem Sitze aus das Gefährt selbst lenkte, hielt die Zügel mit so gleichgültiger Ruhe, als sei es eine Kleinigkeit für ihn, die jungen wilden Thiere zu bändigen. Er war ein Mann von etwa vierzig Jahren, eine gedrungene, markige Gestalt; schwarzes kurzgeschnittenes Haar umgab eine breite, massive Stirn, auf die Erfahrungen und Sorgen schon manche Linien gezeichnet hatten. Die Züge konnten für gewöhnlich, ja für plump gelten, und sie wurden es noch mehr durch einen Ausdruck von Phlegma, der anscheinend darauf ruhte; wer aber länger und tiefer in dies Gesicht sah, fand bald genug heraus, daß es mehr enthielt, als es beim ersten Anblick zu versprechen schien. In dem scharfen, wachsamen Auge zumal lag entschieden nichts Gewöhnliches, es war der Blick eines Mannes, der gewohnt ist, ohne Hast, aber auch ohne Rast im Leben vorwärts zu gehen, ein Blick, der wenn er erst einmal ein Ziel in’s Auge faßt, es auch unverrückbar festhält und nicht wieder losläßt, bis er es erreicht hat. Was in den Zügen als Phlegma erschien, das gab sich in dem Auge als kalte überlegene Ruhe kund, die zwar erst allmählich und langsam, aber desto sicherer auf den Beobachter wirkte.
Es konnte nicht leicht einen schärferen Contrast geben, als diesen Mann und das junge, kaum dem Kindesalter entwachsene Mädchen, das an seiner Seite saß. Diesem rosigen Antlitz war sicher noch nie der Ernst des Lebens genaht, diese klare, weiße Stirn hatte gewiß keine Sorge je berührt; das volle Kinderglück strahlte noch aus den dunkelblauen Augen, die groß und verwundert in die fremde Welt hineinblickten, lächelte noch schelmisch unbefangen aus den kleinen Grübchen der Wangen, das ganze reizende Gesichtchen war ein Sonnenschein. Eine Fülle brauner Locken quoll lose, nur an der Stirn von einem Bande zusammengehalten, unter dem kleinen Strohhute hervor und wallte herab auf das einfache graue Reisekleid, das die feine zierliche Gestalt umschloß. Die schwindelnd schnelle Fahrt gewährte ihr augenscheinlich großes Vergnügen und es lag nicht die leiseste Spur von Besorgniß, wohl aber sehr viel jugendlicher Uebermuth in dem silberhellen Lachen, womit sie jetzt ausrief:
„O! Wir fliegen ja förmlich! Am Ende gehen die Pferde noch mit uns und dem Wagen durch.“
„Wenn ich die Zügel in Händen habe, sicher nicht!“ lautete die im ruhigsten Tone gegebene Antwort, ohne daß auch nur der geringste Versuch gemacht ward, den Lauf der Thiere zu mäßigen.
Die junge Dame sah etwas enttäuscht aus, es schien fast, als habe sie sich auf das Durchgehen und das damit nothwendig verbundene Abenteuer gefreut. „Werden wir bald in Dobra sein?“ begann sie voll neuem, nach einem mißlungenen Versuch, durch die dichten Waldbäume hindurch irgend etwas von der Gegend zu entdecken.
„In einer halben Stunde. Nimm Dich zusammen, Lucie, ich werde Dich sogleich bei unserer Ankunft Deiner neuen Erzieherin vorstellen.“
Lucie verzog die rosigen Lippen, als gebe man ihr etwas sehr Bitteres zu kosten. „Wenn ich nur wüßte, was ich jetzt noch mit einer Erzieherin anfangen soll! Du weißt doch, Bernhard, daß ich bereits im vorigen Monat sechszehn Jahre geworden bin!“
Es lag sehr viel Selbstgefühl und noch mehr Indignation in diesen Worten, leider blieben sie aber ganz und gar wirkungslos dem starren Begleiter gegenüber, auf dessen Lippen nur ein sarkastisches Lächeln erschien.
„Sechszehn Jahre? Allerdings ein sehr ehrwürdiges Alter, nichtsdestoweniger wirst Du verzeihen, daß es mir nicht genügenden Respect einflößt, um Dich sofort zur Dame und Herrin von Dobra zu erheben, und daß ich es vielmehr vorziehe, Dich für’s Erste noch unter die Obhut einer Gouvernante zu stellen. Uebrigens bringt Fräulein Reich die besten Empfehlungen und alle die nöthigen Eigenschaften zu ihrem, wie mir scheint, nicht gerade leichten Amte mit. Du wirst Dich bald mit ihr befreunden.“
„Ich mag sie gar nicht!“ schmollte Lucie mit dem ganzen Eigensinn eines verzogenen Kindes; „ich weiß im Voraus, daß ich sie nie werde leiden mögen. Die Gouvernanten sind alle steif und langweilig wie Miß Gibbon, oder nervös und sentimental wie Mademoiselle Ormond, oder feierlich wie Madame Schwarz höchstselbst, die beim bevorstehenden Weltuntergange noch ihre Robe in Falten legen würde, um mit Anstand unterzugehen, oder –“
„Ich bitte Dich, Lucie, geht das so fort, bis wir in Dobra sind? Du hast eine eigenthümliche Art, Dich für genossene Erziehung dankbar zu erweisen. Nach dem Resultat freilich, das ich vor mir sehe, scheint die pädagogische Befähigung jener Damen auf keiner allzuhohen Stufe stehen.“
„O, mit mir richteten sie Alle nichts aus,“ Lucie schüttelte triumphirend ihre Locken, „trotzdem sie mindestens einmal in der Woche allesammt über mich zu Gericht saßen. Madame Schwarz hielt mir dann jedesmal vor, ich sei ein Irrwisch, der ihr ganzes Pensionat in Verwirrung bringe, und überall Revolution anstifte; [6] Mademoiselle vergoß Thränen und erzählte, wie oft ich ihr wieder Nervenzucken verursacht, und Miß Gibbon stand dabei, schüttelte ihr weises Haupt und murmelte indignirt: ’t is shocking – ich glaube, sie waren sämmtlich froh, als Du mich zurückfordertest und ich der Pension den Rücken kehrte.“
„Wirklich! Nun dann ist es allerdings nothwendig, daß Du in andere Hände kommst. Ich habe bisher nicht viel Zeit gefunden, mich um Deine Erziehung zu kümmern, Lucie, und werde sie auch in Zukunft kaum finden, aber merke Dir ein für allemal, daß, wenn die Autorität von Fräulein Reich nicht ausreichen sollte, jetzt die meinige dahinter steht, der Du Dich hoffentlich fügen wirst, und daß ich Verwirrung und Revolutionen in meinem Hause überhaupt nicht dulde, am allerwenigsten aber von einer Schwester, die mir soeben deutlich beweist, daß sie, anstatt in den Salon, noch ganz und gar in die Kinderstube gehört.“
Die Zurechtweisung wurde sehr ruhig, aber zugleich so bestimmt gegeben, daß Lucie gar nicht einmal Miene machte, die letzten, höchst beleidigenden Worte übel zu nehmen. Halb verwundert, halb eingeschüchtert sah sie den Bruder von der Seite an, ob es ihm wohl mit der Strenge Ernst sei, aber der Blick in sein Gesicht mochte ihr nicht viel Tröstliches zeigen. Die weitere Opposition unterblieb, wenn es auch in dem Antlitz der jungen Dame deutlich geschrieben stand, daß die aufgedrungene Erzieherin gerade kein beneidenswerthes Loos haben werde, und daß der Zögling sich bereits vornahm, ihr das Leben nach Kräften schwer zu machen.
Bernhard zog die Zügel plötzlich an sich, in der Biegung der Straße ward jetzt ein zweiter Wagen sichtbar, und es schien bei dem schmalen, dicht am Abhang entlang führenden Wege allerdings nicht rathsam, in dem bisherigen Tempo daran vorüberzufahren. Es war eine herrschaftliche Equipage, wohl aus der Residenz mit hergebracht; denn für eine Fahrt in den einsamen Bergen schienen diese prachtvollen Seidenpolster, dieser wappengeschmückte Schlag und die reiche grüne und goldene Livree der Dienerschaft kaum passend. Zwei schon ältere Damen in reichster und elegantester Stadttoilette saßen darin, aber obgleich die Wagen langsam und ganz nahe aneinander vorüberfuhren, wurde doch weder ein Gruß, noch ein Zeichen des Erkennens zwischen ihren Insassen gewechselt. Die Damen sahen vornehm zur Seite und Bernhard schien seine ganze Aufmerksamkeit den Pferden zuzuwenden; in weniger denn einer Minute war man aneinander vorbeipassirt und setzte gleichzeitig wieder zu schneller Fahrt ein.
„Bernhard, wer waren die Damen?“ Lucie legte mit kindlicher Neugierde beide Hände auf den Arm des Bruders.
„Gräfin Rhaneck und ihre Gesellschafterin!“ antwortete er kurz.
„Du kennst sie also?“
„Es sind meine nächsten Gutsnachbarn. Ich sitze in Dobra gerade eingekeilt zwischen Aristokratie und Clerus, rechts liegt Schloß Rhaneck, links das Stift mit ihren beiderseitigen Ländereien. Kaum einen Schritt kann ich aus meinem Gebiete hinausthun, ohne mit den Insassen des einen oder des anderen in Berührung zu kommen – eine beneidenswerthe Nachbarschaft!“
„Aber wenn Dir die Lage der Güter nicht gefiel, weshalb kauftest Du sie denn eigentlich?“ fragte Lucie naiv.
„Weil sie für einen Spottpreis zu haben waren, und weil ich bei den dortigen Verhältnissen Erfahrungen verwerthen und Erfolge erreichen kann, die in unserm Norden mit dem zehnfachen Kostenaufwande nicht durchzuführen wären. Doch davon verstehst Du nichts!“ brach er plötzlich kurz ab und wies mit der Hand nach links. „Sieh Dir lieber den Waldweg dort an, er führt gleichfalls nach Dobra.“
Die junge Dame fuhr wie elektrisirt in die Höhe. „O, wie schattig und kühl! Laß uns ein wenig aussteigen und zu Fuße gehen, wir haben lange genug im engen Wagen gesessen!“
„In der Mittagsgluth? Was fällt Dir ein, Kind!“
„O, ich bin so lange nicht im Walde gewesen! Jahrelang habe ich nichts zu sehen bekommen, als nur den Stadtpark und unseren ummauerten Pensionsgarten. Bitte, bitte, Bernhard, laß mich in den Wald, nur auf eine einzige Viertelstunde!“
Es lag eine so unverkennbare Sehnsucht in der schmeichelnden Bitte, daß der Bruder unwillkürlich nachgiebiger gestimmt ward.
„Nun, meinetwegen! Eine Viertelstunde lang will ich Dir den Willen thun, Joseph mag bis zur Waldecke vorausfahren und uns dort erwarten.“
Er gab die Zügel dem hinter ihnen sitzenden Kutscher, stieg ab und wandte sich dann um, ihr die Hand zum Aussteigen zu bieten, aber das junge Mädchen wartete gar nicht darauf; ohne den Wagentritt auch nur zu berühren, sprang sie mit gleichen Füßen auf den Boden nieder und flog ihm voran, dem Walde zu.