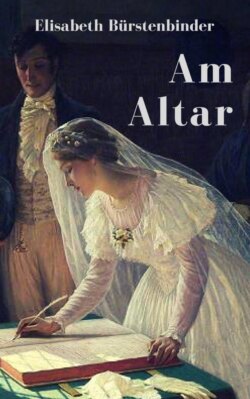Читать книгу Am Altar - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление[37] Die große, aus mehreren nebeneinanderliegenden Gütern bestehende Herrschaft Dobra war fast ein Jahrhundert lang in den Händen einer alten, reichen Adelsfamilie gewesen. Aber der Reichthum hatte mit der Zeit mehr und mehr abgenommen, und endlich war der letzte Rest desselben durch schlechte Bewirthschaftung und unsinnige Verschwendung, die, wie das meist zu geschehen pflegt, mit äußeren Unglücksfällen Hand in Hand gingen, dahingeschmolzen. Der letzte Graf Seltenow vermochte die über und über verschuldeten Besitzungen nicht mehr zu halten, und da bei dem notorisch schlechten Zustande derselben und den Anforderungen der Gläubiger, die sofortige Deckung verlangten, sich lange Zeit hindurch kein Käufer fand, so gelangten sie endlich für einen Preis, welcher allerdings gleichbedeutend mit dem Ruin des Grafen war, in die Hände eines Fremden, der wie vom Himmel geschneit plötzlich mitten unter die Großgrundbesitzer des Landes fiel, die in dieser Gegend ausschließlich aus dem hohen Adel und der Geistlichkeit bestanden.
Man wußte von diesem Günther eigentlich nichts weiter, als daß er bürgerlich und protestantisch sei; aber diese beiden Eigenschaften waren hinreichend für die gesammte Nachbarschaft, um sofort Front gegen ihn zu machen. Er ward als nicht umgangsfähig erachtet, und man beschloß, ihm dies bei der ersten Gelegenheit ein für alle Mal fühlbar zu machen.
Leider blieb diese so sicher erwartete Gelegenheit gänzlich aus, denn der neue Besitzer unternahm auch nicht das Geringste, was einem Annäherungsversuche ähnlich sah. Er machte weder die üblichen Besuche, noch suchte er überhaupt Umgang, ignorirte vielmehr die ganze vornehme Nachbarschaft so vollständig und beharrlich, daß diese ganz folgerichtig anfing, sich jetzt mit ihm zu beschäftigen, und in der That bot Dobra ihr Anlaß genug dazu, denn die neuen Schöpfungen wuchsen dort in nie geahnter Schnelle und Großartigkeit förmlich aus der Erde hervor. Der neue Gutsherr entwickelte eine so rastlose Thätigkeit, einen so riesigen Unternehmungsgeist und verfügte dabei augenscheinlich über so bedeutende Geldmittel, daß das anfängliche Achselzucken sich allmählich in Neugierde, dann in Staunen und zuletzt in Bewunderung verwandelte. Dazu kam, daß die ganz neue Art der Bewirthschaftung in dem Boden und den Wäldern Dobras Reichthümer zu Tage förderte, die Niemand dort geahnt und folglich auch Niemand nutzbar gemacht hatte; kurz, noch war kein Jahr vergangen, da hatte sich die Sachlage total verändert und es konnte den Gütern, denen man achselzuckend auch den Ruin des jetzigen Besitzers prophezeit, eine bedeutende Zukunft nicht abgesprochen werden.
Günther hatte in der That Recht, wenn er seine Güter „eingekeilt zwischen Clerus und Aristokratie“ nannte: das Gebiet des Stiftes einerseits und das von Schloß Rhaneck andererseits grenzten unmittelbar daran, allerdings die vornehmste Nachbarschaft der ganzen Umgegend, denn die beiden Grafen, welche den Namen Rhaneck trugen, der Prälat und der jetzige Majoratsherr, nahmen dort unbestritten den ersten Rang ein. Es war ein altes, reiches und mächtiges Geschlecht, dem sie entstammten, und es hatte sich, im Gegensatz zu manchen anderen Standesgenossen, die in der Neuzeit und an ihr zu Grunde gingen, diese Macht und diesen Reichthum zu bewahren gewußt, Dank einem alten Familiengesetz, das die Heirathen der jedesmaligen Stammhalter in einer Weise vorschrieb und regelte, die den Glanz des Hauses, das zu vertreten sie berufen waren, nur noch mehr hob und befestigte. Auch Graf Ottfried hatte sich diesem Herkommen gefügt, oder fügen müssen, bei seiner Vermählung, die ziemlich spät erfolgte. Als jüngster Sohn des Hauses hatte er keinen Anspruch auf die Familiengüter und stand als Officier im Dienste eines anderen Staates, als der plötzliche und unerwartete Tod seines ältesten Bruders – der zweite war von Kindheit an der Kirche geweiht und hatte bereits die Klostergelübde abgelegt – ihn zum Majoratsherrn machte. Kurze Zeit darauf heirathete er und zwar eine der reichsten und vornehmsten Erbinnen des Landes. Es war eine Convenienzehe, die, von beiden Seiten ohne Neigung und ohne Widerwillen geschlossen, beide gleich kalt ließ, aber über etwaige Differenzen half die vornehme Art zu leben hinweg. Man erwies sich vor der Welt die nöthigen Rücksichten, im Uebrigen ging ein jedes von den Gatten seinen eigenen Weg, und man war und blieb sich fremd, ohne jemals einander nahe zu kommen. Von mehreren Kindern, die alle im zarten Alter starben, war nur eins übrig geblieben, der junge Graf Ottfried, der als dereinstiger Majoratsherr und Erbe von Rhaneck schon jetzt eine bedeutende Rolle spielte und gegenwärtig als Officier in der Residenz stand, wo auch sein Vater, der längst aus dem fremden Dienst in den seines eigenen Souverains übergetreten war, eine hervorragende und einflußreiche militärische Stellung einnahm.
Letzteres war auch der Grund, weshalb die gräfliche Familie den größten Theil des Jahres in der Residenz zubrachte, Rhaneck [38] wurde nur in den Sommermonaten benutzt. Es war eine jener malerischen, aber für die Entfaltung eines großen und glänzenden Haushaltes ziemlich unbequemen alten Burgen, an die man Jahre des Baues und Hunderttausende an Kosten verschwendet hatte, um sie möglichst historisch zu restauriren, und damit ein romantisches Stück Mittelalter mitten in die Neuzeit zu versetzen. Doch der Graf liebte es als das Stammschloß seiner Familie, vielleicht auch wegen der unmittelbaren Nachbarschaft seines Bruders, und so war er denn auch diesmal, in Begleitung seiner Gemahlin, zu dem gewöhnlichen Sommeraufenthalt hier eingetroffen, und auch der junge Graf wurde in diesen Tagen erwartet. –
Bereits waren mehrere Wochen vergangen, seit der Gutsherr von Dobra, der bisher allein dort gewohnt, seine junge Schwester hatte zu sich kommen lassen. In dem äußeren Haushalt hatte deren Ankunft wenig oder gar keine Veränderung hervorgerufen, denn so großartige Summen der neue Besitzer auch auf seine Güter verwendete, so anspruchslos zeigte er sich in Allem, was seine Person und seine nächste Umgebung betraf. Das Schloß, ein großes und trotz seiner Verwahrlosung doch in vieler Hinsicht prachtvolles Gebäude, war unter allen Dingen das letzte, was sich seiner Aufmerksamkeit erfreute. Er hatte eben nur diejenigen Räume in Stand setzen lassen, die für seine persönlichen Bedürfnisse nothwendig waren, und denen sich in letzter Zeit noch die Zimmer für seine Schwester und deren Erzieherin beigesellten; alle die übrigen Gemächer standen leer und unbewohnt, und der höchst einfache Haushalt, dem nur die nothwendigste Dienerschaft beigegeben war, ging auch nach der Ankunft der beiden Damen ganz in gewohnter Ruhe und Regelmäßigkeit seinen Gang.
In diese Ruhe und Regelmäßigkeit aber kam nun Fräulein Lucie wie ein Wirbelwind hineingefahren. Sie ließ keinen Menschen und kein Ding in Ruhe, kehrte das Unterste zu oberst und brachte mit ihren Einfällen und Neckereien oft genug das ganze Haus in Aufruhr. Noch viel zu kindisch, um sich an den Bruder oder die Erzieherin anzuschließen, fand sie im Gegentheil in den halberwachsenen Knaben des Inspectors die willkommensten Spielcameraden, und diese hoffnungsvollen Sprößlinge hatten nicht sobald die Entdeckung gemacht, daß Alles, was die junge Dame anstiftete, ungestraft passirte, als sie ihr nach Kräften dabei halfen. Jetzt verging kein Tag, an dem nicht Diesem oder Jenem im Hause irgend ein Possen gespielt ward, dessen Urheber sich wohl errathen, aber niemals erwischen ließ, und Letzteres um so weniger, als gewöhnlich die gesammte Haus- und Hofdienerschaft, deren erklärter Liebling Lucie gleich vom ersten Tage an geworden war, mit im Complot steckte. Man trug das junge Fräulein geradezu auf Händen; und obgleich Niemand vor ihren Koboldstreichen sicher war, und ein Jeder gewärtig sein mußte, daß morgen die Reihe an ihn kommen werde: wo die braunen Locken flatterten und die blauen Augen strahlten, da war auch Sonnenschein und es gab Niemand in ganz Dobra, der es vermocht hätte, diesem Sonnenschein gegenüber auch nur eine Stunde lang ernstlich zu grollen.
Günther erfuhr in Folge dessen nur selten etwas von solchen Vorgängen. Durch seine Thätigkeit meist draußen festgehalten, fand er in der That nicht viel Zeit, sich um das Haus und um seine Schwester zu kümmern. Im Ganzen behandelte er sie mit ziemlicher Nachsicht, wie ein verzogenes Kind, dessen Launen und Thorheiten man hingehen läßt, so lange sie unschädlich sind, und denen man mit einem einfachen Verbot ein Ende macht, sobald sie anfangen, unbequem zu werden. Er ließ Lucie meistentheils gewähren, sobald es sich aber um irgend eine ernste Angelegenheit handelte, schob er sie ohne Weiteres als gänzlich überflüssig und unzurechnungsfähig bei Seite. Freilich wurde das Selbstgefühl der jungen Dame dadurch auf’s Tiefste verletzt, aber sie hatte bereits hinreichend erfahren, daß bei dem Bruder mit Bitten und Schmeicheln ebensowenig auszurichten war, wie mit Schmollen und Weinen, und diese Erfahrung war denn auch die einzige Rücksicht, die ihrem Uebermuth einen heilsamen Zügel auferlegte, der sich, sobald Bernhard nur den Rücken wandte, Alles erlaubte und auch Alles erlauben durfte. Dieser Mann mit seinem scheinbar so nichtssagenden Gesicht und seiner so gleichgültigen Ruhe, die nichts überstürzte, aber auch nichts verzögerte, und stets zur rechten Zeit und am rechten Orte eingriff, wußte, wie er ganz Dobra in Respect hielt, auch seine junge Schwester in Respect zu halten, und letzteres war nach der unumstößlichen Meinung von deren Erzieherin jedenfalls das Schwerere von beiden.
„Nein, Lucie, das geht denn doch etwas zu weit! Ich sollte meinen, wir hätten Alle schon genug von Ihren Koboldstreichen zu leiden gehabt, daß Sie nun endlich Ruhe geben könnten, aber dieser letzte übersteigt wirklich alle Begriffe!“
Die Erzieherin, welche diese Strafpredigt hielt, während sie in aller Majestät einer zürnenden Gouvernante vor ihrem Zöglinge stand, gehörte nun allerdings nicht zu jener Kategorie, die Lucie in ihrem Protest dem Bruder gegenüber so treffend gekennzeichnet hatte. Es bedurfte nur eines einzigen Blickes auf diese resolute Dame, um sie von dem Vorwurf der Nervosität ein für alle Mal frei zu sprechen, und wer die energischen Bewegungen sah, mit denen sie ihre Rede begleitete, kam auch nicht mehr in Versuchung, sie für steif zu halten. Fräulein Reich mochte bereits im Anfange der Dreißig stehen, konnte aber dessen ungeachtet noch für hübsch gelten. Groß und kräftig gebaut, mit starken, aber nicht unangenehmen Zügen, blond und helläugig war sie jedenfalls eine äußerst stattliche Erscheinung, und obgleich ihre Stimme jetzt in allen Tonarten des Zornes grollte, und sie dabei wie aus einem Donnergewölk auf ihre kleine zarte Pflegebefohlene herabblickte, machte dieser Zorn doch einen mehr komischen als widerwärtigen Eindruck, man konnte sich dabei des unwillkürlichen Gedankens nicht erwehren, daß es nicht so schlimm gemeint sei, als es aussah.
Fräulein Lucie saß in der Laube und zeichnete; sie hatte den Kopf tief auf die Arbeit herabgebeugt, ob aus Zerknirschung über die Strafpredigt, leider nicht die erste, die ihr gehalten ward, oder um das verrätherische Zucken ihrer Mundwinkel zu verbergen, ließ sich nicht entscheiden, jedenfalls zeichnete sie sehr eifrig und beachtete ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit nicht im Geringsten das Bitten und Schmeicheln ihres kleinen Hundes, der neben ihr auf der Bank lag und große Lust zum Spielen zeigte.
„Es ist himmelschreiend!“ eiferte die Gouvernante weiter. „Da hat die arme, alte Person, die Wirthschafterin, unglücklicherweise verrathen, daß sie abergläubisch ist, und seitdem spukt es allabendlich im ganzen Schlosse, auf allen dunklen Gängen und finsteren Corridoren, so daß Niemand von den Leuten sich mehr aus der Thür wagt und Frau Schwast beinahe krank geworden ist vor Schreck. Sie werden noch einmal ein Unglück anrichten mit ihren heillosen Einfällen!“
„Es spukt im Schlosse?“ fragte Lucie, indem sie den Kopf hob und ihre Gouvernante mit der unschuldigsten Miene von der Welt anblickte. „O, das ist ja merkwürdig!“
„Merkwürdig? Abscheulich ist es! Denken Sie, ich wüßte nicht, wer die gottlosen Jungen des Inspectors wieder zu der Gespensterkomödie angestiftet hat und wer eigentlich den ganzen Geisterapparat erfindet und leitet? Aber ich werde Herrn Günther die Sache vortragen, und dann gnade Gott den Gespenstern, wenn ihm eins davon in die Hände fällt!“
„Ach nein, sagen Sie nur Bernhard nichts davon!“ rief Lucie erschreckt; „es soll nicht mehr spuken, gewiß nicht mehr!“
Fräulein Reich schüttelte grollend das Haupt. „Also läßt man sich doch endlich zum Geständniß herbei. Sie sollten sich schämen, Lucie, so mit den Knaben herumzutollen, während Sie doch schon eine erwachsene junge Dame sein wollen, aber Ihnen steckt die Kinderei noch ganz und gar im Kopfe. Das ist überall und nirgends, das dreht und wendet sich mir unter den Händen mit Lachen und Schmeicheln, und während ich Sie wegen des einen Postens zur Rede stelle, sinnen Sie schon wieder auf einen neuen, der sicher hinter meinem Rücken ausgeführt wird. Das ganze Haus hilft Ihnen ja leider Gottes dabei, Alles haben Sie mit Ihren Thorheiten angesteckt, Alles ist im Complot mit Ihnen, man müßte hundert Augen und Hände haben, um solch einer Quecksilbernatur Herr zu werden. Sie werden mir das Zeugniß geben, daß ich nicht zu den Schwachen und Nachsichtigen gehöre, ich hatte auf der Schule in N. eine ganze Classe widerspenstiger, lärmender Schüler in Ordnung zu halten, und ich habe sie in Ordnung gehalten, aber mit einem solchen Wildfang wie Sie fertig zu werden, das versuche eine Andere – ich gebe es auf!“
„Was geben Sie auf?“ fragte plötzlich Günther’s Stimme, der unbemerkt den Gang heraufgekommen war, und jetzt in die Laube trat. Lucie fuhr von ihrem Sitze empor und sprang ihm entgegen, ohne sich im Mindesten darum zu kümmern, daß sie dabei die Zeichenmappe vom Tische herabriß und die Blätter nach allen Richtungen hin auseinanderflatterten.
„Bernhard, vor einer Stunde war ein Bote des Baron [39] Brankow hier, der Dir persönlich einen Brief übergeben wollte. Wir wußten nicht, wohin Du geritten warst. Hat er Dich gefunden?“
Günther nahm ruhig seine Schwester beim Arm und drehte sie nach dem Tische herum. „Willst Du nicht vor allen Dingen die. Güte haben, Deine Zeichnungen wieder aufzunehmen? – Was wollten Sie ein für alle Mal aufgeben, Fräulein Reich?“
Das Fräulein schien in dem heftigen Erguß von vorhin ihren Vorrath an Zorn so ziemlich erschöpft zu haben, und zum Ueberfluß stahl sich nun auch Lucie, die eiligst die umhergestreuten Blätter aufgerafft hatte, an ihre Seite. Sie legte schmeichelnd den linken Arm um ihre Gouvernante und lehnte den Kopf an deren Schulter, das Fräulein machte zwar einen unwilligen Versuch, sich zu befreien, aber es blieb bei dem Versuche, denn die kleine Hand hielt fest und die Antwort fand demzufolge auch in bedeutend herabgestimmtem Tone statt.
„Ich habe Lucien wieder einmal eine Vorlesung halten müssen, sie ist leider unverbesserlich!“
„So, nun da werde ich wohl einschreiten müssen!“ meinte Günther, dem das Manöver seiner Schwester nicht entgangen war. „Ich wollte Sie ohnedies bitten, mich auf einem Gang durch den Garten zu begleiten, da ich mit Ihnen etwas zu besprechen habe; Lucie mag inzwischen weiter zeichnen.“
Die kleine Hand lag noch immer schmeichelnd auf dem Arme, und jetzt unterstützten auch die Augen sehr beredt jene stumme Bitte; das Fräulein wandte denn auch zwar mit einer ärgerlichen Bewegung den Kopf seitwärts, aber aller Groll war aus ihren Zügen verschwunden, und triumphirend und gänzlich unbesorgt über den Ausgang des Gesprächs kehrte Lucie zu ihrem Sitz zurück, – weiter zu zeichnen. Sobald ihr die Beiden nämlich aus dem Gesicht waren, warf sie den Stift bei Seite, hob ihren kleinen Hund auf den Tisch, setzte ihn mitten unter die Zeichnungen und begann ihn zu necken, mit dem ersten Besten, was ihr in die Hände fiel, in diesem Falle mit dem Sonnenschirm ihrer Gouvernante, der unglücklicherweise neben ihr auf der Bank lag, und den sie nun ganz rücksichtslos den Pfoten und Zähnen des Thieres preisgab.
Die Besitzerin des mißhandelten Sonnenschirms schritt mittlerweile an Günther’s Seite durch den Garten. Seit seinem Erscheinen war in dem Wesen des Fräuleins eine merkwürdige Veränderung vorgegangen, sie zeigte sich nicht im mindesten geneigt, sich auf die vorhin so eifrig herbeigewünschte Autorität zu stützen, im Gegentheil, sie setzte sich ihr gegenüber in eine Art Kriegsbereitschaft, augenscheinlich entschlossen, ihren eben noch so hart gescholtenen Zögling auf Tod und Leben zu vertheidigen. Ob Günther etwas davon ahnte, oder ob er die Taktik des Fräuleins bereits kannte, genug, er ließ den eigentlichen Hauptgegenstand des Gesprächs vorläufig fallen.
„Ich habe soeben einen Brief des Baron Brankow erhalten,“ begann er ruhig, „eine Einladung zu dem morgen auf seinem Gute stattfindenden Feste. Die Sache kommt mir ebenso überraschend als unangenehm, da ich dem Baron weder einen Besuch gemacht, noch mich überhaupt jemals um ihn gekümmert habe. Man wird wohl seine Gründe haben, indessen die Zuvorkommenheit ist, äußerlich wenigstens, eine so auffallende, daß sie sich nicht zurückweisen läßt. Es würde aussehen wie eine Flucht vor der Nachbarschaft, und in den Verdacht möchte ich mich denn doch nicht bringen. Ich habe also angenommen.“
Das Fräulein hatte schweigend und sichtbar befremdet zugehört. „Und Lucie?“ fragte sie endlich.
„Lucie ist gleichfalls eingeladen, ich hatte auch die Absicht, sie mitzunehmen, da sie Ihnen aber Grund zur Klage giebt, so wird sie wohl zu Haus bleiben müssen.“
„Warum nicht gar!“ fiel das Fräulein halb erschreckt, halb entrüstet ein. „Sie wollen sie doch nicht etwa gar strafen, einer Kinderei wegen, um deren willen ich sie schon hinreichend ausgescholten habe? Das arme Kind!“ hier traf ein diesmal ganz und gar entrüsteter Blick den Gutsherrn, „das arme Kind sitzt tagaus tagein hier in Dobra, ohne passenden Umgang, ohne Altersgenossen; ist es da ein Wunder, wenn es auf allerlei Thorheiten verfällt? Und nun wollen Sie ihm auch noch das einzige Vergnügen rauben, das sich wirklich einmal darbietet! Lucie weint den halben Tag lang, wenn sie es erfährt, und das –“
„Können Sie nicht mit ansehen!“ vollendete Günther spöttisch. „Mir scheint, Fräulein Reich, wenn Sie auch mit Lucie nicht fertig werden können, Lucie ist längst mit Ihnen fertig geworden, wie überhaupt mit ganz Dobra.“
„Sie ausgenommen!“ ergänzte das Fräulein, aber wenn sie mit den Worten ein Compliment beabsichtigte, so verdarb sie Alles wieder durch den Nachsatz, der ihr im vollen Aerger herausfuhr. „Mit Ihnen ist überhaupt nicht fertig zu werden!“
„Meinen Sie?“ fragte Günther sehr gelassen, indem er die Arme kreuzte und sie mit unzerstörbarer Ruhe anblickte.
„Ja, das meine ich!“ erklärte Fräulein Reich, noch mehr gereizt durch diesen Gleichmuth. „Ich nehme mir die Freiheit, zu behaupten, daß ich denn doch zehn Mal lieber mit Luciens Quecksilbernatur zu thun haben will, als mit Ihrer entsetzlichen Gelassenheit, die durch nichts aus der Fassung zu bringen ist, an der Alles abgleitet, was einen vernünftigen Menschen zur Verzweiflung treiben könnte, und vor der gleichwohl ganz Dobra zittert!“
„Sie ausgenommen!“ parodirte Günther, der den ganzen Ausfall hingenommen hatte, ohne auch nur eine Miene zu verziehen.
„Ich?“ Das Fräulein hob sehr entschieden den Kopf; „ich habe in meinem ganzen Leben überhaupt noch vor Niemand gezittert, und vor Ihnen –“
„Am allerwenigsten! Bitte, scheuen Sie sich nicht, den Nachsatz auszusprechen, ich lese ihn doch deutlich genug aus Ihrem Gesicht.“
Fräulein Reich wandte sich ärgerlich ab, augenscheinlich bemüht, ihr heißblütiges Temperament niederzukämpfen.
„Ich habe es Ihnen vorher gesagt, als Sie mich von N. herberiefen,“ sagte sie kurz, „wir würden uns hier ebenso wenig vertragen, uns genau ebenso oft zanken, wie einst in unserem Dorfe, wenn Sie vom Forsthaus in das Pfarrhaus kamen.“
Günther zeichnete gleichgültig mit seiner Reitpeitsche Figuren in den Sand. „Ja, richtig! Sie konnten niemals Ruhe halten!“
„Bitte um Entschuldigung, Sie waren es, der nie Ruhe gab, bis der Zank im vollen Gange war; ich hatte genug zu thun, mich nur zu wehren.“
„Nun, was das Wehren anbetrifft –“ meinte Günther trocken. „Franziska Reich verstand es von jeher, dem ‚unerträglichen Bernhard‘ die Spitze zu bieten.“
Das Antlitz des Fräuleins überflog eine leichte Röthe bei dieser in früheren Tagen wahrscheinlich oft ausgesprochenen Reminiscenz aus der Jugendzeit. „Bernhard Günther ist inzwischen im Leben emporgekommen!“ sagte sie plötzlich ernst, aber ohne die geringste Bitterkeit, „und Franziska Reich ist die arme Pfarrerstochter geblieben, die sich als Gouvernante ihr Brod verdienen muß. Wir stehen nicht mehr gleich auf gleich wie damals.“
„Und doch lesen Sie Mir den Text genau so wie damals.“
„Werden Sie Lucie mitnehmen?“ fragte das Fräulein kurz abbrechend.
Günther schien etwas verstimmt durch dies entschiedene Vermeiden des von ihm angeregten Themas. „Auf Ihre Verantwortung!“ sagte er ebenso kurz und wandte sich zum Gehen.
„Auf meine Verantwortung!“ bestätigte das Fräulein, indem sie ihm gleichfalls ohne alle Ceremonien den Rücken wandte und nach der Laube zurückkehrte, wo sie ihren Zögling noch im besten Spiel mit dem Hunde, und ihren Sonnenschirm unter den Zähnen des letzteren fand.
Die empörte Dame schlug die Hände über dem Kopf zusammen, sie warf den Hund vom Tische, setzte sich energisch in Besitz ihres Eigenthums und begann Lucien eine erneute Strafrede zu halten, worin sie ihr zu Gemüth führte, daß sie ganz und gar nicht der Vergünstigung werth sei, die man ihr eben noch ausgewirkt, aber Lucie ließ ihr keine Zeit zu endigen. Sobald sie erfuhr, um was es sich handelte, sprang sie mit einem lauten Schrei des Entzückens empor und überfiel die Erzieherin förmlich mit so ungestümen Liebkosungen, daß der kleine Hund, der mit jener ohnehin nicht auf besonders freundschaftlichem Fuße stand, auf die Idee gerieth, es gelte hier einen Angriff, und in pflichtschuldiger Unterstützung seiner jungen Herrin laut bellend nach dem Kleide des Fräuleins fuhr.
„Um Himmelswillen!“ rief diese empört, „wollen Sie mich von oben todtdrücken und von unten zerreißen lassen? Bringen Sie das kleine Ungethüm zur Ruhe und lassen Sie mich los, oder ich rufe um Hülfe!“
Lachend beruhigte Lucie den Hund, aber die Zeichenstunde fortzusetzen, erwies sich als unmöglich. Das ganze Köpfchen der [40] jungen Dame wirbelte bei dem Gedanken an diese erste große Gesellschaft, die sie mitmachen sollte, zuerst kamen Erkundigungen über das Wo, Wie und Wann, dann wurde die Toilettenfrage erörtert – die Erzieherin sah, daß heute absolut nichts mehr zu erreichen war, sie gab den Unterricht auf.
„Lucie,“ sagte sie feierlich, „es giebt zwei Dinge auf der Welt, die ich noch zu erleben wünschte, aber leider liegen sie alle beide im Bereiche der Unmöglichkeit. Ich möchte den Menschen sehen, der im Stande ist, Sie zum Ernst und zur Vernunft zu bringen, und ich möchte das Wesen kennen lernen, das fähig wäre, Ihren Bruder auch nur um ein Haar breit von dem abzubringen, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat zu thun. Ihr Geschwister seid zwei Gegensätze, die nur eine Aehnlichkeit miteinander haben – es ist mit beiden nichts anzufangen!“
Das Fest, mit welchem Baron Brankow seinen Namenstag feierte, hatte bereits seinen Anfang genommen. Das dortige Herrenhaus konnte nun freilich nicht im Entferntesten mit dem großartigen Aufwande, der in der Prälatur des Stifts, oder der schweren alterthümlichen Pracht, die in Schloß Rhaneck herrschte, den Vergleich aushalten, es war eben nur der einfache Sitz eines Landedelmannes aus gutem alten Hause; aber dies Haus war reich und gastfrei, und hatte sich dadurch zu einer Art von Mittelpunkt für die Geselligkeit der Umgegend gemacht. Man kam gern zu diesen Festen, und auch heute war die zahlreich geladene Gesellschaft ebenso zahlreich erschienen. Baron Brankow, ein kleiner freundlicher Herr, gutmüthig, eifrig und herzlich, ohne besondere aristokratische Würde, aber dafür mit allen Eigenschaften eines guten Wirthes begabt, empfing seine Gäste und geleitete soeben den Prälaten, der vor wenig Minuten angekommen war, zu einem Sessel am oberen Ende des Saales.
Der Abt des ersten und bedeutendsten Stiftes im Lande, das durch seinen Reichthum und seinen Einfluß eine fast fürstliche Stellung einnahm, pflegte mit seinen Besuchen sehr sparsam zu sein. Er erschien nur da, wo er wirklich auszeichnen wollte, und es gab nicht Viele, die sich rühmen konnten, ihn als Gast bei sich gesehen zu haben. Die Haltung des Barons und seiner Familie zeigte denn auch, daß sie diese Auszeichnung im vollsten Maße zu würdigen wußten, und die ganze übrige Gesellschaft empfing den hochgestellten Geistlichen mit der ihm gebührenden ehrfurchtsvollen Aufmerksamkeit.
Unmittelbar hinter seinem Oberen schritt Pater Benedict. Der Prälat fuhr niemals allein zu solchen Festen, er pflegte stets einen der Stiftsherren mit sich zu nehmen, die sich seiner besondern Gunst erfreuten, Es schien aber nicht, als ob der junge Priester den Vorzug zu würdigen wisse, der ihm zu Theil geworden, sein Antlitz trug den gewöhnlichen Ausdruck kalter Verschlossenheit und finster, fast feindselig blickte er auf das festliche Wogen und Treiben.
Dies Wogen und Treiben hatte übrigens heute nicht seine gewöhnliche, sich immer gleich bleibende Physiognomie, es lag eine leichte Aufregung darin, eine gewisse Unruhe, die bald genug auffiel. Man blickte oft nach der Thür, man flüsterte in Gruppen zusammen, irgend etwas Besonderes schien erwartet zu werden, irgend etwas Ungewöhnliches im Werke zu sein, und doch war dies nicht das Erscheinen des Grafen Rhaneck, der unmittelbar nach seinem Bruder eintrat, seine Gemahlin führend, während der junge Graf Ottfried den Beiden folgte. Zwar gab sich auch bei ihrer Ankunft die gleiche Bewegung kund, wie beim Eintritt des Prälaten; Rhaneck’s Stellung in der Residenz war eine zu bedeutende, um ihn nicht hier zu einer Autorität ersten Ranges zu machen, ganz abgesehen davon, daß er der reichste und vornehmste unter all’ den Nachbarn war; man empfing auch ihn mit der gleichen Ehrerbietung, wie seinen Bruder.
Die Gräfin war eine jener Erscheinungen, wie sie häufig genug vorkommen, vornehm, unbedeutend, langweilig, jedenfalls nicht die Frau, die einen Mann wie ihren Gemahl zu fesseln verstand. Ihr Sohn Ottfried trug unverkennbar die Rhaneck’schen Familienzüge, er glich äußerlich sehr dem Vater, aber ihm fehlte die feurige Lebhaftigkeit desselben, ebenso sehr wie die energische Ruhe des Oheims, sein ganzes Wesen verrieth eine Blasirtheit, in der alle anderen, vielleicht besseren Eigenschaften zu Grunde gegangen waren. Der noch so junge Mann hatte augenscheinlich schon alle Freuden des Lebens ausgekostet und war ihrer überdrüssig geworden, da war auch kein Hauch mehr von jener Kraft und jenem Feuer, das der alte Graf sich bis in seine späteren Jahre hinein bewahrt hatte, der schmächtige junge Officier mit den schlaffen Zügen und den matten Augen nahm sich neben der stattlichen Erscheinung des Vaters ziemlich unvortheilhaft aus.
Rhaneck hatte kaum den Bruder begrüßt und mit der Frau vom Hause gesprochen, als er sich auch bereits von allen Seiten in Anspruch genommen sah. Auch Ottfried befand sich bald genug in einem Kreise von Altersgenossen, die ihn mit Fragen und Erkundigungen nach der Residenz bestürmten. Die Gräfin dagegen saß im Kreise der Damen, ließ ihre reiche Toilette glänzen bewegte den Fächer langsam auf und nieder, und ließ nur sehr selten eine Bemerkung laut werden, sie hatte das Möglichste durch ihr Erscheinen hier gethan, und die Gesellschaft konnte und mußte es sich an dieser Ehre genug sein lassen.
„Aber, bester Brankow“ – der Graf hielt den Baron, der an ihm vorüber wollte, auf einen Moment lang fest – „sagen Sie mir nur, was ist das heute mit Ihren Gästen? Das ist eine Unruhe, eine Zerstreutheit überall! Erwartet man Jemand, oder haben Sie uns irgend eine Ueberraschung aufbehalten?“
Der Baron lächelte etwas gezwungen. „Beides vielleicht! Aber dieser Herr Günther scheint den Vornehmen spielen zu wollen, er läßt sich lange erwarten!“
Der Graf fuhr auf, als habe er unversehens einen Schlag erhalten.
„Wer?“
„Nun, unser Nachbar von Dobra! Sie wissen doch, daß er eingeladen ist?“
Graf Rhaneck trat einen Schritt zurück und sah den Baron von oben bis unten an. Die verbindliche Artigkeit in seinem Gesichte machte einem wahrhaft eisigen Ausdruck Platz.
„Man muß gestehen, Brankow, Sie muthen Ihren Gästen sehr viel zu!“ sagte er kalt.
„Aber mein Gott!“ rief der Baron befremdet, „sind Sie denn davon nicht unterrichtet? Die Einladung geschah ja doch auf speziellen Wunsch des hochwürdigsten Herrn Prälaten.“
„Meines Bruders?“ In der Stimme des Grafen mischten sich Unglaube und Zorn miteinander.
„Gewiß! Ich meinerseits hätte sicher nicht die Initiative in einer so delicaten Angelegenheit ergriffen; aber der Herr Prälat schien so großen Werth auf die Erfüllung seines Wunsches zu legen, machte sie so zu sagen zur Bedingung seines Erscheinens, daß ich nicht umhin konnte, diesen, ich gestehe es, mir sehr unangenehmen Schritt zu thun.“
Der Graf stand starr wie eine Bildsäule; als eben in diesem Augenblicke Brankow von anderer Seile her angesprochen ward, drehte er sich kurz um, ging auf seinen Bruder zu und zog ihn hastig mit sich in eine Fensternische.
„Weißt Du, daß man diesen Günther von Dobra heute hier erwartet?“
„Allerdings!“ Die Antwort des Prälaten klang sehr bestimmt, er hatte den Sturm kommen sehen.
„Und ist es wahr, was Brankow behauptet, daß die Einladung auf Deine Veranlassung, auf Deinen speciellen Wunsch geschehen ist?“
„Auch das ist wahr.“
„Nun, das begreife ein Anderer, mir fehlt jedes Verständniß dafür!“ rief der Graf empört und schlug leise, aber heftig mit seinem Fuße den Boden, daß die Sporen klirrten.
Der Prälat zuckte leicht die Achseln. „Du weißt, daß ich meine Gründe habe, den Mann kennen zu lernen. Ich muß ihn Auge im Auge sehen, muß ein Urtheil über seine Persönlichkeit haben, um zu wissen, was von ihm zu erwarten ist. Mir in meiner Stellung war jede Annäherung unmöglich; ich konnte ihm nur auf neutralem Boden begegnen, also mußte sich Brankow dazu hergeben.“
„Du ordnest wie gewöhnlich Deinen ‚höheren Gründen‘ alle und jede Rücksicht unter“, sagte der Graf bitter, „und scheinst ganz zu vergessen, daß Du dem Menschen mit dieser Einladung den Weg in unsere Kreise bahnst, die ihm bisher verschlossen waren, daß Du der ganzen Nachbarschaft ein höchst gefährliches Beispiel, ein unbegreifliches Aergerniß giebst.“
Ein kaum bemerkbares Spottlächeln spielte um die Lippen des Prälaten, während sein Blick die Gesellschaft überflog.