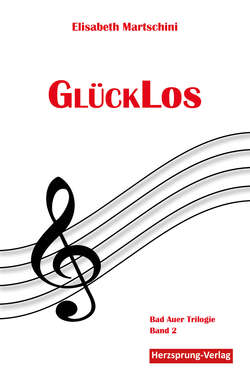Читать книгу GlückLos - Elisabeth Martschini - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unwissenheit nach den Ferien
Оглавление„Hast du ihn zuerst geküsst oder er dich?“
„Ich kann mich nicht erinnern.“ Matti schüttelte ihre blonde Mähne, die nur von einem schmalen, um den Kopf laufenden Reif festgehalten wurde. Dieser verlieh dem jungen Mädchen entfernt das Aussehen eines Engels, wobei der heilige Schein eher trügerisch war. Mattis Eltern und wohl auch einige ihrer Lehrer hätten sie alles andere als einen Engel genannt. Und selbst Johanna hätte dieser Bezeichnung sicherlich widersprochen, obwohl sie sich in den Ferien leidlich darum bemüht hatte, in Matti, wenn schon keinen Engel, so doch eine Freundin zu sehen.
Freundin, aber nicht beste Freundin. Johannas beste Freundin war immer noch Erika Hofbauer, obwohl sie dieser während der Sommerferien gar nicht so oft begegnet war. Irgendetwas war anders geworden. Erika war anders geworden, sie hatte sich verändert. Daran bestand für Johanna kein Zweifel. Denn wer nicht einmal im Sommer regelmäßig beim Schwimmen anzutreffen war, hatte etwas Seltsames an sich. Und da Erika früher nicht seltsam gewesen oder Johanna wenigstens nicht so vorgekommen war, musste sie sich zwangsläufig verändert haben. Bestimmt sogar. Nur warum?
Während sie Matti nur noch mit halbem Ohr zuhörte, grübelte Johanna über Erika nach. Wobei sich dem Beobachter oder Leser eigentlich die Frage aufdrängen müsste, wie man mit einem halben Ohr zuhört. Nicht, dass das körperlich unmöglich gewesen wäre. Niki Lauda zum Beispiel hörte ja auch mit halben Ohren zu oder zumindest hörte er damit, seine eigentliche Stärke allerdings lag selbstredend eher im Sprechen, sofern man es mit Grammatik und Wortschatz nicht so genau nahm.
Aber Johanna war, daran ließ der Augenschein keinen Zweifel aufkommen, nicht Niki Lauda. Soll heißen: Obwohl sie Matti nur mit halbem Ohr lauschte, verfügte sie körperlich betrachtet sehr wohl über zwei vollständige, wenngleich durchlöcherte und mit Steckern, nein, Piercings verzierte Ohren. Weshalb sich das halbohrige Zuhören nur auf die Funktion dieser Organe oder besser auf ihre Nutzung beziehen konnte.
Während nämlich ihre körperlich vollständigen Ohren nur zur Hälfte dazu genutzt wurden, Mattis Worte aufzunehmen, richtete sich Johannas Blick an der engelsblonden Freundin vorbei auf einen Punkt in einiger Entfernung. Auf einen Punkt, der immer näher kam, Gestalt annahm und schließlich einen guten Meter hinter Matti stehen blieb.
„Er ist ja voll süß, aber ich ...“
Jetzt nahm Johanna Mattis Gerede nicht einmal mehr mit halbem Ohr wahr. Ihr Interesse wandte sich – wenn es denn überhaupt je bei der Geschichte gewesen war – ausschließlich Erika zu, die von Matti noch nicht bemerkt worden war und die Johanna fragend ansah. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es war Johanna, die Erika fragend ansah. Erika ihrerseits schaute vielmehr entsetzt und aufgewühlt aus. Matti hätte ihren Gesichtsausdruck wahrscheinlich als „total geflasht“ bezeichnet. Da diese am Hinterkopf aber keine Augen hatte, konnte sie Erika selbstverständlich nicht sehen. Dennoch merkte nun endlich auch sie, dass sie zwar nicht gegen eine Wand, wohl aber zu einer an ihrer nervenzerreißenden Liebesgeschichte herzlich wenig interessierten Johanna sprach.
Matti drehte sich um, sodass Erika jetzt zwei Mädchen anblickten, was zwar die grammatikalische Frage nach dem Subjekt des Ansehens löste, nicht aber den Grund für Erikas Aussehen erklärte.
„Was ist los?“, fragte Johanna deshalb.
„Die schwarze Fahne“, erwiderte Erika, brach ab und holte Luft, sprach jedoch nicht weiter.
„Was ist damit?“, wollte Johanna wissen. „Hat am Ende der alte Dippelbauer den Geist aufgegeben?“
Dippelbauer war seit unvordenklichen Zeiten der Direktor des Bad Auer Gymnasiums gewesen. Generationen von Schülern und Lehrern hatten nur ihn als Oberhaupt der Schule kennengelernt. Sein Alter war beinahe schon so legendär wie sein diesem trotzendes Ausharren auf seinem Posten.
Erika schüttelte den Kopf. „Nicht der Dippelbauer ... der Glück.“
Johanna sagte gar nichts, sondern riss nur die Augen auf. Mit normalem Anschauen hatte das nichts mehr zu tun.
Diejenige, die sprach, war Matti: „Pech für ihn, Glück für uns. Oder eben nicht mehr.“ Sie ließ ein Kichern hören.
Johannas weit aufgerissene Lider verengten sich zu schmalen Schlitzen, über denen sich die jugendliche Stirn in Falten legte. „Wie meinst du das?“, fragte sie sehr leise.
„Na, der Glück war doch eine echte Plage mit seinem Hippie-Gedudel. Damit geht er mir zweimal die Woche ganz gewaltig auf den Arsch – nein, ging er!“, lachte Matti.
„Aber das ist doch kein Grund, jemandem den Tod zu wünschen“, wandte Johanna ein.
„Ich habe ihm den Tod nicht gewünscht“, verteidigte sich Matti, „er ist ganz von selbst gestorben.“
„Woran eigentlich?“, fragte Johanna, die diese Diskussion in eine andere Richtung lenken wollte.
„Weiß nicht. Auf dem Partezettel steht nur unerwartet“, gab Erika mangelhaft Auskunft. Dabei konnte der Mangel an Information natürlich nicht ihr angelastet werden. Das war das Kreuz mit diesen Sterbebildern: dass auf ihnen meist nur Phrasen abgedruckt waren. In tiefer Trauer, plötzlich und unerwartet, nach langem, mit Geduld ertragenem Leiden und so weiter. Niemals starb jemand, nachdem er seine Verwandten und Bekannten, die sich in wenigen guten Momenten für Freunde hatten halten dürfen, über Jahre hinweg tyrannisiert hatte, niemals jemand, der nach dem dritten Schlaganfall wie ein nasser Sack aus allen Körperöffnungen getropft hatte, niemals jemand, der sich aufgrund von Depression und fortwährenden Kränkungen durch seine Mitmenschen aus Verzweiflung das Leben genommen hatte. Und wenn es mitunter, ganz selten einmal, den einen oder anderen solchen Fall gab, war davon doch niemals etwas auf der Parte zu lesen, durch die Erika vom unerwarteten Tod ihres Musiklehrers erfahren hatte.
„Welche Parte?“, fragte Matti.
„Hängt auf dem Gang vom Konferenztrakt“, antwortete Erika kurz angebunden und wandte sich Johanna zu. „Glaubst du, dass er krank war?“, fragte sie die Freundin. „Ich meine, in diesem Alter stirbt man doch nicht so einfach.“
„Ich weiß nicht, wie alt er war“, entgegnete Johanna, ohne damit auf Erikas Frage zu antworten.
„Bestimmt nicht alt genug, um einfach tot umzufallen“, warf Matti ein.
„Im 40. Lebensjahr“, zitierte Erika den Text auf der Parte.
„Vielleicht hat er eine Überdosis erwischt“, mutmaßte Matti, was ihr einen bösen Blick der beiden anderen Mädchen einbrachte.
„Sei nicht blöd“, meinte Johanna. „Nur weil einer hin und wieder Gras raucht ...“
„Hat er das?“, fragte Erika entgeistert.
„Weiß ich nicht. Ich meine doch nur, selbst wenn er hätte, also, deswegen muss er ja nicht gleich harte Drogen nehmen. Und ich glaube nicht, dass schon mal jemand an einer Überdosis Gras gestorben ist.“
„Wer weiß“, kicherte Matti, „vielleicht hat er vor lauter Rauch zu wenig Sauerstoff erwischt.“
„Das musst du gerade sagen, du Schrumpfhirn!“, fauchte Johanna sie an und erhob sich von der niedrigen Mauer, die den Sportplatz vom Pausenhof trennte und auf der sie mit Matti gesessen hatte, um auf den Unterrichtsbeginn zu warten. Sie legte ihren Arm um Erikas Schultern und ging mit der Freundin, der besten Freundin, davon.
Im Anschluss an den Schulgottesdienst erwartete Frau Professor Zeppezauer ihre Schüler im Klassenraum. Freilich nicht alle ihre Schüler, aber doch jenen bunten Haufen spätpubertärer Jugendlicher, den die Schulverwaltung unter 7a führte und dessen Klassenvorstand sie war.
Dass Frau Zeppezauer – den unsäglichen Professorentitel lassen wir ausnahmsweise weg, obwohl man gerade in Bad Au große Stücke auf Titel aller Art hielt, doch fügen wir als Ersatz dafür vielleicht den Vornamen, Cäcilia, hinzu, auf dass aus dem Unsäglichen eine mehr oder weniger geglückte Alliteration werde – dass also Frau Cäcilia Zeppezauer auf ihre Schüler wartete, war so natürlich nicht geplant, denn im Allgemeinen hatten die Schüler auf die Lehrer zu warten. Je länger, umso lieber, weshalb die drahtige Zeppezauer mit den leicht ergrauten Haaren bei den Schülern auf der Beliebtheitsskala auch nicht an erster Stelle rangierte, betrug ihr Zuspätkommen nach dem Läuten doch meist nur eine, maximal zwei Minuten. Ausnahmen bestätigten die Regel, wie der letzte Schultag vor den Ferien gezeigt hatte, als die 7a, die damals freilich noch die 6a gewesen war, nicht nur lange, sondern sogar vergeblich auf ihren Klassenvorstand gewartet hatte. Aber das gehörte der Vergangenheit an. Vorerst jedenfalls noch.
Am ersten Schultag nach den Ferien stand hingegen die Klassenvorständin in Warteposition, weil sich die fromme Schülerschaft offensichtlich auf dem Weg vom Gottesdienst zum Unterricht, der heute ohnehin noch nicht guten Gewissens als solcher bezeichnet werden konnte, verspätete. Freilich hätten sich jene Schüler, die ihrer offiziellen Konfession oder ihres inneren Schweinehundes wegen nicht am Gottesdienst teilgenommen hatten, pünktlich im Klassenzimmer einfinden können. Mit anderen Worten: Bis auf einen oder zwei hätte die gesamte 7a bereits hier sein und Cäcilia Zeppezauers Begrüßungsworten lauschen können.
Die immer auf Korrektheit und vorgeblich auch auf Strenge bedachte Lehrerin ärgerte sich. Dabei waren der Grund dieses Ärgers gar nicht unbedingt die Schüler oder deren frömmigkeits- beziehungsweise faulheitsbedingte Verspätung. Was Frau Zeppezauers Unwillen erregte, war vielmehr der Gottesdienst selbst. Nein, eigentlich auch nicht der Gottesdienst, denn der ließ sich genau so wenig zur Verantwortung ziehen wie irgendein Gott, dem damit gedient sein sollte. Es waren wie immer die Menschen, die die Religion für ihre Zwecke instrumentalisierten. In diesem Fall ein einziger, ganz bestimmter Mensch. Nämlich jener, der entgegen der vom alten Direktor Dippelbauer erlassenen Gottesdienstamnestie dieses Relikt aus schwarzer Vorzeit wieder eingeführt hatte.
„Wie war der Gottesdienst?“, fragte die Lehrerin jetzt Gabriele und Markus, die als Erste – endlich! – zur Tür hereinkamen.
„Okay“, lautete Markus’ lapidare Antwort.
„Ganz gut“, meinte Gabriele und gab genauere Auskunft, indem sie sogar die Verspätung erklärte. „Die zweiten Klassen haben so einen schönen Chorgesang einstudiert, der aber leider ein bisschen länger als normal gedauert hat. Tut uns leid, dass wir erst jetzt kommen. Wo sind die anderen?“ Gabriele blickte sich suchend um.
„Gott weiß“, seufzte Cäcilia Zeppezauer, obwohl sie es mit Gott gar nicht so zu haben schien, denn sonst wäre sie wohl selbst bei der Schulmesse gewesen. Aber vielleicht meinte sie auch einen anderen Gott, der sich für die außerhalb des ökumenischen Gottesdienstes stattfindenden Dinge zuständig fühlen sollte.
„Ein paar habe ich im Lehrertrakt stehen sehen“, sagte Markus.
„Ich hab’s befürchtet“, kommentierte die Klassenvorständin diese spärliche Information, wofür sie von den beiden Schülern einen fragenden Blick erntete.
„Es hat in den Ferien einen Todesfall gegeben ...“ Sie brach ab.
„Ah, die schwarze Fahne“, meinte Gabriele.
„Ja, die schwarze Fahne.“
„Wer?“, wollte Gabriele verständlicherweise wissen.
Da betrat Kevin das Klassenzimmer und ihm folgte nach und nach der ganze Rest der 7a. Als endlich alle Schüler auf ihren Plätzen saßen – auf Plätzen, die nach den geringfügigen personellen Veränderungen, bedingt durch Abgänge und Repetenten, wieder einmal neu vergeben werden mussten –, begann Frau Cäcilia Zeppezauer ihre Begrüßungsrede, die so anders ausfallen musste als in den vergangenen Jahren.
„Es hat in den Ferien einen Todesfall gegeben“, wiederholte sie ihre Worte von vorhin.
„Professor Glück“, ertönten ein paar Stimmen.
„Ja, Professor Eckart Glück. Ich sehe, ihr habt es bereits gelesen.“
Ausnahmsweise lauschten die Schüler gebannt oder hätten gerne den weiteren Worten der Lehrerin gelauscht. Jedoch sprach sie nicht weiter. So souverän Cäcilia Zeppezauer sich nach außen gab, so empfindsam war sie hinter der gestrengen Fassade. Und dieser Unglücksfall ging ihr zu Herzen. In der Zeitung las man darüber hinweg, nahm solche Kurznotizen höchstens am Rande, wo sie ja auch meistens positioniert waren, wahr. Ein Toter, ein Verletzter oder zwei, leicht oder schwer – was machte das schon aus, wenn es jemanden betraf, dem man noch nie in seinem Leben begegnet war und, im Falle eines Todesopfers, auch nicht mehr begegnen würde?
Aber Eckart Glück war sie zwangsläufig begegnet: auf dem Gang, im Konferenzzimmer, bei Besprechungen. Und auch wenn sie nicht mehr miteinander zu tun gehabt hatten – Mathematik und Musik harmonierten nur theoretisch miteinander –, fiel es ihr jetzt doch schwer, zu den Schülern über seinen Tod zu sprechen. Zumal man bei sechzehn- bis achtzehnjährigen Gymnasiasten nicht wissen konnte, wie sie auf den Tod eines Lehrers reagieren würden. Ob sie Eckart gemocht hatten? Grundsätzlich, überlegte Cäcilia Zeppezauer, hatten Musiklehrer wahrscheinlich größere Chancen, von ihren Schülern gemocht zu werden, als Mathematiklehrer. Aber hundertprozentig sicher war sie sich nicht, Wahrscheinlichkeit hin oder her.
Dazu kam das Alter. Nein, nicht das des Toten, obwohl es ihn natürlich ungewöhnlich jung erwischt hatte. Wenn jemand vor der Pensionierung starb, war das zwar für den Staatshaushalt ein Glücksfall, in Bezug auf die allgemein übliche Lebensplanung aber eindeutig zu früh. Sorgen machte Frau Zeppezauer darum das Alter der Schüler. In dieser Phase ihres Lebens musste man bei Jugendlichen mit absolut allem rechnen. Mit blöden Sprüchen über den Verstorbenen ebenso wie mit unverhältnismäßigen emotionalen Reaktionen, die da wären: Weinkrämpfe, lautes Klagen oder – im besten Fall – Verstummen, das womöglich über Tage hinweg anhielt, was dann auch irgendwann lästig wurde. Mit Psyche und Psychologie bei Jugendlichen tat die Lehrerin sich zugegebenermaßen schwer. Wie leicht konnte man hier etwas falsch machen.
„Es war ein Unfall“, erklärte sie und ging zur Tagesordnung über, die den provisorischen Stundenplan der kommenden Tage, die Ausgabe der Bücher für das neue Schuljahr und als schwierigsten Punkt die endgültige Sitzordnung beinhaltete.
„Was glaubt ihr, was das für ein Unfall war?“ Matti war Erika und Johanna nachgeeilt, die nach der Unterrichtsstunde mit der Klassenvorständin, die eher eine Besprechung gewesen war, insofern Frau Zeppezauer sie besprochen, also ihnen alle ihrer oder der Direktorin Meinung nach wichtigen Informationen mitgeteilt hatte, den Klassenraum möglichst schnell verlassen hatten. Die vermutliche Absicht hinter ihrem eiligen Abgang war das Bedürfnis, die Neuigkeiten allein beziehungsweise unter vier Freundinnenaugen zu diskutieren. Eine Absicht, die Matti, die sich jetzt zwischen die beiden drängte und sich gut gelaunt einzuhängen versuchte, boykottierte.
„Nun, was meint ihr?“, hakte sie nach, da weder Erika noch Johanna sie einer Antwort würdigten.
„Weiß nicht“, sagte Erika schließlich gedehnt, „kann alles Mögliche gewesen sein.“
„Sicher“, entgegnete Matti, die an der Klärung des Falls brennend interessiert schien. „Auch eine Überdosis ist ja oft nur ein Unfall. Wenn man Pech hat ...“
„Du mit deinen Drogengeschichten!“, blaffte Johanna sie an, wobei unklar blieb, ob sie damit Mattis Gerede über einen möglichen Drogenmissbrauch oder gar eine Drogenabhängigkeit des verstorbenen Musiklehrers meinte oder sich auf Mattis eigene Erfahrungen auf diesem Gebiet bezog, mochte es sich bei diesen Erfahrungen nun um tatsächlich erlebte oder nur um vorgebliche handeln.
„Was?“, fauchte Matti zurück. „Immerhin hat der Mist die ganze Schule geflasht.“ Sprach’s, machte sich von den beiden Klassenkolleginnen los, drehte sich beleidigt um und ging. Wohin auch immer. Erika und Johanna interessierten sich jedenfalls nicht sonderlich dafür. Genau genommen interessierten sie sich gar nicht dafür, sondern waren einfach nur froh, Matti losgeworden zu sein. Besonders Johanna.
„Was, glaubst du, war es wirklich?“, fragte Erika sie.
„Keine Ahnung. Bei einem Unfall denke ich immer ans Auto, aber ich weiß gar nicht, ob der Glück überhaupt eines hatte. Vielleicht hatte der nur ein Fahrrad oder so.“
„Ich habe ihn nie fahren gesehen, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Aber das heißt nichts. Wenn er in Bad Au wohnt ...“
„Gewohnt hat“, warf Johanna ein.
„Ja, gewohnt hat“, korrigierte sich Erika, „dann hat er vielleicht einfach keines gebraucht, um in die Schule zu fahren.“
„Manchmal braucht man kein Fahrzeug und fährt trotzdem.“ Johanna warf der Freundin einen verschmitzten Blick zu.
„Du meinst ...“, entgegnete Erika, verstummte aber gleich wieder.
„Ja, ich meine“, bestätigte Johanna die unvollendete Frage und fuhr fort: „Was ist eigentlich mit deiner Vespa? Hast du die Lust daran verloren oder warum bist du nur einmal damit in die Schule gefahren?“ Scherzhaft fügte sie hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an diesem einen Tag schon alle von der Ersten bis zur Achten gesehen und ausreichend bewundert haben.“
Erika schien einen Augenblick lang nicht zu wissen, ob sie der Freundin die Neckerei übel nehmen oder großzügig darüber hinwegsehen sollte. Sie entschloss sich für eine dritte Möglichkeit. „Weißt du, nach dem Unfall“, begann sie, „da habe ich mich so geschämt.“
„Aber es war doch nicht deine Schuld!“, rief Johanna gleichermaßen entsetzt wie irritiert. „Oder?“
„Nein, war es nicht, aber die haben gesagt, dass es meine Schuld war.“ Erika drehte den Kopf zur Seite, als würde sie immer noch von Schuldgefühlen geplagt werden.
„Deine Schuld?“ Johanna starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an, viel weiter als vorhin, als Erika mit verstörtem Gesicht hinter Matti aufgetaucht war und gesagt hatte, dass die schwarze Fahne Professor Glücks wegen vor dem Eingang der Schule aufgezogen worden war. „Wie ist denn so etwas möglich?“
„Ich bin angeblich zu dicht aufgefahren. Dabei hat der Idiot mich geschnitten und ist dann auf die Bremse gehampelt, sodass ich ihm ins Heck gekracht bin.“
Falls das überhaupt möglich war, schaute Johanna die Freundin jetzt noch entgeisterter an. „Aber damit bringt man doch niemanden um“, stammelte sie, „ich meine, doch nicht mit einer Vespa!“
„Umbringen?“ Nun war Erika an der Reihe, dumm aus der Wäsche zu schauen. Dann verstand sie. „Oh Gott, nein, nicht, was du glaubst. Mit dem Tod von Glück habe ich nichts, wirklich nicht das Geringste zu tun. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.“
„Hast du nicht?“ Jetzt verstand Johanna gar nichts mehr.
Das konnte sie auch nicht, denn Erika hatte ihr nie etwas von dem Vespaunfall im vergangenen Frühling gesagt, bei dem sie von einem BMW geschnitten worden war, sodass die kleine rote Vespa, die erst einen Tag davor zugelassen worden war, an dessen Heck zerschellte. Nicht, dass Erika vergessen hätte, der Freundin davon zu erzählen, das hatte sie ganz bewusst unterlassen, eben aus Scham. Aber jetzt hatte sie vergessen, dass sie es Johanna nicht gesagt hatte. Oder vielleicht nicht unbedingt vergessen, sondern vielmehr erfolgreich verdrängt. Auch aus Scham, die diesmal immerhin begründet war, denn der besten Freundin etwas absichtlich zu verschweigen, war wirklich keine Sache, auf die man als Sechzehn- oder Siebzehnjährige stolz sein sollte. Wie übrigens auch im späteren Leben nicht.
Bei einem Verkehrsunfall als schwächere Partei übervorteilt zu werden, war hingegen etwas, dessen sich eigentlich die andere Seite schämen sollte. Nur empfand Erika das nicht so. Deshalb das lange Schweigen. Und das Vergessen, das sich übrigens auch ein bisschen auf Johanna auswirkte. Nein, Erika hatte die Freundin nicht vergessen, selbst wenn diese in den vergangenen Monaten mitunter diesen Eindruck gehabt haben mochte. Nein, Johanna hatte selbst vergessen, dass Erika ihr, zugegeben in weniger als der gebotenen Kürze, mitgeteilt hatte, dass die Vespa kaputt wäre. Wenigstens hatte sie auf Johannas Frage nach dem geliebten Roller genau dieses Wort zur Antwort gegeben: kaputt. Was den Schluss, dass Erika damit den Zustand der Vespa beschrieb, nahelegte. So viel also zum Vergessen. Schweigen konnte Erika jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr. Dafür hatte sie schon zu viel gesagt.
„Also“, begann sie deshalb, holte noch einmal tief Luft und erzählte Johanna in der Folge endlich von dem dummen Unfall, bei dem ihre neue, gebraucht gekaufte PK50 am zweiten Tag der Anmeldung kaputt gegangen war und für den sie, Erika, die Schuld bekommen hatte. Den – minimalen – Schaden am gegnerischen BMW hatte natürlich ihre Versicherung bezahlt, doch für den Schaden an der Vespa hatte sie selbst aufkommen müssen. Oder hätte sie müssen, denn tatsächlich waren alle ihre Ersparnisse in die Anschaffung des heiß ersehnten Fahrzeugs geflossen.
„Das heißt, du bist seither gar nicht gefahren und wirst es auch nicht mehr tun?“ Johannas Mitgefühl war deutlich zu vernehmen.
„Nicht ganz“, gab Erika zu. „Gefahren bin ich lange nicht. Ist gar nicht gegangen, ich habe schon Mühe gehabt, die Vespa nach Hause zu schieben. Aber im Sommer habe ich sie dann reparieren lassen. Nur“, meinte sie und ihre Stimme klang noch eine Nuance leiser, verschämter, „habe ich mich seither nicht getraut, mit der Vespa in die Schule zu fahren.“
„Sicher“, pflichtete Johanna bei, „so ein Unfall kann jederzeit wieder passieren.“
„Ja, natürlich“, erwiderte Erika, „und dieser Typ, Martin hat er geheißen, hat wirklich kurz drauf wieder einen Unfall gehabt und jetzt ist er tot.“
„Echt?“
„Ja“, bestätigte Erika lapidar. Mehr sagte sie nicht, vielleicht wieder einmal aus Scham, nämlich aus Scham über die Freude am Unfalltod des Herrn Martin.
Johanna schien zu spüren, dass sie an dieser Stelle nicht weiterfragen sollte, und kam deshalb auf Erikas PK50 zurück. „War sicher teuer, die Reparatur deiner Vespa.“
„Ja“, musste Erika zugeben, „aber ein netter Mechaniker hat sie mir schwarz repariert, damit das weniger kostet.“
„Woher kennst du denn einen Mechaniker, der dir das macht?“, erkundigte Johanna sich.
„Der Glück hat ihn mir vermittelt“, erklärte Erika, wobei sie auch dieses Mal einen Teil der Zusammenhänge verschwieg.
„Echt? Wieso hat der denn so intensive Kontakte zu Mechanikern ... gehabt?“, überlegte Johanna. Und weiter grübelte sie, warum Erika den Musiklehrer ins Vertrauen gezogen, ihr selbst, Jojo, aber nicht ein Sterbenswörtchen verraten hatte. Doch sie unterdrückte die aufkeimende Eifersucht und formulierte stattdessen eine Schlussfolgerung, von der sie hoffte, dass sie einigermaßen klug und schlüssig war. „Das heißt, der Glück hatte über Umwege mit deinem Unfall zu tun, du aber nicht mit seinem. Wenn er enger mit einem Mechaniker bekannt ist ... äh, war, dann hatte er bestimmt ein Auto. Und mit diesem Auto wird er tödlich verunglückt sein.“ Sie sah Erika erwartungsvoll an. „Habe ich es getroffen?“, fragte sie.
„Ich denke schon“, meinte die beste Freundin.
Die Schule war also, in Mattis Worten, geflasht. Auf jeden Fall waren viele Schüler aufgrund von Professor Glücks Unfalltod aufgewühlt und unruhig, sodass der Verstorbene noch volle drei Tage das Gesprächsthema Nummer eins war. Selbstverständlich hatte sein unerwartetes Ableben auch für Unruhe und Nachdenklichkeit innerhalb der Lehrerschaft gesorgt. Allerdings waren die Kollegen bereits in den Ferien darüber informiert worden, damit sie die Nachricht verarbeiten, sich eventuell bei der Beerdigung sehen lassen und schließlich entsprechend gefasst vor die Schüler treten konnten. Soll noch einer sagen, Lehrer hätten den Sommer über nichts zu tun.
Zu tun hatte allerdings vor allem die Schulleitung. Nein, nicht mehr der endlich in den Ruhestand getretene Herr Professor Dippelbauer, sondern die neue Direktorin, die hierbei sogleich ihre organisatorischen und sozialen Kompetenzen unter Beweis stellen konnte. Ihr zur Seite stand natürlich die langgediente Sekretärin, Frau Drescher. Es galt, innerhalb von zwei, maximal drei Wochen einen neuen Musik- und einen neuen Deutschlehrer zu finden – den einen für eine Festanstellung, den anderen nur vertretungsweise. Hoffentlich zumindest. Denn obwohl Eckart Glück im Zweitfach Deutsch hätte unterrichten dürfen, hatte er sich doch lieber nur auf die Musik beschränkt. Hier hatte er seine eigentliche Stärke gesehen, sofern die vermeintliche Stärke nicht nur aus der seltenen Abwesenheit einer Schwäche resultierte. Deutsch war ihm das erforderliche Zweitfach an der Universität gewesen. Denn wie ihm die Musik so natürlich, selbstverständlich und notwendig wie das Atmen erschienen war, so hatte auch die deutsche Sprache zu seinem Alltag gehört. Sie allein aus diesem Grund aber auch zu unterrichten, hatte er nicht für nötig erachtet.
Deshalb also wurde am Bad Auer Gymnasium nur nach einem Deutschlehrer als Vertretung gesucht, wobei dieser vorzugsweise eine Deutschlehrerin, also weiblich sein sollte. Nicht etwa, weil die Vertretung aufgrund ihres letzten Gliedes feminin war und man solch ungesicherte Vertretungen daher passenderweise Frauen zuschanzen wollte, sondern aus Gründen der Gleichbehandlung. Von allen Geschlechterfragen abgesehen, hoffte man einfach, dass Maria Liliencron bald aus dem Krankenstand zurückkommen würde.
Es war nämlich nicht allein Eckart Glück gewesen, der bei dem Unfall zu Schaden gekommen war, wenngleich sein Schaden wahrscheinlich als der ungleich größere bezeichnet werden sollte, hatte der Gute dabei doch sein Leben verloren.
Der Gute. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf das substantivierte Adjektiv, da die Entscheidung für ein dazu passendes Substantiv womöglich eine langwierige und darum tunlichst zu vermeidende Diskussion heraufbeschwören würde. Könnte man von Eckart Glück als einem guten Musiklehrer sprechen? Von den Schülern wäre wohl kaum eine einstimmige Antwort zu erwarten gewesen, genau so wenig wie die Musikerkollegen unisono mit „Ja“ gestimmt hätten, zumindest nicht, bevor Eckart Glück aus dem Leben gerissen worden war. War er ein guter Sohn gewesen? Dazu müsste man seine Eltern befragen. Der Herr Papa war zwar selbstverständlich beim Begräbnis dabei gewesen, aber es hätte natürlich keinen guten Eindruck gemacht, diese Frage gerade dort zu stellen. Genauso wenig wie die Frage nach der möglichen Güte des Bruders übrigens. Ein guter Musiker vielleicht? Das war unwahrscheinlich, denn sonst hätte Eckart Glück in diesem Bereich Karriere gemacht und sich nicht mit dem Lehramt – so gerne er auch unterrichtet haben mochte – herumgeschlagen. Ein guter Freund? Da man im näheren Umkreis niemanden fand, der sich als Freund Eckart Glücks ausweisen konnte, musste die Beweisführung in dieser Hinsicht aus Mangel an Zeugen abgebrochen werden. Womöglich ein guter Liebhaber? Ich bitte Sie, wir wollen doch nicht indiskret sein! Und sollten wir es dennoch sein wollen, so erlauben wir uns nicht, es zu zeigen. Besonders nicht in einer solchen Situation.
Deshalb also hatte der Gute sein Leben verloren. Nein, natürlich nicht wirklich deshalb, sondern weil er in einem Anfall akuter Geistesabwesenheit auf die Straße getreten und von einem Auto über den Haufen gefahren worden war.
Auch das Auto war beschädigt worden, weil sich nach einem in doppelter Hinsicht missglückten Ausweichversuch eine Hausmauer als stabiler denn eine Motorhaube erwiesen hatte. Dieser Schaden war selbstverständlich nicht tödlich gewesen, weil ein Auto entgegen der Meinung einzelner Fanatiker naturgemäß nicht lebte, folglich auch nicht sterben, höchstens Totalschaden erleiden konnte. Und auch dann litt in der Regel nicht das Auto, sondern dessen Besitzer. Da es sich aber nicht einmal um einen Totalschaden handelte, konnte die Haftpflichtversicherung des Toten das Materielle mit Leichtigkeit ausbügeln beziehungsweise ausbeulen lassen, sobald das endgültige Urteil in dieser Sache gesprochen wäre.
Das Problem war viel eher, dass das Auto auch von jemandem gelenkt worden war. Und dieser Jemand war zu ihrem Leidwesen niemand anderer als Maria Liliencron gewesen.
„Maria Liliencron“, sagte die neue Direktorin, Frau Magister Glaunigg-Althoff, „wird für die Zeit ihrer Abwesenheit im Deutschunterricht von Monika Schwaiger vertreten. Die Geografiestunden hat dankenswerterweise Herr Professor Kuntz übernommen.“
Bei der Erwähnung ihres Namens hatte sich Monika Schwaiger, eine junge Kollegin mit sympathischen Gesichtszügen, erheben wollen, um die ihr bislang fremden Lehrer des Gymnasiums in Bad Au wenigstens mit einem Kopfnicken zu begrüßen, doch Bettina Glaunigg-Althoff schien keinen Wert darauf zu legen, sondern sprach ungebremst weiter.
„Durch die Pensionierung von Herrn Direktor Dippelbauer hat diese Schule die Chance auf Modernisierung und Fortschritt bekommen. Ich möchte Sie gleich zu Beginn des Schuljahres mit meinen Konzepten vertraut machen.“
„Die kommt aber nicht aus der Gegend“, murmelte der Deutschlehrer Ernst Braunsfelder und sah seinen Kollegen Kuntz fragend an. Dieser zuckte die Schultern und schürzte, Unwissenheit ausdrückend, die Lippen. „Klingt verdächtig nach Kärnten“, raunte der für Sprachvarianten hellhörige Germanist dem an Ländergrenzen interessierten Alfred Kuntz ins Ohr.
Nachdem die Schüler an diesem ersten Tag des neuen Schuljahres nach nur zwei Stunden – einer Stunde Gottesdienst und einer Stunde Unterricht – entlassen oder vielmehr mit allen eventuellen Fragen zum Unfalltod des Musiklehrers Glück allein gelassen worden waren, war für die Lehrer der Arbeitstag noch nicht zu Ende. Genau genommen fing er erst an. Denn wenn es nach zehn, zwanzig oder auch nur fünf Unterrichtsjahren zu ihrem Alltag gehörte, vor den Schülern zu stehen, so war es doch etwas anderes, nach dreißig Jahren unter der Leitung von Herrn Professor Dippelbauer plötzlich vor einer neuen Direktorin eine gute Figur abgeben zu müssen.
Und das wollten sie alle, eine gute Figur abgeben, selbst wenn die Ansichten darüber, was dies im konkreten Fall bedeuten mochte, diametral auseinandergingen. Die Gründe für die Unterschiede bezüglich des Wesens einer guten Figur lagen, wie sich denken lässt, einerseits in den unterschiedlichen Zielen, die von den einzelnen Gliedern des Lehrkörpers verfolgt wurden. Während nämlich die eine hoffte, als Liebling oder Vertraute der Frau Direktor von deren Macht zu profitieren, war der andere ängstlich darauf bedacht, seine Querulantenrolle nicht zu gefährden. Während der eine durch seinen Einfluss auf die Neue versuchen wollte, die eigene Karriere zu fördern, ohne selbst ins Kreuzfeuer zu geraten, hoffte eine andere bei der Durchsetzung ihrer schulpolitischen Ziele auf die Unterstützung der Direktorin. Und manch seltsamer, an Politik gänzlich uninteressierter Vogel steckte wohl auch den Kopf in den Sand und versuchte nur rein körperlich, sämtliche Kriterien einer guten, also durchtrainierten, glattrasierten und solariumgebräunten Figur zu erfüllen.
Einerseits. Andererseits wusste niemand oder doch so gut wie niemand Genaueres über diese Bettina Glaunigg-Althoff, die da so plötzlich den alten Dippelbauer ersetzt hatte. Unerwartet war die Ersetzung oder Absetzung nicht etwa deshalb gewesen, weil der betagte Herr Direktor mit seinen siebenundsechzig noch einige Jahre in seinem Amt vor sich gehabt hätte. Dass dies nicht der Fall gewesen war, hatte er in den letzten zwei Jahren, als er um seinen Posten hatte kämpfen müssen, selbst schmerzlich festgestellt. Aber bei alten, bei so richtig alten Menschen glaubt man irgendwann nicht mehr, dass sie doch einmal sterben müssen, weil sich ihre Methusalemhaftigkeit nur dadurch erklären lässt, dass der Tod sie vergessen hat. Und ebenso ließ sich auch für die Lehrer des Gymnasiums in Bad Au das dem Pensionsalter trotzende Verharren Direktor Dippelbauers nur durch die Vergesslichkeit der Landesschulleitung erklären. Was mochte dem Gedächtnis des Landesschulrats auf die Sprünge und dem alten Dippelbauer zum Absprung verholfen haben? Denn dass der Direktor freiwillig den Hut genommen hatte, konnte sich niemand der ehemaligen Kollegen und Untergebenen vorstellen.
Diese beinahe allgemeine Unwissenheit in Bezug auf die näheren Umstände des Wechsels sowie die Wesenszüge der neuen Direktorin bedingte also genauso wie die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Lehrer die unterschiedlichen Figuren, die in der Hoffnung, dass sie gute sein mögen, abgegeben werden wollten. Mit anderen Worten: Die Lehrer des Bad Auer Gymnasiums hegten alle unterschiedliche Pläne, weil jeder ein anderes Ziel verfolgte und dabei doch keiner von ihnen die neue Direktorin kannte.
Letzteres war dieser natürlich bewusst, weshalb sie sich zu Beginn der Lehrerversammlung kurz und, wie sie fand, ausreichend herzlich vorgestellt hatte. Bettina Glaunigg-Althoff. Sehr erfreut. Große Ehre, als Frau langjährigen und mehr als verdienten Herrn Direktor Oberstudienrat Dippelbauer abgelöst zu haben. Blick auf die Zukunft unseres Landes – hier folgten die Konzepte, mit denen die Frau Direktor die Bad Auer Lehrerschaft jetzt bekannt machte. Kompetenzen fördern. Potenziale nutzen. Ordnung halten. Und so weiter. Sehr angenehm, fand die neue Direktorin.
Sie fuhr sich mit der Hand durch die langen, dunkelrot gefärbten Haare, die ihrer kleinen schlanken Gestalt etwas Hexenhaftes verliehen. Interessant, wie die Assoziationen auseinandergingen: Während Mattis blonde Mähne das junge Mädchen mit dem trügerischen Nimbus eines Engels umgaben, verlieh die dunkelrote Mähne der neuen Direktorin die Aura einer Hexe. Das fand Cäcilia Zeppezauer, die freilich auch bei Matti oder Mathilda Sedlacek, wie sie vollständig hieß, nicht an einen Engel dachte. Dafür glaubte sie, den Charakter unter der Haarpracht gut genug einschätzen zu können.
„Übrigens begrüße ich es außerordentlich, wenn Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern Ausflüge beziehungsweise Exkursionen zu pädagogisch wertvollen Destinationen unternehmen.“
Die in die Breite gezogenen Mundwinkel wollten dieser verbalen Aufforderung möglicherweise eine nonverbale Aufmunterung hinterherschicken. Vielleicht nahm Bettina Glaunigg-Althoffs Gesichtsmuskulatur aber auch nur Anlauf für das wahre Kanonenfeuer an Punkten, die von den Lehrerinnen und Lehrern für den Fall, dass sie die Realisierung einer Exkursion in Erwägung zögen, zu beachten waren. Sie hier in ihrer Vollständigkeit anzuführen, würde bei den Lesern und Leserinnen bestimmt ebenso große Langeweile hervorrufen, wie es bei den versammelten Lehrern und Lehrerinnen Entsetzen verursachte. Hatte der Aufwand für eine Exkursion oder einen hübsch altmodischen Wandertag bisher in deren oder dessen Organisation und Durchführung bestanden, sollten diesem vergleichsweise einfachen Prozedere in Zukunft eine Antragsstellung inklusive Motivationsschreiben und pädagogischer Begründung vorausgehen sowie eine Reflexion über Durchführung, Umsetzung und Erreichen oder Verfehlen der Lernziele folgen.
„Eine was?“, fragte Kollege Braunsfelder flüsternd den neben ihm sitzenden Alfred Kuntz.
„Eine Reflexion“, wiederholte dieser und fügte, als Braunsfelder ihn mit zwei großen Fragezeichen in den runden Augen ansah, hinzu: „Das heißt, du sollst darüber nachdenken, ob die Exkursion gelungen oder danebengegangen ist.“
„Ah ja“, antwortete Ernst Braunsfelder für alle vernehmbar.