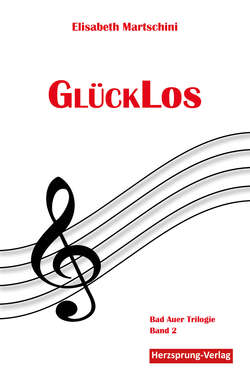Читать книгу GlückLos - Elisabeth Martschini - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fragen des Gleichgewichts
ОглавлениеUnter den Strahlen der immer noch erstaunlich warmen Nachmittagssonne zog Maria Liliencron im großen Becken des Bad Auer Thermalbades ihre Bahnen. Groß war das Becken eigentlich nur im Vergleich zu dem anderen, noch kleineren zu nennen. Aber was musste schon groß sein in Bad Au? So richtig große, knallblau gestrichene und mit Chlorwasser gefüllte Schwimmbecken hätten gar nicht zu dem alten Kurbad gepasst, wo man zwischen den schon leicht angewitterten steinernen Treppen und Balustraden den Geist der guten alten Zeit atmen zu hören glaubte. Vielleicht war es aber auch nur der Wind, der durch die große Platane strich, die mit ihren ausladenden Ästen die Liegewiese überspannte und an heißen Sommertagen für willkommenen Schatten sorgte.
Die heißen Sommertage waren für diese Saison allerdings vorbei. So schön der September sich auch präsentierte, das Gold des Lichts verriet doch unleugbar den nahenden Herbst. Wie oft würde sie noch hier im erfrischenden Wasser hin und her schwimmen können, überlegte Maria Liliencron, hin und her? Die Gleichmäßigkeit der Schwimmbewegungen war ihr früher immer als zu eintönig erschienen. Dass es junge Menschen gab, die von dieser Sportart begeistert waren, hatte sie schwer nachvollziehen können. Zumal sie es schon in ihrer Jugend nicht geschätzt hatte, nass zu werden. Darüber hinaus war das Wasser im Bad Auer Thermalbad entsetzlich kalt, was die Lehrerin zu der Erkenntnis gebracht hatte, dass ein Thermalbad nicht zwangsweise warm sein musste, dass die Bezeichnung den Laien, der dabei an Therme und Wärme und Wellness dachte, also ganz schön oder eher unschön in die Irre führen konnte.
Dass Maria Liliencrons Weg ins Thermalbad geführt hatte, lag eigentlich auch nur an Elfriede Hirschhauser, ihrer Therapeutin.
Meine Therapeutin, dachte die Lehrerin und wunderte sich insgeheim darüber, dass sie so etwas in Bezug auf sich selbst überhaupt denken konnte. Ihre Therapeuten waren vielleicht ein beliebtes Gesprächsthema reicher amerikanischer Hausfrauen der Upperclass, die ihr beziehungsweise ihrer Männer Reichtum und die daraus resultierende Langeweile unweigerlich in die Depression getrieben hatten und die nun gemeinsam mit diesen ihren Therapeuten verzweifelt auf der Suche nach einer Seele waren, die sie für viel Geld streicheln lassen konnten. Aber sie, Maria Liliencron, und eine Therapeutin? Das wollte nicht zusammenpassen.
Doch nach dem schrecklichen Unfall im August war es keine Frage von Wollen oder Nicht-Wollen mehr gewesen. Ohne Therapeuten – oder in ihrem Fall: ohne Therapeutin – wäre sie an dem Geschehenen zerbrochen. Deshalb war sie, falls sie nach Eckarts Tod überhaupt noch hatte stehen können, nicht vor der Frage gestanden, ob, sondern nur wo sie einen Therapeuten suchen sollte.
Doch in solchen Situationen konnte man sich beinahe zu hundert Prozent auf die wahren Freundinnen verlassen. Auf diejenigen nämlich, die einen in seinem Leid nicht allein ließen, sondern dem weisen Spruch folgten, dass geteiltes Leid halbes Leid sei. Und um es miteinander zu teilen, war kein Leid zu groß. Jede Freundin wollte helfen und kam mit guten Ratschlägen: Psychotherapie, Hypnose, Yoga, Tai Chi, Chi Gong und Familienaufstellung und NLP, was die Germanistin Maria Liliencron als „Neuerdings labile Persönlichkeit“ übersetzte und daher maximal als Diagnose, nicht aber als Methode oder Therapieform gelten lassen wollte. Mit einer letzten Aufbietung ihrer psychischen Kräfte war sie schließlich von Pawlow zu Pilates gelaufen. Und endgültig zusammengebrochen.
Natürlich fehlte zwischen dem endgültigen Zusammenbruch und dem Wiederauftauchen im Thermalbad noch mindestens ein Zwischenschritt. Und dieser Zwischenschritt hieß Elfriede Hirschhauser. Genau genommen hatte er zuerst Doris geheißen und dann erst Elfriede Hirschhauser, was nicht an einer etwaigen Namensänderung lag, sondern schlicht daran, dass sich Doris unter allen fürsorglichen Bewerberinnen für die Rettung des liliencronschen Seelenheils durchgesetzt und die Zusammengebrochene zu der unweit praktizierenden Psychologin Elfriede Hirschhauser, einer Bekannten aus Studientagen, geschleppt hatte.
Dort war die Lehrerin oder Lenkerin, nämlich des Unfallfahrzeugs, als psychisches Wrack angekommen, bevor sie langsam wieder zu sich selbst kam. Kam im Präteritum als jenem Tempus, das in einer anständigen Erzählung – und um eine solche handelt es sich hier selbstverständlich – die Gegenwart symbolisiert. Im Präteritum also, denn noch war Maria Liliencrons Prozess des Zu-sich-selbst-Kommens nicht abgeschlossen, weshalb noch nicht im Plusquamperfekt von ihm gesprochen werden kann. Wenn die Betroffene ehrlich zu sich selbst war – und ehrlich zu sich selbst oder wenigstens zu ihrer Therapeutin zu sein, war eines der Hauptziele der Therapie, es kam gleich nach der Wiederfindung des seelischen Gleichgewichts und der Verarbeitung des Erlebten, das ein anderer nicht überlebt hatte. Wenn die Deutschlehrerin im psychisch bedingten Krankenstand also ehrlich zu sich selbst war, bedauerte sie ihre momentane Lage nicht allzu sehr. Nein, nicht die Rückenlage, in der sie sich von einer Seite des Beckens zur anderen bewegte, immer einen Arm nach dem anderen hebend, über die Schulter führend und etwas über Kopfhöhe wieder ins Wasser eintauchend. Sondern die berufliche Lage, in der sie sich zu Beginn dieses Schuljahres befand. Die berufliche, die eigentlich eine rein private Lage war, weil sie für die Dauer des Krankenstands natürlich vom Unterricht befreit war und erstmals im Leben Zeit für sich selbst hatte, da auch ihre Tochter Iris bei ihren, Marias, Eltern untergebracht war. Das konnte eigentlich nicht als ideal bezeichnet werden, weil die Eltern Liliencron die Tochter über ihr Unglück angesichts der Existenz der Enkelin keinen Augenblick im Zweifel gelassen hatten. Aber auch für die Mutter war die Situation alles andere als ideal gewesen und da musste eben jeder etwas dazu beitragen.
Seinen Beitrag hatte Heinz – Maria drehte sich allein beim Gedanken an diesen Namen der Magen oder die Gebärmutter oder was auch immer um – damals in gewisser Weise auch geleistet, den Antrag dann jedoch einer anderen gemacht, sodass die neunzehnjährige Maria, als sie feststellte, dass sie schwanger war, ihre Sachen gepackt und ein Leben allein oder eigentlich zu zweit, jedenfalls aber nicht zu dritt, begonnen hatte, ohne die unglücklichen Eltern um Hilfe zu bitten.
Gebeten hatte sie sie auch diesmal nicht, sondern diese Aufgabe großzügigerweise Doris überlassen, die in ihrer Helferrolle von Tag zu Tag mehr aufgeblüht war, bis ihre Blütenpracht alles andere überdeckt hatte und Maria Liliencron sich still und leise aus dem Staub hatte machen können. Beziehungsweise auf Elfriede Hirschhausers Rat hin den Sprung ins kalte Wasser des in trügerischer Weise so betitelten Thermalbades in Bad Au gewagt hatte. Erst in jenem Wasser, dessen Kälte ihr bis in die Knochen drang, war sie wieder aufgetaut. Die warme Septembersonne tat ein Übriges. In ihr schmolz der letzte Rest des Bedauerns über die ohnehin entschuldigte Abwesenheit von der Schule dahin.
„Daran könnte ich mich glatt gewöhnen.“ Maria Calloni streckte sich auf ihrer Liege aus, schloss die Augen und hielt ihr Gesicht in die Sonne.
„So wie du ausschaust, hast du dich eh schon daran gewöhnt – falls du die Sonne und das Nichtstun meinst.“
Frau Calloni öffnete träge das rechte Auge. Das linke Lid war etwas lahm aufgrund eines leichten Schlaganfalls, wie er früher oder später fast jeden einmal traf, sofern man nicht zu den Besten gehörte und deshalb jung starb. Da jung zu sterben aber entschieden nicht zu Maria Callonis Lebensplan gehört hatte, hatte sie diesem ersten, zum Glück nur kleinen Schlaganfall nicht ausweichen und ihn nur überleben können. Seine Folgen versuchte sie nun, so gut es eben ging, zu verheimlichen, was ihr dank einiger Erfahrung in Sachen Geheimhaltung unangenehmer Dinge ganz gut gelang. Dass sie in der momentanen Situation nur das eine Auge öffnen konnte, kam ihr geradezu entgegen, denn auf diese Weise nahm ihr Gesicht einen tendenziell uninteressierten, zumindest gelangweilten Ausdruck an. Als würde sie gewissermaßen über den Dingen und über Lise Vrabec’ Bemerkung stehen, obwohl sie eigentlich auf ihrer Badeliege auf der Terrasse des Bad Auer Thermalbads lag.
„Wie meinst du das, liebe Lise?“
„Ich meine gar nichts, liebe Mitzi, außer dass du den Sommer über nicht viel anderes getan hast, als in der Sonne zu liegen und deine alte Haut rösten zu lassen.“
„Das ist doch gar nicht wahr“, verteidigte sich Mitzi Calloni.
„Womit sie recht hat“, mischte sich eine dritte Stimme in die Auseinandersetzung. „Hin und wieder war sie auch im Café Sisi.“
„Danke, Gerti“, sagte Frau Calloni mit wieder geschlossenen Augen, „obwohl ich nicht sicher bin, ob du das so nett meinst, wie es geklungen hat.“
„Du glaubst doch nicht, dass sie auf deine Figur anspielt, die in den letzten Monaten doch ein bisserl gelitten hat. Immerhin sind die zahlreichen Herrentorten und Punschkrapferl und was weiß ich, was sonst noch, nicht spurlos an dir vorübergegangen“, warf Lise Vrabec ein.
„Du meinst: durch sie hindurchgegangen“, korrigierte die dritte Stimme, die Frau Calloni einer gewissen Gerti zugeschrieben oder vielmehr zugesprochen hatte.
Mitzi Calloni wäre jetzt gerne mit einem Ruck hochgefahren, um die herzlosen Freundinnen für ihre spitzen Bemerkungen mit einem beidäugigen bösen Blick zu strafen, aber das war aus mehreren Gründen nicht möglich. So fügte sie sich wohl oder übel in ihre Rolle der Makrone, Verzeihung, Matrone, der keinerlei Kritik etwas anhaben konnte.
„Pah, in dem Alter ist die Figur doch wurscht“, sagte sie und versuchte, den beleidigten Ton zu unterdrücken, der ihre Worte unbedingt begleiten zu wollen schien.
„Sicher“, meinte Lise Vrabec trocken. „Knackwurscht. Besonders in einem schweinchenrosa Badeanzug, von dem sich deine Haut übrigens schokoladenbraun abhebt.“
„Vergiss nicht, liebste Lise“, erwiderte Mitzi Calloni wieder zuckersüß, „dass du mich jedes Mal ins Café Sisi begleitet hast. Ich bin mir absolut sicher, dass ein paar Stückchen Torte ihren Weg auch auf deinen Teller und, nebenbei gesagt, deine Hüften gefunden haben.“
Hätte die Calloni ihre Augen jetzt geöffnet und sie auf die neben ihr liegende Freundin gerichtet, hätte sie die tiefe Röte entdeckt, die das faltige Gesicht trotz der mittleren Bräune überzog. So aber sah sie nichts. Man konnte seine Augen nicht überall haben.
„Außerdem“, fuhr sie stattdessen fort, „darf ich es mir auf meine alten Tage doch wohl ein bisserl gut gehen lassen.“
„Fang nicht schon wieder mit deinen Ehemännern an“, bat Gerti.
Dabei hätte es über diese Ehemänner viel zu erzählen gegeben, denn immerhin konnte Maria Calloni, geborene Schuster, auf deren drei zurückblicken. Das war in der heutigen Zeit zwar keine große Besonderheit, denn da gab es eine ganze Reihe von Wieder- und Wieder- und Wiederverheirateten, im Volksmund Wiederholungstäter genannt, obwohl die Ehe an sich ja noch kein Verbrechen darstellte, genauso wenig wie die Scheidung, wenigstens in unseren Breiten nicht. Sie konnte höchstens als perfekter Nährboden für Verbrechen bezeichnet werden, insofern viele Gewalttaten erst aus dem angeblich freiwilligen, tatsächlich aber vielfach gesellschaftlich erzwungenen allzu engen Zusammen-, Nebeneinander- und schließlich Gegeneinanderleben resultierten.
Mit anderen Worten: Allein die Tatsache, dass sie dreimal verheiratet gewesen war, verschaffte Mitzi Calloni noch nicht den Status, den sie bei ihren Freunden, Feinden und weitläufigen Bekannten hatte. Dieser lag zum einen in ihrem Alter begründet. Bei den, laut Hildegard Binsen, zehn Jahren, die österreichische Eheleute durchschnittlich miteinander verbrachten, bevor sie nicht mehr nur das Geschirr, sondern auch das Handtuch warfen – wobei sich das Adjektiv österreichisch rein auf die geografische Lage des gemeinsamen Haushalts bezieht und nichts über Nationalitäten und Migrationshintergründe ausgesagt haben will –, hätten, inklusive einem Jahr der Selbstsuche und Partnerfindung, dreiundfünfzig Lebensjahre ausgereicht, wenn man die erste Heirat mit einundzwanzig ansetzte.
Einundzwanzig Jahre alt war Mitzi Schuster tatsächlich gewesen, als sie ihren Rudolf Bauer geheiratet und damit den Beruf gewechselt hatte, indem sie die wohlbehütende Schwesternrolle aufgegeben und die der treusorgenden Ehefrau angenommen hatte.
Das lag jetzt allerdings schon einundsechzig Jahre zurück, war eigentlich gar nicht mehr wahr, wie man so schön sagte oder wie zumindest Mitzi, geborene Schuster, es die anderen so gerne glauben machen wollte. Denn damals ließ man sich nicht so einfach von seinem Göttergatten scheiden, selbst wenn man den schon lange nicht mehr anbetete, sondern höchstens um ein paar Schilling anbettelte. Auch zehn Jahre nach der Hochzeit ließ man sich nicht so einfach scheiden. Dabei war Mitzi – um Verwirrungen vorzubeugen, verzichten wir vorläufig auf den Nachnamen, wie es auch die weitläufigen Bekannten irgendwann getan hatten, weil sie auf den jeweils aktuellen Stand zu bringen Mitzi bald zu mühsam geworden war.
Mitzi also war zehn Jahre nach ihrer ersten Hochzeit bereits zum zweiten Mal verheiratet. Allerdings ohne geschieden worden zu sein. Das hätte sich nicht gut gemacht. In der kleinen Kurstadt Bad Au nicht und in dem noch kleineren Bosdorf, wohin sie mit ihrem zweiten Ehemann gezogen war, erst recht nicht. Aber gegen eine wiederverheiratete Witwe konnte niemand etwas sagen, die katholische Kirche nicht und darum auch der liebe Gott nicht. Und nicht einmal die Leute in Bad Au, wohin Mitzi Calloni mit ihrem dritten Ehemann, einem italienischstämmigen Operettensänger, und einigem Widerwillen gezogen war.
Es versteht sich von selbst, dass auch die zweite Ehe nicht durch eine Scheidung beendet worden war. Genauso wenig übrigens wie die dritte. Darin lag der zweite, gewichtigere Grund für Mitzi Callonis Sonderstatus.
Die geborene Schuster und inzwischen schon lange verwitwete Calloni hätte also viel zu erzählen gehabt. Sie erzählte auch viel – manchmal zu viel, wie ihre Freundinnen Lise Vrabec und Gerti Haberhauer, die dritte Stimme im Damenchor, meinten –, aber eben doch nicht alles. Dieses alles hätten die Bewohner von Bad Au auch im 21. Jahrhundert nicht hören wollen. Das heißt, hören hätten sie es schon wollen, aber geschluckt hätten sie es nicht so leicht wie Petra Sandors herrliche Buttercremetorten.
Weil nun das eine nicht gehört werden wollte und das andere nicht geschluckt werden konnte, deshalb nicht gehört werden durfte und in weiterer Folge nicht erzählt werden sollte, schwieg Mitzi Calloni, scheinbar beziehungsweise hörbar oder noch besser unhörbar überlegen, und ließ sich die Sonne auf den schokoladenbraunen Altfrauenkörper scheinen, während im kalten Wasser des großen oder wenigstens größeren Beckens die andere Maria ihre Bahnen zog.
Während Maria Liliencron im Thermalbad Körper und Psyche langsam wieder in Balance zu bringen versuchte, passierte natürlich noch wesentlich mehr, als dass Mitzi Calloni in der Sonne vor sich hin brutzelte. Immerhin gab es auch Menschen, die an diesem Nachmittag, einem warmen Septembernachmittag, genauer einem warmen Septemberdonnerstagnachmittag oder, noch genauer, an einem für diese Jahreszeit noch leidlich warmen Spätseptemberdonnerstagnachmittag, arbeiten mussten.
Zu ihnen zählten beinahe sämtliche Lehrer des Gymnasiums in Bad Au, da seit der Einführung der Fünftagewoche der Unterricht auch nachmittags stattfinden musste, damit es einen triftigen Grund dafür gab, weshalb Lehrer und Schüler sich am Samstagvormittag von den Strapazen der Arbeits- beziehungsweise Schulwoche erholen mussten.
Zu den arbeitenden Menschen zählten weiters Petra Sandor und ihr Mann Istvan, obwohl jener vielleicht gerade sein Nachmittagsschläfchen hielt. Ob er das tat oder aber an der Buchhaltung arbeitete, konnte nicht einmal seine Frau, die derweil den Laden schmiss oder schaukelte, was seltsamerweise auf dasselbe hinauslief, mit Sicherheit sagen. Aber solange es weder mit dem Finanzamt noch mit dem Gebäck Schwierigkeiten gab, interessierte es sie wenig, was ihr Mann an diesem oder jedem anderen Donnerstagnachmittag – die Jahreszeit spielte hier keine Rolle, da Sandors ohnehin keine Ferien hatten und nur ganz selten in den Urlaub zu fahren wagten – tat oder nicht tat. Irgendetwas mit Arbeit würde es schon zu tun haben, dachte sie, während sie Bestellungen aufnahm und Kaffee in Mehlspeisenbegleitung abgab.
Zum arbeitenden Teil der Bevölkerung zählte außerdem Inspektor Obermayer, der bei halb heruntergelassenen Jalousien in seinem Dienstzimmer saß und gegen den Schlaf ankämpfte.
Ein Kaffee wäre jetzt gut, dachte er, aber seit ein paar Tagen rebellierte sein Magen. Gastritis, kam ihm in den Sinn, ein Magengeschwür oder gar Magenkrebs.
Das heißt, eigentlich kam ihm in den Sinn, dass all diese unnötigen Dinge in seinen Magen gekommen sein oder sich zumindest dort breitgemacht haben könnten, um ihm fürderhin den Kaffeegenuss zu vergällen, indem sie die Intensität der latent vorhandenen Magenschmerzen noch steigerten. Freilich, wach gehalten hätten ihn diese Schmerzen dann ganz ohne die zusätzliche Wirkung des Koffeins, aber sie hätten ihn auch von seiner Arbeit abgelenkt. Von seiner Arbeit, die ihn in letzter Zeit ohnehin ein bisschen vernachlässigt hatte. Nein, falsch, von seiner Arbeit, deretwegen er seine Familie in letzter Zeit vernachlässigt hatte. Nein, das stimmte auch nicht, drängte nur gerade in sein Gehirn und verdrängte damit die Angst vor Gastritis und Co, weil seine Frau ihm dies wiederholt vorgehalten hatte, bis er den Vorwurf quasi verinnerlicht hatte. Was er eigentlich dachte oder sich zu denken genötigt sah, war, dass er seine Arbeit in letzter Zeit ein bisschen hatte schleifen lassen. Da er jedoch Polizeiinspektor und kein Baumeister war, hatte das Schleifenlassen seine Arbeit nicht beseitigt, sondern nur aufgeschoben, weshalb sie sich jetzt wie ein Schutthaufen vor ihm auftürmte.