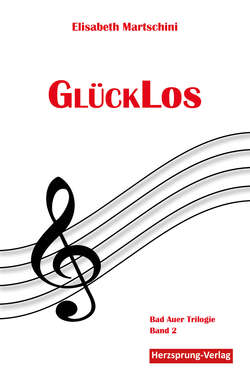Читать книгу GlückLos - Elisabeth Martschini - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Café Sisi
Оглавление„Die jungen Leute heutzutage wissen auch nicht mehr, was sich gehört“, entrüstete sich die alte Dame, die gemeinsam mit einem etwa ebenso alten Herrn an einem der runden Marmortischchen im Café Sisi saß. „Dieses Schmatzen ist ja unerträglich.“
Sichtlich angewidert wandte sie ihren Kopf mit der kunstvoll aufgesteckten Frisur vom hinteren Teil des Kaffeehauses ab und ihrem Gegenüber zu, das gerade im Begriff gewesen war, ihr etwas zu sagen. Etwas, das die alte Dame mit dem kritischen Gehör jedoch überhört hatte, weil sie vollauf damit beschäftigt gewesen war, die im Halbdunkel des Cafés knutschenden Jugendlichen mit Missachtung zu strafen.
„Dieser junge Mann“, begann das Gegenüber, Alois Hirschhauser mit Namen und Stammgast im Café Sisi, erneut und meinte damit ganz offensichtlich nicht sich selbst, wäre er doch schon vor zwanzig Jahren nur noch aus der Sicht eines 100-Jährigen tatsächlich jung zu nennen gewesen. „Dieser junge Mann, der immer im Café Sisi war“, setzte er noch einmal an, unterbrach sich jedoch sogleich selbst. „Ach, du erinnerst dich ja nicht an ihn“, murmelte er.
Ihm war nämlich noch deutlich eine Diskussion im Gedächtnis oder, in seinem Jargon, ein Gespräch, die respektive das die beiden Herrschaften eine gute Woche zuvor über die Abwesenheit eines gewissen Gastes im beziehungsweise vom Café Sisi geführt hatten, wobei die den Dativ nach sich ziehende Präposition von hier nicht aus Gründen der Besitzgier oder -anzeige hinterrücks den Genitiv zu meucheln im Sinn hatte, sondern allein der Abwesenheit geschuldet ist, die ja immer eine Abwesenheit von einem bestimmten Ort ist. In diesem Fall eben vom Café Sisi, in dem besagter Stammgast gerne oder zumindest oft verkehrt hatte, sofern man die zumeist schweigende Konsumation in einem Kaffeehaus mit Verkehr gleichsetzen konnte, und in dem Alois Hirschhauser gemeinsam mit der alten Dame mit dem empfindsamen Gehör saß.
„Der mit den langen Haaren und den traurigen Augen?“, überraschte ihn jetzt dieselbe Dame, die in Bad Au als Frau Hildegard Binsen, Pardon, Frau Doktor Hildegard Binsen bekannt war, da sie einst in jüngeren Jahren, die beinahe ebenso lange wie die des Herrn Hirschhauser zurücklagen, den Kurarzt Doktor Kurt Binsen geheiratet hatte. Nun hätte man vielleicht argumentieren können, dass sie nach dem Tod des Gatten mitsamt dessen nicht unerheblicher Pension auch seinen Doktortitel geerbt hatte. Dem war aber nicht so. Frau Doktor Binsen war sie schon lange vor dem Tod des Gemahls gewesen, wobei das Vernachlässigen des Binsen dem solcherart Säumigen gnädig verziehen wurde. Mangels eigenen Titels den des Mannes zu führen, war in Frau Doktor Binsens Augen oder Ohren ein pflegenswertes Relikt aus der guten alten Zeit, in der Frauen die Ausbildung an der Universität versagt, sich einen Erfolg versprechenden Mann zu angeln hingegen für jede von ihnen angesagt gewesen war.
Alois Hischhauser hatte sich mit diesem Problem nie konfrontiert gesehen, was nicht nur daran lag, dass er als ehemaliger Friseur einer universitären Ausbildung nicht bedurfte. Vielmehr hatte er Frau Doktor Binsen noch als Hildegard Bauernfeind kennengelernt und sich damit, vielleicht aber auch durch seine Liebenswürdigkeit und Loyalität gegenüber der nicht immer ganz einfachen Freundin, das Privileg erworben, selbst nach der Hochzeit weiterhin Hildegard sagen zu dürfen. Beklagenswerterweise hatte sich heutzutage vor allem in kleinstädtischen Gewerbe- und Gastronomiebetrieben die Unart eingeschlichen, jemanden zwar mit Herr oder Frau anzusprechen, dem aber nicht etwa den Nach-, sondern den Vornamen folgen zu lassen, als wäre ein nachgereihter Vorname nicht ein Widerspruch in sich. Wobei der Vorzug des Vornamens durch eine nachfolgende geschlechtsspezifische Anrede aufgehoben worden wäre, sich der Widerspruch aber eigentlich aus der förmlichen Anrede und dem unförmigen, nein, formlosen Vornamen ergab, weshalb also die Form Doktor Hildegard einen noch größeren Widerspruch dargestellt hätte.
Mit anderen Worten: Alois Hirschhauser hielt an alten Gewohnheiten fest, sprach seine Hildegard mit Hildegard und Petra Sandor, die gemeinsam mit ihrem Mann Istvan das Café Sisi betrieb, mit Fräulein an, wohl wissend, dass der jungen Frau – also Frau Sandor – eine andere Bezeichnung gebührt hätte. Aber im Kaffee- oder Gasthaus sagte man oder zumindest jedenfalls Herr Hirschhauser lieber „Ober“ und „Fräulein“. Da schmeckten der Kaffee und das Schnitzel einfach besser.
Jetzt blickte Alois Hirschhauser die ihm gegenübersitzende Hildegard Binsen erstaunt an. Ohne ihrerseits den Blick von ihrer Kaffeetasse zu heben, sagte die alte Dame: „Nein, ich erinnere mich nicht an ihn, sondern daran, dass du letzte Woche davon gesprochen hast, dass hier ein junger Mann mit langen Haaren und traurigen Augen war, weil ich mir dabei gedacht habe, dass diese Beschreibung eher auf eine Frau als auf einen Mann passt.“
„Habe ich lange Haare gesagt?“, wunderte sich Alois Hirschhauser. „Ich habe gesagt, längere Haare.“
„Na eben, nicht nur lange, sondern sogar längere Haare“, behaarte, nein, beharrte Hildegard Binsen.
„Längere Haare müssen doch noch lange nicht lang sein“, erklärte Herr Hirschhauser.
„Richtig“, stimmte Frau Doktor Binsen ihm jetzt zu, wobei der Sarkasmus in ihrer Stimme kaum zu überhören war, „genauso wie die ältere Generation beileibe nicht alt ist.“
„Na siehst du“, versuchte ihr Begleiter einzulenken, ohne seine Position aufgeben zu müssen, „genauso sind längere Haare auch nicht automatisch länger als lange Haare. Außerdem kann auch ein Mann lange Haare haben. Heutzutage ...“
Dieses Mal war es Hildegard Binsen, die ihn unterbrach. „Was ist denn nun mit diesem jungen Mann?“
„Gar nichts ist mit ihm“, sagte Herr Hirschhauser und fügte, als er den leicht irritierten Blick der Freundin spürte, rasch hinzu: „Nichts mehr. Er ist nämlich verstorben.“
„Was? Einfach so, wo er doch noch so jung war?“
„Ich weiß nicht, wie jung er war, jünger halt. Aber er ist nicht einfach so gestorben, sondern von einem Auto überfahren worden. Gar nicht weit vom Café Sisi.“ Und als müsste er sein Wissen über den Unfalltod des jüngeren Mannes mit den längeren Haaren rechtfertigen, stellte er fest: „Deshalb haben wir ihn hier seit Wochen nicht gesehen.“
„Das macht natürlich Sinn“, sagte Hildegard Binsen und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee.
„Ob das Sinn macht, weiß ich nicht“, entgegnete Herr Hirschhauser, „immerhin steht so ein Mensch doch mitten im Leben, hat einen Beruf und eine Familie. Und dann wird er plötzlich aus allem herausgerissen.“
„Ich meine doch nicht den Unfall“, schnaubte Frau Doktor Binsen, „sondern dass er deswegen nicht mehr hier ist.“
„Ach so“, sagte Alois Hirschhauser kleinlaut und widmete sich seinem Marmorguglhupf, den er heute statt der üblichen Torte bestellt hatte. Wenigstens hierbei an alten Traditionen festhaltend, trennte er mit der Gabel fein säuberlich die hellen von den dunklen Teigpartien. Eine liebe Gewohnheit aus seinen sehr jungen Jahren, auch Kindheit genannt.
„Woher weißt du überhaupt von dem Unfall?“, fragte Hildegard Binsen jetzt.
„Von meiner Enkelin, der Elfi. Die ist Therapeutin und betreut die Frau, die das Unfallfahrzeug gelenkt hat“, erklärte ihr Begleiter.
„Die das Unfallfahrzeug gelenkt hat“, äffte Frau Binsen, der heute mehr als eine Laus in den Kaffee gefallen sein musste, ihn nach. „Wie du heute sprichst, Pardon, wie du dich ausdrückst: Unfallfahrzeug und verstorben.“
„Nein, das Fahrzeug ist nicht ...“
„Ich weiß, dass das Fahrzeug nicht verstorben ist. Aber wieso braucht diese Frau eine Therapie? Ist sie bei dem Unfall auch verletzt worden?“
„Nein, ja, also von der Lenkerin des Unfallfahrzeugs spricht die Elfi immer. Das sagt man so. Und dass sie psychisch einen Schaden davongetragen hat. Sie kann nicht mehr arbeiten, weil sie diesen Mann gekannt hat. Deshalb kommt sie jetzt zur Elfi.“
Alois Hirschhauser blickte seine Freundin unsicher an, als wäre ihm selbst seine Rede nicht ganz durchsichtig. Vielleicht fürchtete er aber auch nur, dass er Hildegard Binsen mit einer unbeholfenen Formulierung aufs Neue verärgert hatte. Tatsächlich schienen sich die Falten auf der Stirn der alten Dame weiter vertieft zu haben.
„Weil diese Frau also versehentlich – es war doch sicherlich ein Versehen? – einen Bekannten überfahren hat, geht sie jetzt bei deiner Enkelin Elfriede in Therapie?“, fragte sie.
„Genau“, gab Alois Hirschhauser erleichtert zur Antwort, „sie ist nämlich Psychologin, die Elfi.“
Herrn Hirschhausers Erleichterung währte freilich nur kurz, denn für Hildegard Binsen war das Thema keineswegs abgeschlossen.
„Das hätte es früher nicht gegeben“, stellte sie fest, „Psychologen und so. Das haben wir alles nicht gebraucht.“
„Gegeben hat es die nicht“, stimmte Herr Hirschhauser ihr zu, „aber gebraucht hätten wir sie vielleicht schon manchmal. Damals nach dem Krieg zum Beispiel.“
„Papperlapapp, wenn wir sie gebraucht hätten, hätte es sie auch gegeben. Es gibt alles, wenn es gebraucht wird. Das heißt Marktwirtschaft!“
„Gar nicht wahr!“, begehrte Alois Hirschhauser auf. „Heute hätte ich zum Beispiel eine Herrentorte gebraucht, aber die ist aus, hat die Petra gesagt ...“
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Nicht in erster Linie, weil er statt Frau Sandor oder seinetwegen Fräulein Sandor schlicht Petra gesagt hatte. Das tat er im vertraulichen Gespräch mit seiner Hildegard nämlich ganz gerne, wenn er nicht gerade aus Versehen von der Piroschka sprach, sondern weil er mit dieser Bemerkung Öl ins Feuer gegossen zu haben befürchtete.
Doch vorerst warf ihm Frau Doktor Binsen nur einen Blick zu, als wäre er ein hoffnungsloser Dummkopf und nicht ernst zu nehmen. Dann seufzte sie und meinte schulterzuckend: „Sprechen wir über etwas anderes, zum Beispiel über Petra Jellacic.“
„Windsperger“, murmelte Alois Hirschhauser, der berechtigte Sorge hatte, dass heute jedes seiner Worte der hildegardschen Zensur unterworfen würde.
„Was sagst du?“, wollte seine Begleiterin denn auch sofort wissen.
„Ich habe nur gemeint, dass Petra Jellacic jetzt Windsperger heißt. Sie hat doch diesen ... diesen – wie heißt er noch einmal? – geheiratet.“
„Windsperger“, antwortete Hildegard Binsen sachlich korrekt.
„Natürlich, Windsperger, sonst würde die Petra ja nicht so heißen. Georg“, überlegte er dann, „heißt er nicht Georg?“
„Es spielt doch keine Rolle, wie er heißt. Außerdem hätte die Petra ja ihren Namen behalten können. Heutzutage ist das möglich. Wäre auch besser gewesen, als sich jetzt, kaum dass ich mir den alten Namen gemerkt habe, einen neuen geben zu lassen.“
„Na, da hat sie die ersten fünfunddreißig Jahre ihres Lebens Jellacic geheißen, nun kann sie doch die nächsten fünfunddreißig Windsperger heißen“, meinte Alois Hirschhauser.
„Zehn“, gab Hildegard Binsen zurück.
„Zehn was?“ Herr Hirschhauser schien nicht ganz bei der Sache zu sein. Außerdem ruhten seine Augen nicht mehr auf seiner lieben Hildegard.
„Zehn Jahre natürlich“, gab die liebe Hildegard scharf zur Antwort. „So lange dauert eine durchschnittliche österreichische Ehe heutzutage.“
„Eigentlich macht das nichts aus“, überlegte Alois Hirschhauser.
„Was heißt, es macht nichts aus?“, fragte Hildegard Binsen, die sich gerade mit der Hand an den Hinterkopf gegriffen hatte, irritiert und hielt in der Bewegung inne. Die Finger verblieben am Hinterkopf, wo sie gerade den Sitz der Haarnadeln überprüfen wollten, damit sich die zu einem kunstvollen Gebilde aufgetürmten weißen Strähnen nicht womöglich selbständig machten und medusenartig um den Kopf der alten Dame mit dem erheirateten Doktortitel schlängen. Was allein deshalb schon unerhört gewesen wäre, weil jene Zeiten, als man den Konjunktiv Präteritum des starken Verbs schlingen selbstverständlich zu gebrauchen gewusst hatte, definitiv noch um einiges weiter zurücklagen als die Tage, in denen man – oder eigentlich frau – sich einen Doktor- oder sonstigen Titel erheiraten hatte können. Weshalb das unselige Geschlängel also Frau Doktor Binsen noch nie zu Ohren gekommen und in der Folge darauf zu achten war, dass diese ganz bestimmt nicht jungfräulichen, vielleicht aber immerhin unschuldigen Ohren vor herunterfallenden Haarschlingen sicher wären.
Momentan schien an Hildegard Binsen aber ohnehin alles erstarrt zu sein, das ihren Kopf zierende Haarkunstwerk ebenso wie ihre Hand. Und übrigens auch der Blick, den sie auf Alois Hirschhauser gerichtet hielt.
„Wieso macht es nichts aus, dass eine Durchschnittsehe heutzutage nur zehn Jahre dauert? Meiner Meinung nach zeugt das von einem Verfall unserer gesellschaftlichen Werte“, hakte Hildegard Binsen nach und ließ den Arm samt Hand nun doch in Richtung Tischplatte sinken, wo selbstverständlich nicht der ganze Arm zu liegen kam, nicht einmal der ganze Unterarm, sondern nur die zarte Altdamenhand ab dem Handgelenk. Frau Doktor Binsen wusste schließlich, was sich gehörte.
Nur was sie gehört hatte, wusste sie trotz ihres heute ganz besonders empfindsamen Gehörs nicht oder zweifelte zumindest daran, dass sie richtig verstanden hatte. Deshalb die wiederholte Nachfrage.
Herr Hirschhauser gab trotzdem nur einmal darauf Antwort, sehr gemächlich und völlig unaufgeregt. „Dass dieser junge Mann, an den du dich nicht erinnern kannst oder willst, nicht mehr ins Café Sisi kommt, das macht nichts aus“, sagte er, „zumindest nicht für das Geschäft.“ Und weil das genau genommen immer noch keine Antwort auf die Frage nach dem Warum beziehungsweise Wieso der Hildegard Binsen, sondern bestenfalls die Beseitigung eines Missverständnisses war, fügte er hinzu: „Weil da gerade ein Ersatz für ihn hereingekommen ist.“ Und er deutete mit einem dezenten Kopfnicken oder -rucken zu dem Mann, der soeben das Lokal durchquert und sich an dem Tischchen beim Fenster niedergelassen hatte.
Petra Sandor hatte den neuen Gast ebenfalls bemerkt und trat, den Block für die Aufnahme der Bestellung in der Hand, an dessen Tisch. Der Block wäre für eine Tasse Kaffee und eine Mehlspeise – welcher Art auch immer – natürlich nicht unbedingt notwendig gewesen, aber die junge Frau Sandor schrieb Bestellungen grundsätzlich lieber auf, damit alles seine Ordnung hatte. So mochten es die Gäste des Café Sisi.
„Grüß Gott, was darf es denn sein ... Herr Inspektor?“, fragte sie und kratzte damit gerade noch die Kurve, denn sie hatte Franz Obermayer, seit 30 Jahren Polizeiinspektor in Bad Au, unter seiner neuen Haarpracht nicht sofort erkannt.
Hatte der Inspektor in den letzten Jahren nämlich versucht, seine beginnende Glatze, die er euphemistisch als Geheimratsecken bezeichnete, ohne sich doch erklären zu können, was unschöner Haarausfall mit in rotes Wachs eingepacktem Käse zu tun hatte – hatte er also versucht, seine Geheimratsecken, die freilich immer mehr Raum gefordert hatten, zu verstecken, indem er gewissenhaft die verbliebenen, umso längeren Haare darübergekämmt hatte – immer schön von hinten nach vorne –, erstrahlte er heute in beinahe üppiger Haartracht. Oder erstrahlte und glänzte gerade nicht, weil diese Haartracht oder -pracht das Kunstlicht des Café Sisi viel schlechter widerspiegelte als die glatte Kopfhaut.
„Eine Herrentorte und einen Mazagran, bitte“, sagte der ununiformierte Inspektor. Und wie zur Entschuldigung fügte er hinzu: „Ich bin ja schließlich nicht im Dienst“, wobei die Entschuldigung selbstverständlich nicht der Herrentorte galt, denn von einer solchen hätte sich der Inspektor selbst im Dienst genauso wenig abhalten lassen wie von einem Punschkrapferl oder einer Sachertorte. Wenigstens nicht in der Mittagspause. Sie, also die Entschuldigung, galt viel eher dem bestellten Rum im mit Eiswürfeln gekühlten Mokka, der den echten Mazagran erst zu einem solchen machte. Nachzulesen in – nein, nicht einmal mehr in der Getränkekarte guter Kaffeehäuser, mit Ausnahme des Café Sisi, sondern in Torbergs Tante Jolesch. In den gesammelten und mehrfach gedruckten Anekdoten, versteht sich.
Die hatte Inspektor Obermayer zwar nicht gelesen, dafür aber Petra Sandor als echte, das heißt als eine aus den Ländern der ehemaligen Donaumonarchie zugewanderte Österreicherin – Österreicherin mit Migrationshintergrund hieß das politisch korrekt, aber um eine politische oder sonstige Korrektheit hatte man sich in Bad Au selten gekümmert.
Petra Sandor als echte zugewanderte Österreicherin also hatte die Tante Jolesch gelesen, um sich nach ihrer Einwanderung oder Immigration der Integration und Assimilation zu widmen, das bedeutete, sich mittels Torberg und Tante darüber zu informieren, wie es hier so zuging in diesem Österreich. Dass der Autor in seinem Büchlein auf ein Zeitalter zurückgriff, in dem das Abendland noch nicht zwischen Nazismus und Kommunismus untergegangen war, tat dem Erfolg des Café Sisi keinen Abbruch. Eher im Gegenteil. Wo hätte man sonst einen Mazagran bestellen können, wie der Polizeiinspektor ihn gern genoss? Wo anders als im Café Sisi, das in anachronistischer Weise zwar das Café Franz Joseph abgelöst hatte, sich auf seinen Anachronismus jedoch einiges zugutehielt, weshalb es hier neben dem Mazagran auch die Melange und den Mokka zu bestellen gab. Oder notfalls noch den kleinen Schwarzen. Aber eben keinen Cappuccino oder Espresso. Nur zum Caffè Latte hatten die Sandors sich überreden lassen, weil in Zeiten der Laktoseunverträglichkeit dennoch die Nachfrage nach Milch im Kaffee so gestiegen war, dass Melange und Häferlkaffee sie nicht mehr zu befriedigen vermochten. Weil eben alles Verbotene beinahe automatisch in seinem Wert steigt. Dementsprechend hatte so ein Caffè Latte seinen Preis, der sich zwar nicht in Euro, umso mehr jedoch in einem verächtlichen Gesichtsausdruck Petra Sandors niederschlug, wenn sie dieses Getränk einem Gast servierte, der verwegen genug gewesen war, solcherlei zu bestellen, wobei diese Gäste in aller Regel junge Frauen waren. Oder ältere Frauen. Oder, ganz selten, sogar alte Frauen, die glaubten, etwas Neues ausprobieren zu müssen und hinterher rasch zur klassischen Kaffeeauswahl des Café Sisi zurückkehrten. Weil so ein echter Kaffee halt doch nur ein gewisses Maß an Milch verträgt. Übermaß wäre verkehrt.
Indem es seiner Zeit also ein bisschen hinterher war, hatte das Café Sisi anderen Kaffeehäusern etwas voraus. Vor allem hatte Petra Sandor sämtlichen Einheimischen, wie wir die geborenen im Gegensatz zu den echten Österreichern nennen wollen, etwas voraus. Denn, seien wir ehrlich, welcher Einheimische hätte schon eine Staatsbürgerschaftsprüfung bestanden? Aber das ist eine andere Geschichte.
Von Kaffee jedenfalls verstand Petra Sandor etwas und nur darauf kam es hier an.
Nicht verstanden hatte Hildegard Binsen oder war zumindest mit der Bemerkung ihres Gegenübers nicht ganz einverstanden, hatte sie im Unterschied zu ihrem Begleiter, einem pensionierten Friseur, doch auf den ersten Blick erkannt, worum es sich hier handelte. Nein, nicht Inspektor Obermayer, da hätte man der Höflichkeit halber doch „um wen“ gesagt. Den Inspektor erkannte auch Hildegard Binsen erst auf den zweiten, dritten oder sonst wievielten Blick. Aber das Toupet hatte sie bemerkt, weil es nicht exakt dieselbe Farbe wie der obermayersche Haarrest hatte.
„Der ist doch nicht mehr jung“, empörte sie sich. „Und sag jetzt nicht, dass er es im Gegensatz zu uns allemal sei. Nur weil ich im 79. Lebensjahr stehe ...“
„Im achtzigsten, liebe Hildegard, im achtzigsten“, warf Alois Hirschhauser ein und erntete dafür einen vernichtenden Blick.
„Gut, also nur, weil ich 79 Jahre zähle“, fuhr sie in Verkennung der Tatsache, dass es Alois Hirschhauser gewesen war, der ihre 79 Jahre gezählt hatte, fort, „ist nicht jeder, der jünger ist, automatisch als jung zu bezeichnen. Wenn das nämlich deine Auffassung von jung ist, ist es kein Wunder, dass ich mich nicht an deinen jungen Mann von vorher erinnern kann.“
„Vorher war er ja auch gar nicht mehr da. Das ist schon länger her, bestimmt drei oder vier Wochen“, erwiderte Herr Hirschhauser, womit er die Situation natürlich nicht entschärfte. Weil er seine Hildegard aber gut genug kannte, um zu wissen, dass er sie nicht mit Spitzfindigkeiten auf die Palme bringen sollte, weil alte Damen da naturgemäß nur schwer wieder herunterkommen, erklärte er versöhnlich: „Aber du hast natürlich recht. Der gute Mann dort drüben, der mir im Übrigen vage bekannt vorkommt, ist wirklich nicht mehr ganz jung. Der, von dem ich gesprochen habe, war mit Sicherheit zehn oder gar zwanzig Jahre jünger.“
„Ah ja“, sagte Hildegard Binsen und der Ton ihrer Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich nicht weiter für fremde Herren interessierte, mochten die nun alt oder jung oder auch nur älter sein.
Auch Inspektor Obermayer war nicht an Männern interessiert oder hätte es doch niemals zugegeben. Das heißt, dienstlich war er natürlich an ihnen interessiert, wenn sie nämlich eine Straftat begingen. Denn wenn einer den anderen eine Treppe hinunterfallen ließ oder ihm den Schädel einschlug, lag das sehr wohl in seinem Interessensbereich. Oder hätte es jedenfalls müssen, sofern die Straftat und ihre Aufklärung nicht zufällig gerade in seine Urlaubszeit fielen. Da selbst ein Inspektor der Bad Auer Polizei nur maximal sechs Wochen Urlaub im Jahr hatte, eine Straftat inklusive Aufklärung aber in der Regel länger dauerte, wobei die Aufklärung im Normalfall wesentlich mehr Zeit als das Verbrechen in Anspruch nahm, obwohl – oder gerade weil? – an ihr, Kripo sei dank, viel mehr Menschen beteiligt waren, hatte Inspektor Obermayer eigentlich mit jedem in Bad Au verübten Verbrechen zu tun. Da lobte er sich die Unfälle. Nach der Beweisauf- und der Zeugeneinvernahme waren die meist sehr schnell erledigt. Zumindest für ihn.
So hatte er auch bald nach dem letzten schwereren, leider tödlichen Unfall seinen wohlverdienten Urlaub antreten können. Dabei muss der Fairness halber hinzugefügt werden, dass ihn dieser Unfall nicht ganz kalt gelassen hatte. Immerhin erwischte es in Bad Au nicht jeden Tag jemanden, den man, zumindest nach seinem Tod, gekannt zu haben meinte.
„Tut mir leid“, sagte Petra Sandor, „die Herrentorte ist aus. Darf’s stattdessen vielleicht eine Sachertorte sein?“
Inspektor Obermayer seufzte. Da wollte man sich im Urlaub einmal etwas gönnen und dann machte einem die fehlende Schokoladencreme einen Strich durch die Rechnung. Denn es war natürlich die Schokoladen- oder, um es korrekt zu sagen, die Pariser Creme, die den gravierenden Unterschied machte. Dabei war es eigentlich seltsam, dass ausgerechnet das Mehr an Schokolade die Herrentorte zu einer solchen machte, schrieb man die besondere Liebe zu jener Süßigkeit doch meist den Damen zu. Eine Damentorte gab es allerdings nicht, zumindest nicht im Café Sisi. Wie um diesen Mangel auszugleichen, enthielt die Sachertorte ebenfalls mehr als genug Schokolade in Teig und Glasur, sodass sie mit Fug und Recht als für Damen geeignet durchgehen konnte. Für Damen oder alle anderen Naschkatzen und Naschkater, also auch für Inspektor Obermayer, der insgeheim dachte, dass die Marillenmarmelade der Sachertorte seiner Figur ohnehin zuträglicher – oder eigentlich weniger zuträglich – wäre als die herrliche Schokoladencreme, weshalb er grummelnd seine Zustimmung zur Ersatztorte gab.
Womit nun alle sich im Moment im Café Sisi aufhaltenden Gäste mehr oder weniger zufriedengestellt waren. Denn nachdem die beiden tatsächlich jungen Leute im hinteren Teil des Kaffeehauses zu knutschen aufgehört hatten und einander nur noch verliebt anblickten, war sogar Frau Doktor Binsen zufrieden. Soweit dieses Adjektiv überhaupt auf sie anwendbar war. Und dass die drei fraglos alten Damen, die unweit von Alois Hirschhauser und Hildegard Binsen einträchtig um eines der Tischchen mit runder Marmorplatte saßen, zufrieden waren, konnte ein aufmerksamer Beobachter an ihren unter grauen, violetten und grauvioletten Haaren hervorlächelnden Gesichtern ablesen. Irgendjemand musste die Herrentorte ja aufgegessen haben.
Zu den aufmerksamen Beobachtern zählte der Inspektor an diesem seinem Urlaubstag allerdings nicht. Er erweckte sogar ein bisschen den Eindruck, als wollte er nichts anderes wahrnehmen als Kaffee, Mehlspeise und die Lokalzeitung, die er sich jetzt von dem einzigen Holztischchen im ansonsten mit Marmor ausgestatteten Café holte und vor sich ausbreitete. Die Nachrichten der vergangenen Woche in aller Ruhe nachzulesen, war im Urlaub wesentlich besser, als sie hautnah miterleben zu müssen.