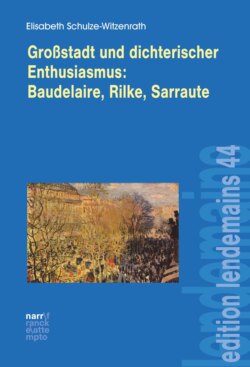Читать книгу Großstadt und dichterischer Enthusiasmus Baudelaire, Rilke, Sarraute - Elisabeth Schulze-Witzenrath - Страница 10
d) Ein Beispiel für künstlerischen Enthusiasmus in der Großstadt: Le Peintre de la vie moderne
ОглавлениеIn der Exposition universelle (1855) war Eugène Delacroix als der Maler gewürdigt worden, der Baudelaires Vorstellungen von Kunst verwirklichte, weil seine Bilder zu historischen, religiösen und literarischen Themen die „beaux jours de l’esprit“ spiegelten und den „surnaturalisme“ offenbarten1. Die Darstellung der Großstadt und des modernen Lebens sah Baudelaire wenige Jahre später bei dem Graphiker und Maler Constantin Guys verwirklicht.
Seit 1859 arbeitete er an einem Essay über Constantin Guys, ausweislich seiner Korrespondenz besonders intensiv im Spätsommer und Herbst 18612, als das Prosagedicht Les Foules entstand, weshalb es zahlreiche Übereinstimmungen zwischen beiden Texten gibt, die sich gegenseitig erhellen. Der Essay, den er im Laufe von fast vier Jahren erfolglos verschiedenen Zeitungen anbot und wiederholt umschrieb, sollte nach seinen Plänen auch „peintres de mœurs“ des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts behandeln. Während der Umarbeitungen beschränkte er sich jedoch bald auf Guys, und als endlich Ende November/Anfang Dezember 1863 die definitive Fassung im Figaro erschien, wo man ein „manuscrit ayant trait surtout aux mœurs parisiennes“ gewünscht hatte3, trug sie den Titel Le Peintre de la vie moderne4. In ihr weist Baudelaire im Rahmen seiner Theorie von der „modernité“ des Schönen am Beispiel von Guys nach, dass es einen modernen künstlerischen Enthusiasmus in der Großstadt gibt.
Nach einer grundsätzlichen Einleitung mit seinen jüngsten Überlegungen zum „beau éternel“ und zur „modernité“ erörtert er zunächst die für die Genreskizze („croquis de mœurs“) erforderlichen schnellen Techniken und geht dann zur Charakterisierung des dazugehörigen Künstlertyps über. Dieser „peintre de mœurs“ ist nach seiner Überzeugung ein „génie d’une nature mixte“ mit einem großen Anteil an literarischem Verstand („une bonne partie d’esprit littéraire“), der sich manchmal als Dichter („poète“) erweist, öfter aber dem Romancier oder Moralisten nahesteht, weil er ein „observateur, flâneur, philosophe“ ist, oder wie immer man ihn nennen wolle. Unter der Kapitelüberschrift „L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant“ folgt sodann das Idealporträt des Künstlers Guys5.
M.G., wie Baudelaire ihn auf eigenen Wunsch nennt, ist kein ausschließlich auf sein Metier ausgerichteter Künstler, sondern ein „homme du monde“, ein Vielgereister, der an allem interessiert ist, was auf der Welt geschieht, ein wahrer „citoyen spirituel de l’univers“6. Seine Kunst nimmt ihren Ausgang von der Wissbegier und der Neugier auf den Menschen und die Welt: „la curiosité peut être considérée comme le point de départ de son génie“7. Um seinen Wissensdurst und seine Aufgeschlossenheit zu illustrieren, greift Baudelaire zu Poes Erzählung The Man of the Crowd, deren Erzähler und Protagonist nach schwerer Krankheit mit neu erwachtem Interesse das Leben um sich herum wahrnimmt und schließlich einem Unbekannten folgt, dessen Gesicht ihn fasziniert hat:
Derrière la vitre d’un café, un convalescent, contemplant la foule avec jouissance, se mêle, par la pensée, à toutes les pensées qui s’agitent autour de lui. Revenu récemment des ombres de la mort, il aspire avec délices tous les germes et tous les effluves de la vie; comme il a été sur le point de tout oublier, il se souvient et veut avec ardeur se souvenir de tout. Finalement, il se précipite à travers cette foule à la recherche d’un inconnu dont la physionomie entrevue l’a, en un clin d’œil, fasciné. La curiosité est devenue une passion fatale, irrésistible.8
Die Rekonvaleszenz der Poeschen Figur wird zum Schlüsselbegriff, mit dessen Hilfe Baudelaire den Geisteszustand M.G.s und des künstlerischen Genies überhaupt darlegt.
Rekonvaleszenz sei wie eine Rückkehr zur Kindheit, erklärt er, denn jemand, der, von schwerer Krankheit genesen, sich wieder dem Leben und der Welt zuwende, empfinde wie ein Kind:
[…] la convalescence est comme un retour vers l’enfance. Le convalescent jouit au plus haut degré, comme l’enfant, de la faculté de s’intéresser vivement aux choses, même les plus triviales en apparence. (S. 690)
Für das Kind ist alles neu, weshalb es ständig „trunken“ ist und sich von Natur aus in einem ekstatischen Zustand befindet:
L’enfant voit tout en nouveauté; il est toujours ivre. […] C’est à cette curiosité profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantements de la beauté embellie par la toilette. (Ebd.)
Das Neue und Andere bewirkt nämlich ein intensives Erleben und eine geschärfte Wahrnehmung ganz wie im „état exceptionnel“. Der Freude, mit der das Kind Formen und Farben aufnimmt, gleicht aber die Inspiration des Künstlers9, ja, die Kreativität des künstlerischen Genies ist für Baudelaire die willentlich wiedergefundene Erlebnisfähigkeit der Kindheit:
[…] le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme de matériaux involontairement ramassée. (Ebd.)
Beim Künstler gesellt sich zur Intensität des Erlebens eine entwickelte und starke Vernunft und eine ebensolche Ausdrucksfähigkeit, die ihm eine geordnete Wiedergabe seiner Wahrnehmungen ermöglichen. Constantin Guys ist für Baudelaire in diesem Sinne ein beständiger „Rekonvaleszent“ und zugleich ein „homme-enfant“, der die Fähigkeit besitzt, das Leben jederzeit in seiner ganzen Ursprünglichkeit in sich aufzunehmen:
Je vous priais tout à l’heure de considérer M.G. comme un éternel convalescent; pour compléter votre conception, prenez-le aussi pour un homme-enfant, pour un homme possédant à chaque minute le génie de l’enfance, c’est-à-dire un génie pour lequel aucun aspect de la vie n’est émoussé. (S. 691)
Nach dieser viel zitierten Definition Baudelaires ist das Genie von Natur aus im höchsten Maße interessiert und offen für die Welt in allen ihren Erscheinungsformen und bezieht aus der besonderen Intensität dieses Erlebens seine künstlerische Kreativität. Seine Empfänglichkeit für Sinneseindrücke aller Art ist der des Rekonvaleszenten und des Kindes vergleichbar, die die Dinge mit wieder erwachter Lebensfreude und mit Neugier betrachten und aus diesem intensiven Erleben ein besonderes Glücksempfinden ziehen. Dieser Feststellung liegt die Erfahrung zugrunde, dass unsere Wahrnehmung durch Gewöhnung an Intensität verliert. Das künstlerische Genie ist aufgrund seiner Anlage davon ausgenommen und es ist imstande, die ursprüngliche Lebendigkeit der Wahrnehmung auch beim Rezipienten wiederherzustellen. Diese ungewöhnliche Begriffsbestimmung, die sich perfekt in Baudelaires ästhetisches System des künstlerischen „état exceptionnel“ einfügt, hat ihren Ursprung in der empiristischen englischen Literaturkritik, für die insbesondere Coleridge steht.
Coleridge hat wiederholt die Fähigkeit des Dichters hervorgehoben, mit seiner Phantasie den alltäglichen, farb- und glanzlosen Anblick der Welt zu überwinden und alles in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. In seiner Biographia literaria beschreibt er, auf welche Weise ihn in seiner Jugend ein Gedichtvortrag von Wordsworth beeindruckt habe:
It was the union of deep feeling with profound thougt; the fine balance of truth in observing with the imaginative faculty in modifying the objects observed; and above all the original gift of spreading the tone, the atmosphere and with it the depth and height of the ideal world around forms, incidents, and situations, of which, for the common view, custom had bedimmed all the lustre, had dried up the sparkle and the dew drops.10
Und weiter schildert er das geniale poetische Vorgehen von Wordsworth:
„To find no contradiction in the union of old and new; to contemplate the Ancient of days and all his works with feelings as fresh, as if all had then sprang forth at the first creative fiat; characterizes the mind that feels the riddle of the world, and may help to unravel it. To carry on the feelings of childhood into powers of manhood; to combine the child’s sense of wonder and novelty with the appearances, which every day for perhaps forty years had rendered familiar;
With sun and moon and stars throughout the year,
And man and woman;
This is the character and privilege of genius, and one of the marks which distinguish from talents. […]“ (S. 80f.)
Altes und Neues zu verbinden, das im Alltag Verbrauchte mit den frischen Gefühlen des ersten Tages zu betrachten, in der Stärke des Erwachsenen kindliches Fühlen wieder aufleben zu lassen, lang vertrauten Dingen mit dem Staunen und der Neugier des Kindes zu begegnen – das macht für ihn das Genie aus im Unterschied zum bloßen Talent. Der Gedanke vom ‚kindlichen Blick auf die Welt‘ war eine von Coleridges Lieblingsideen, die er mehrfach geäußert hat11. Er fährt dann fort und erläutert die angestrebte „freshness“ der Eindrücke mit der Situation der – geistigen wie körperlichen – Rekonvaleszenz:
„And therefore is it the prime merit of genius and its most unequivocal mode of manifestation, so to represent familiar objects as to awaken in the minds of others a kindred feeling concerning them and that freshness of sensation which is the constant accompaniment of mental, no less than of bodily, convalescence. […]“ (S. 81)
Es ist kaum vorstellbar, dass Baudelaire von diesen Äußerungen Coleridges keine Kenntnis gehabt haben sollte, als er seine Beschreibung des künstlerischen Genies Guys verfasste. Rätselhaft bleibt freilich auch hier wieder der Weg, wie er an sie gelangt sein könnte. George T. Clapton hält seine Definition des Genies für nichts anderes als eine Verallgemeinerung von De Quinceys Äußerungen in Suspiria de profundis und Afflictions of childhood12. Gilman führt zusätzlich Delacroix an13. Freilich ist an den von ihr genannten Stellen nie direkt von der Kindheit die Rede wie bei Coleridge, vom Vergleich mit der Rekonvaleszenz ganz zu schweigen. Allenfalls denkbar wäre wieder eine Vermittlung über Poe, der immerhin Coleridges „novelty“ gründlich überdacht hat14 und in The Man of the Crowd die Rekonvaleszenz erzählerisch in Szene gesetzt hat15. Man bleibt aber wohl auf Vermutungen angewiesen16.
Baudelaire setzt dann die Charakterisierung von Guys mit Hilfe zeittypischer Begriffe fort. Auch einen Dandy würde er Guys gern nennen, weil er mit diesem die tiefgründige Einsicht in den Lauf der Welt teilt. Doch der Dandy strebt nach „insensibilité“, während M.G. die Leidenschaft liebt, ja geradezu besessen ist von einem unstillbaren Drang, „de voir et de sentir“:
Je le nommerais volontiers un dandy, et j’aurais pour cela quelques bonnes raisons; car le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout le mécanisme moral de ce monde; mais, d’un autre côté, le dandy aspire à l’insensibilité, et c’est par là que M.G., qui est dominé, lui, par une passion insatiable, celle de voir et de sentir, se détache violemment du dandysme. Amabam amare, disait saint Augustin. „J’aime passionnément la passion“, disait volontiers M.G. (S. 691)
Ähnliches gilt für eine Bezeichnung als Philosoph17, denn Guys liebt zu sehr die „choses visibles, tangibles, condensés à l’état plastique“, um sich für das Reich der metaphysischen Dinge erwärmen zu können. Es bleibt die Charakterisierung als „moraliste pittoresque“ nach Art La Bruyères übrig.
Auf diesen allgemeineren Teil folgt der spezielle, der sich mit Guys’ Verhältnis zum Leben in der Großstadt beschäftigt und in dessen Mittelpunkt – getreu dem Bild des „peintre de mœurs“ – das Verhältnis zur Menschenmenge gerückt wird. Schon in der Kapitelüberschrift war Guys in Anspielung auf den Titel der Poeschen Erzählung als „homme des foules“ bezeichnet worden. Bei Poe ist der „man of the crowd“ jedoch ein alter Mann, dem der Erzähler eine Nacht und einen Tag lang auf seiner Suche nach Menschen durch die Straßen der Stadt folgt, bevor er begreift, dass der Alte „the type and the genius of deep crime“ ist, der nicht allein sein kann18. Indem Baudelaire die Titelbezeichnung auf den Künstler Guys anwendet, dessen Verhalten demjenigen von Poes Erzähler gleicht, spielt er – wie übrigens schon Poe – mit den beiden Erzählebenen und deutet den „homme des foules“ im Sinne der Wahrnehmungsfähigkeit und Kreativität des Künstlers um, nicht ohne die satanische Beimischung der Figur des Poeschen Alten beizubehalten.
Guys’ Verhältnis zur Menschenmenge beschreibt er darauf in aller Ausführlichkeit, wobei er noch stärker auf eine poetische und bildhafte Ausdrucksweise setzt als in Les Foules.
La foule est son domaine, comme l’air est celui de l’oiseau, comme l’eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c’est d’épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné, c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L’observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. L’amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l’amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables; comme l’amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. (S. 691f.)
Die Menge ist Guys’ Lebenselement wie die Luft das des Vogels und das Wasser das des Fisches. Seine Leidenschaft und sein Bestreben ist es, in ihr aufzugehen („épouser la foule“). Als vollkommener Flaneur und leidenschaftlicher Beobachter („parfait flâneur“, „observateur passionné“) sucht er sich seine Heimstatt in ihrer wogenden Zahl, ihrer bewegten Flüchtigkeit und ihrer Unendlichkeit, die er genießt. Mit „une immense jouissance“, „le nombre“, „l’infini“ verwendet Baudelaire hier wieder Begriffe aus seinen Beschreibungen ekstatischer Zustände, „le fugitif“ verweist dazu auf das moderne Schöne. Das macht offenkundig, dass Guys inmitten der Menschenmenge den künstlerischen Enthusiasmus sucht. Deshalb wird er auch ein „parfait flâneur“ genannt, womit Baudelaire ihn vom gewöhnlichen Flaneur absetzt, der, wie man im Livre des cent-et-un erfahren konnte, die Menge aufsucht, weil er sie zum Leben braucht und ohne ihre ständige Bewegung vor Langeweile vergeht:
Le voyez-vous mon flâneur, le parapluie sous le bras, les mains croisées derrière le dos; comme il s’avance librement au milieu de cette foule dont il est le centre, et qui ne s’en doute pas! Tout, autour de lui, ne parait marcher, courir, se croiser, que pour occuper ses yeux, provoquer ses réflexions, animer son existence de ce mouvement loin duquel sa pensée languit. […] Entouré de gens qui ont l’air de poursuivre, pendant toute la journée, un quart d’heure qu’ils ont perdu le matin, il est maître de son temps et de lui-même; il savoure le plaisir de respirer, de regarder, d’être calme au milieu de cette agitation empressée; de vivre enfin […]19
Guys’ Motiv ist hingegen, wie schon beim Dichter, der „implacable appétit d’émotion, de connaissance et de beauté“, aus dem sich der künstlerische Enthusiasmus nährt und das Werk entsteht20. Dieses Ziel unterscheidet ihn vom „pur flâneur“, der das bloße „plaisir fugitif de la circonstance“ sucht – ein Unterschied, der gern übersehen wird:
Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? À coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance.21
Der „observateur passionné“, wie Guys zusätzlich genannt wird, erinnert wieder an die Leidenschaft des Beobachtens beim Erzähler von Balzacs Facino Cane und damit an eine weitere großstädtische Leitfigur der Zeit22. Guys’ „passion insatiable […] de voir et de sentir“ hatte Baudelaire zuvor schon gerühmt.
Guys’ Eintauchen in die Menschenmenge wird in weiteren Bildern und Vergleichen ausgeführt, zunächst in Reisebildern, die seine Aufgeschlossenheit für alles Neue veranschaulichen: In der Fremde zu sein und sich doch überall zuhause zu fühlen, sich mitten in der Welt zu befinden und doch verborgen zu bleiben, das seien die Freuden solch unabhängiger, leidenschaftlicher Geister, die immer die Distanz des Beobachters wahren, dem Fürsten gleich, der sein Incognito genießt. Dann folgen die zum Teil schon aus Les Foules bekannten Metaphern und Vergleiche erotischer und verwandtschaftlicher Art, „l’amateur“ und „sa famille“ („L’amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l’amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables“) und das bereits erwähnte „épouser“ („Sa passion et sa profession, c’est d’épouser la foule“). Sie erreichen hier jedoch nicht den Intensitätsgrad, den sie in Les Foules hatten („cette ineffable orgie“, „cette sainte prostitution de l’âme“). Stattdessen kommen moderne technische Vergleiche für das spannungsvolle Verhältnis von Menge und darstellendem Künstler hinzu:
Ainsi l’amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d’électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule; à un kaléidoscope doué d’une conscience, qui à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce de tous les éléments de la vie. (S. 692)
Das „immense réservoir d’électricité“ ist die unerschöpfliche Inspirationsquelle, welche die Menge als eine den Enthusiasmus fördernde Umgebung und als Themenreservoir darstellt, während Guys selbst mit einem riesigen Spiegel und einem mit Bewusstsein versehenen Kaleidoskop verglichen wird, das mit jeder Bewegung die Vielfalt und Schönheit des Lebens wiedergibt. Die Vergleiche mit Spiegel und Kaleidoskop23 unterstreichen, dass der Maler ein der äußeren Realität zugewandter Augenmensch ist, der die „choses visibles, tangibles, condensés à l’état plastique“ liebt und sie wiedergibt, wie sie sich ihm zeigen. Der Dichter in Les Foules lebte dagegen vor allem in und von seiner Phantasie, mit deren Hilfe er den Menschen ergründete („entrer dans le personnage de chacun“). Das lässt die erotischen Metaphern in seinem Fall angebrachter erscheinen. Grundsätzlich gleichen sich jedoch Maler wie Dichter in ihrer künstlerischen Hingabe an die Menge und im Enthusiasmus, den diese in ihnen entfacht.
Der Augenmensch in Guys wird auch erkennbar, wenn beschrieben wird, wie er die Schönheit der Großstadt und ihrer Menschen wahrnimmt und wie er darüber in den enthusiastischen Zustand gerät. Kaum ist er am Morgen erwacht, stürzt er sich in das taghelle Leben der Großstadt.
„Quel ordre impérieux! quelle fanfare de lumière! […] Que de choses éclairées j’aurais pu voir et que je n’ai pas vues!“ Et il part! et il regarde couler le fleuve de la vitalité, si majestueux et si brillant. Il admire l’éternelle beauté et l’étonnante harmonie de la vie dans les capitales, harmonie si providentiellement maintenue dans le tumulte de la liberté humaine. Il contemple les paysages de la grande ville, paysages de pierre caressés par la brume ou frappés par les soufflets du soleil. Il jouit des beaux équipages, des fiers chevaux, de la propreté éclatante des grooms, de la dextérité des valets, de la démarche des femmes onduleuses, des beaux enfants, heureux de vivre et d’être bien habillés; en un mot de la vie universelle. Si une mode, une coupe de vêtement a été légèrement transformée, si les nœuds de rubans, les boucles ont été détrônés par les cocardes, si le bavolet s’est élargi et si le chignon est descendu d’un cran sur la nuque, si la ceinture a été exhaussée et la jupe amplifiée, croyez qu’à une distance énorme son œil d’aigle l’a déjà deviné. (S. 692f.)
Die einleitende „fanfare de lumière“ und die „choses éclairées“ kündigen die Nähe der Ekstase an. Die Wendungen „Il admire“, „Il contemple“ und „Il jouit“ benennen nacheinander das Staunen, die ebenso intensive wie präzise Wahrnehmung in diesem Zustand und das Genießen der Schönheit, Vielfalt und Buntheit, die sich vor den Augen des Künstlers entfaltet. Er bewundert die „ewige Schönheit“ des großstädtischen Lebens und entdeckt im „Tumult der menschlichen Freiheit“ die von der Vorsehung garantierte „überraschende Harmonie“24. Zugleich genießt er die sichtbare „moderne“ Schönheit der Gespanne und der stolzen Pferde, der korrekten Bediensteten, das Auftreten sich wiegender Frauen und lebensfroher schöner Kinder. Keine noch so geringe Neuerung der Mode entgeht seinem Blick25. Aber er betrachtet auch sinnend die „Landschaften“ der Stadt, ihre „paysages de pierre caressés par la brume ou frappés par les soufflets du soleil“ – alles, was sich dem Auge bietet, nimmt er beglückt wahr. Schließlich zeigt Baudelaire an einem konkreten Geschehen, wie die Ekstase in den schöpferischen Enthusiasmus umschlägt und die Wahrnehmung des Künstlers sich zur Vorstellung eines künftigen Werkes ordnet:
Un régiment passe, qui va peut-être au bout du monde, jetant dans l’air des boulevards ses fanfares entraînantes et légères comme l’espérance; et voilà que l’œil de M.G. a déjà vu, inspecté, analysé les armes, l’allure et la physionomie de cette troupe. Harnachements, scintillements, musique, regards décidés, moustaches lourdes et sérieuses, tout cela entre pêle-mêle en lui; et dans quelques minutes, le poème qui en résulte sera virtuellement composé. Et voilà que son âme vit avec l’âme de ce régiment qui marche comme un seul animal, fière image de la joie dans l’obéissance! (S. 693)
Der Enthusiasmus entzündet sich an einem Regiment, das zufällig vorbeimarschiert und sich seinerseits, wie die festliche Menschenmenge in Fusée I, in einem ekstatischen Rausch befindet, in dem aus den Vielen eine Einheit geworden ist: „ce régiment qui marche comme un seul animal, fière image de la joie dans l’obéissance!“ Alle sicht- und wahrnehmbaren Details dieses Auftritts nimmt Guys „pêle-mêle“ in sich auf, und bildet binnen weniger Minuten aus ihnen ein virtuelles „poème“. „Poème“ ist hier Metapher für die Idee des Kunstwerks, die „idée génératrice“, die im Enthusiasmus entsteht.
Der Szene liegt ein doppeltes ekstatisches Erlebnis zugrunde, das des Künstlers und das des Regiments. Diese Verdoppelung ist nicht zwingend, doch ist der Enthusiasmus mitsamt dem aus ihm resultierenden Kunstwerk die genuine Form, in der ein Künstler am Leben und an der Ekstase Anderer Anteil nimmt. Die Verdoppelung lässt klar den Unterschied der Ekstasen erkennen: auf der einen Seite die spirituelle Ekstase des nachempfindenden Künstlers, auf der anderen der animalische Rausch des marschierenden Regiments. Entscheidend ist der Gegenstand, zu dem die Seele sich jeweils erhebt oder hinabsinkt: „Et voilà que son âme vit avec l’âme de ce régiment“, „ce régiment qui marche comme un seul animal“. Diesen Unterschied der Ekstasen hat Baudelaire immer wieder betont26.
Am Abend dann, wenn Andere sich von der Mühsal des Tages erholen, lässt Guys in demselben Zustand der Begeisterung, in den ihn der Anblick der Dinge versetzt hat – „dardant sur une feuille de papier le même regard qu’il attachait tout à l’heure sur les choses“ – das Gesehene auf dem Papier wieder erstehen:
Maintenant, à l’heure où les autres dorment, celui-ci est penché sur sa table, dardant sur une feuille de papier le même regard qu’il attachait tout à l’heure sur les choses, s’escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir l’eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s’il craignait que les images ne lui échappent, querelleur quoique seul, et se bousculant lui-même. Et les choses renaissent sur le papier, naturelles et plus que naturelles, belles et plus que belles, singulières et douées d’une vie enthousiaste comme l’âme de l’auteur. La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux dont la mémoire s’est encombrée se classent, se rangent, s’harmonisent et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d’une perception enfantine, c’est-à-dire d’une perception aiguë, magique à force d’ingénuité!27
Das geht nicht ohne heftigen Kampf mit Bleistift, Feder und Pinsel und auch mit sich selbst ab in dem eifrigen Bemühen, die gesehenen Bilder nicht zu verlieren. Und die Dinge werden auf dem Papier schöner und natürlicher wiedergeboren, als sie in der Wirklichkeit waren, lebendig wie die enthusiastische Seele ihres Schöpfers. Schließlich ist das von der Phantasie geschaffene Bild der Wirklichkeit abgerungen und die Vielzahl der von einer kindlich unverbrauchten, magischen Wahrnehmung aufgenommenen Eindrücke zu einem harmonischen und idealen Ganzen geordnet.
Die Darstellung von Guys’ Inspiration und Schaffen zeigt noch einmal das Wirken der Phantasie beim Maler, wo sie, anders als beim Dichter, nicht schon in der Wahrnehmungsphase, sondern erst in der Phase der Komposition, der „idée génératrice“ bzw. der „fantasmagorie“, aktiv wird, wenn sie die Wirklichkeit ordnet und über sich hinauswachsen lässt. Ansonsten deckt sich das Erleben und Verhalten des Malers in der Menschenmenge mit dem des Dichters in Les Foules. Eine Darstellung des enthusiastischen Miterlebens des Künstlers, also der doppelten Ekstase wie hier, ist freilich eher im sprachlichen Medium und damit dem Dichter möglich, zumal dem Lyriker, der in der ersten Person spricht. So hat Baudelaire in Le Cygne neben den Gegenständen des melancholischen Erlebnisses auch die Entstehung des Gedichts und den Moment seines poetischen Enthusiasmus wiedergegeben. In der Abbildung eines Gegenstands durch den darstellenden Künstler hat diese Entstehung des Kunstwerks in der Regel keinen Platz.
Nicht zu Unrecht hat man Le Peintre de la vie moderne, das bilder- und gedankenreiche Gegenstück zu Les Foules, als „le plus grand des poèmes en prose de Baudelaire“ bezeichnet28. Über Les Foules geht der Essay schon deshalb hinaus, weil in den einleitenden Kapiteln in bilderreicher Sprache und doch eindringlich Baudelaires Vorstellungen von der Ästhetik der „modernité“ dargelegt werden. Seiner Bedeutung tut es dabei keinen Abbruch, dass nach verbreiteter Überzeugung Guys als Künstler überschätzt wird29. Für Baudelaire war Guys eine Bestätigung für den künstlerischen Enthusiasmus in der Großstadt und daher Ansporn zum eigenen Handeln. Sein Werk lieferte ihm den Beweis, dass die Erfahrungen und Themen des großstädtischen Lebens es mit den herkömmlichen Erfahrungen und Themen der Kunst und Dichtung aufnehmen konnten.