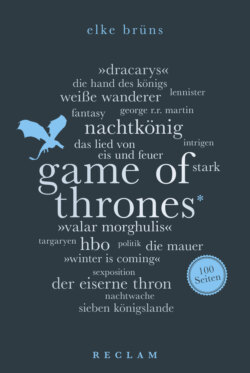Читать книгу Game of Thrones. 100 Seiten - Elke Brüns - Страница 7
Was macht diese Serie so erfolgreich, was ist ihr Geheimnis, ihr Suchtfaktor?
ОглавлениеGame of Thrones spielt in einem fiktiven europäischen Mittelalter. Für seine politische Geschichte des Kampfes um den Königsthron hat sich Martin als passionierter Leser historischer Stoffe von Ereignissen wie den englischen Rosenkriegen inspirieren lassen. Doch diese Anleihen sind eben genau das: Anleihen. Denn das Problem bei historischen Stoffen sei, so Martin, dass man wisse, wie sie ausgingen. Und das ist entschieden nicht das Ziel dieses Autors. Expect the unexpected, erwarte das Unerwartete – würde Game of Thrones ein Hausmotto brauchen, wäre es wohl dieser Satz, der mit der schockierenden Enthauptung des positiven und aufrechten Helden Ned Stark am Ende der ersten Staffel ihren ikonischen Moment gefunden hat.
Ein Witz über George R. R. Martin, berühmt to kill his darlings:
»Warum twittert dieser Autor nicht?«
»Weil er alle 140 characters umgebracht hat!« [characters bedeutet sowohl ›Zeichen‹ – Twitter erlaubt maximal 140 – als auch ›Figuren‹]
Dem Motto »Expect the unexpected« blieb die Serie auch unfreiwillig treu, denn die letzte Staffel enttäuschte Fans und Kritiker schwer, ja den Machern schlug richtiggehend Zorn entgegen. Dazu mehr im Abspann dieses Buches. Und bei dieser Gelegenheit eine Spoiler-Warnung – wer Game of Thrones nicht kennt: Bitte erst anschauen, dann lesen! Es ist unmöglich, über eine Serie zu schreiben, ohne etwas zu verraten.
Game of Thrones ruft die Bilderwelten des Mittelalters auf und kombiniert sie mit fremden, überraschenden Elementen. Manches, wie das Turnierwesen oder die Schwertkämpfe, ist vertraut, anderes scheint Martins Phantasie entsprungen zu sein – wie etwa die poetisch-dunkel klingenden Schattenwölfe, die das Banner des Hauses Stark zieren und von denen die Stark-Kinder anfangs Welpen finden. Tatsächlich haben sie einen realen, erdgeschichtlichen Hintergrund, denn die im Original dire wolf – lateinisch canis dirus, schrecklicher Hund – genannte Wolfsart lebte bis vor 10 000 Jahren in Nordamerika. »Gespielt« werden die Welpen von Tieren der Hunderasse Northern Inuit, die älteren Tiere dann von echten Wölfen, und die Aufnahmen wurden anschließend digital bearbeitet. Dies ist so aufwendig, dass die Schattenwölfe zum Leidwesen ihrer Fans nur selten gesichtet und manchmal selbst in Abschiedsszenen nicht von ihrem Gegenüber berührt werden: Das Streicheln eines computeranimierten Wesens durch Schauspieler ist (zu) teuer. Generell hat die Serie – allein schon die imposanten Drachen! – mithilfe eines enormen Budgets Maßstäbe in der digitalen Darstellung gesetzt. Ein Emmy-gekröntes Beispiel aus Staffel 4: Fünf Digital-Artists der deutschen Firma Mackevision arbeiteten drei Monate an der titanenbewachten Einfahrt der Stadt Braavos – Verweildauer auf dem Bildschirm: zehn Sekunden.
Die Serie verbindet Reales und Phantastisches, und auch historisch ist sie nicht homogen. Der Historiker Benjamin Breen weist darauf hin, dass sie neben mittelalterlichen auch Aspekte der Neuzeit inszeniert – folgt man der Periodisierung, die das Mittelalter um 1500 enden lässt. Zwar seien die Schlachtfeldtechnologien mittelalterlich, aber in seiner Kommunikationsstruktur und seiner kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung sei die Serienwelt dem Mittelalter voraus: Beispiele seien die weitreichenden Handelsbeziehungen über zwei Kontinente hinweg und die Gelehrtenkultur der Maester, die in der Zitadelle in Altsass ausgebildet werden und dann als Berater an den Höfen dienen – im europäischen Mittelalter fiel die Forschung in den Zuständigkeitsbereich der Kirche und konzentrierte sich zudem auf religiöse Lehren und Geschichte. Auch der Sklavenhandel, die professionellen Armeen und die gewaltigen Kriege verließen den mittelalterlichen Rahmen. Die Serie ist sicherlich nicht historisch genau, dafür aber stimmig: Die Serienmacher haben eine Welt erschaffen, die Bruchstücke der Real- und Kulturgeschichte aufnimmt, transformiert und synthetisiert, so wie sie die Drehorte digital überformt und alles um phantastische Elemente bereichert.
Doch Game of Thrones fungiert auch als Resonanzraum für die Gegenwart, wie die vielfältigen Debatten zeigen, die sich um Sex und Gewalt, Politik und Macht, Exotismus und Gender drehten. Vor allem die existenzielle globale Herausforderung unserer Tage scheint in der apokalyptischen Grundfigur der Serie gespiegelt: So wie die Westerosi in ihren Machtspielen aufgehen und die menschheitsbedrohende Existenz der Untoten bestreiten, sei auch unsere Welt von diesem Verhalten bestimmt. Auch George R. R. Martin bejahte, dass die Mahnung »Winter is coming« als Metapher für den allseits ignorierten und geleugneten Klimawandel gelesen werden könne.
In Game of Thrones gehen Aufklärung und Unvernunft eine ebenso seltsame Verbindung ein wie Fantasy und Wirklichkeit. Während ihrer gemeinsamen Reise zur Mauer, wo Serienheld Jon Schnee der dort dienenden Bruderschaft der Nachtwache beitreten will, raubt der andere Serienheld Tyrion Lennister der zukünftigen »Krähe« zwei Illusionen: Die altehrwürdige Nachtwache sei zu einer Institution verkommen, in der keiner mehr dienen wolle und die daher den Abschaum des Reiches rekrutiere. Zudem sei die Mauer nutzlos, denn Jon würde doch nicht den Unsinn über »Grumkins und Snarks« und andere böse Dinge glauben, die hinter dem Bollwerk lauern sollen – alles Ammenmärchen! Doch die Zuschauer wissen es besser, und bald sieht es auch Jon Schnee mit eigenen Augen: Die Weißen Wanderer gibt es tatsächlich. Im cold open wechseln wir, aufgeklärte Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts, auf die Seite des Phantastischen über: Mögen die superschlauen Westerosi über die White Walker spotten, wir haben sie gesehen und wissen: Die Untoten sind da! Sieben Staffeln lang rufen wir »Winter is coming« – auf in den Kampf! Am Ende der achten Staffel fragen wir uns, in welchen Kampf sind wir da gezogen?
George R. R. Martin wurde am 20. September 1948 in Bayonne, New Jersey, geboren. Dem ersten R. – für seinen Vater Raymond – fügte er als Jugendlicher ein zweites, seinem Cousin Richard entliehenes, hinzu, um sich von anderen George R. Martins zu unterscheiden. Sein Vater war Hafenarbeiter, man lebte in bescheidenen Verhältnissen und besaß »nicht mal ein Auto«, so Martin. Als er vier Jahre alt war, zog die Familie in eine Sozialbauwohnung in den neugebauten Projects. Staten Island war in Sichtweite – für Martin ein weit entferntes »Märchenland«.
Martins Karriere begann früh. Als Kind schrieb er Monstergeschichten und verkaufte sie für ein paar Pennys an Nachbarskinder. Die räumliche Enge seiner Welt – vier Blocks zwischen Wohnung und Schule – kompensierte er durch begeistertes Lesen, denn in Büchern und Comics konnte er überallhin reisen. In seiner Vorstellung konnte auch alles eine Nummer größer sein: Kleine Plastikfiguren von Woolworth, »die Geschichten brauchten«, wurden ebenso zum Objekt seiner Phantasie wie eine Ritterburg, in die er die einzigen in der Wohnung gestatteten Haustiere einquartierte. »Genau wie A Song of Ice and Fire, außer dass alle Charaktere Schildkröten waren.« Martin blieb ein passionierter Sammler von Spielzeugfiguren, die er in großen Dioramen in seinem Haus ausstellt (zu sehen in Durch die Nacht mit Sibel Kekilli und George R. R. Martin), und Burgenfan: Auf seiner vierwöchigen Deutschlandreise im Jahr 2000 besuchte er mit Werner Fuchs, seinem Freund und Literaturagenten für Deutschland, etliche mittelalterliche Festungen.
In seiner High-School-Zeit (1962–66) begeisterte er sich für das Comic-Fandom, schrieb Superheldengeschichten für Fanzines und leitete das Schachteam der Schule (später organisierte er Turniere für die Continental Chess Association). Das Studium an der Northwestern University in Evanston, Illinois, schloss er 1971 mit einem Master in Journalismus ab; zeitgleich erschien seine erste Kurzgeschichte im Magazin Galaxy. Martin etablierte sich als Schriftsteller und seine Werke wurden regelmäßig für den Hugo – den ersten gewann er 1974 – und den Nebula-Award, die wichtigsten Auszeichnungen für Science-Fiction und Fantasy, nominiert.
Da Martin den Vietnamkrieg ablehnte, leistete er Ersatzdienst in einer Rechtsberatung für die Armen von Cook County. 1975 heiratete er Gale Burnick und unterrichtete Journalismus am Clarke College in Dubuque, Iowa. Als er 1979 endlich vom Schreiben leben konnte, traf das Paar eine zukunftsweisende Entscheidung: Gale kaufte ein Haus in Santa Fe, New Mexiko, und er verkaufte das Haus in Dubuque. Leider lag die Ehe schon in den Trümmern; kaum die Verträge unterschrieben, ließen sich beide scheiden und Martin zog nach Santa Fe, in ein Haus, das er bis dahin nur von Fotos kannte.
In den frühen Achtzigerjahren schien zunächst alles auf einen Durchbruch zu deuten – die erstmals Horror und Science-Fiction verbindenden Sandkings und Nightflyers wurden mit Hugo- und Nebula-Awards ausgezeichnet – und Martins Verlag zahlte einen sechsstelligen Vorschuss auf sein Buch The Armageddon Rag, das als Bestseller einschlagen sollte: »Ich freute mich auf meine Karriere als berühmter Bestsellerautor. Das einzige Problem war, dass sich das Buch nicht bestens verkaufen ließ. Tatsächlich verkaufte es sich gar nicht. Plötzlich war meine Karriere als Romanautor vorbei.« Finanziell angeschlagen, wechselte er deshalb 1986 als Drehbuchschreiber (u. a. The Twilight Zone), Produzent (CBS-Revival Die Schöne und das Biest) und Serienentwickler in die Filmbranche (1987–93 gab er aber auch einen Großteil der von ihm und anderen Autoren verfassten Wild Cards-Bücher heraus). Hollywood geriet zu einer frustrierenden Erfahrung. Aus Budgetgründen musste er die Storys reduzieren und sparsamer gestalten, die Serien wurden gelobt, aber nicht realisiert: »Ich beschloss, zurück zu meinen Wurzeln zu gehen und Bücher zu schreiben, die nur durch die Größe meiner Phantasie begrenzt würden.«
1991 – Martin hatte gerade mit einem Science-Fiction-Roman begonnen – manifestierte sich eine Szene so eindringlich in seiner Vorstellung, dass er sie niederschreiben musste: Ein Junge sieht einer Enthauptung zu und findet dann einen Wurf Schattenwölfe im Schnee. Das erste Kapitel von Game of Thrones entstand in drei Tagen. Der Rest ist Geschichte: 1996 erschien dieser erste Band des ursprünglich auf drei Bände angelegten Epos A Song of Ice and Fire. Vom bekannten Fantasy-Schriftsteller wurde Martin zum Weltautor, und die Serie Game of Thrones hat ihn »endgültig in die Stratosphäre geschossen« (Werner Fuchs).
2011 heiratete er nach 30 Jahren seine Freundin Parris McBride – als Hochzeitsgeschenk erhielten sie von den Produzenten die drei versteinerten Dracheneier, die schon Daenerys Targaryen zu ihrer Hochzeit bekam.