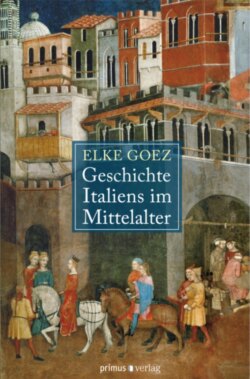Читать книгу Geschichte Italiens im Mittelalter - Elke Goez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Zwischen Skylla und Charybdis: Byzanz und die Langobarden
ОглавлениеNach dem Untergang des Gotenreiches herrschte noch einmal der byzantinische Kaiser über ganz Italien, doch brachte er dem krisengeschüttelten Land keine Entlastung. Vom Bosporus kamen keine Subsidien, da Kaiser Justinian angeordnet hatte, dass alle Provinzen sich selbst finanzieren mussten, wohl aber erhebliche Steuerforderungen, die rigoros eingetrieben wurden. Zudem exportierte Byzanz eine gut funktionierende, wenn auch bestechliche Geheimpolizei. Die neuerliche Vereinigung mit dem Kaiserreich brachte Italien nur Nachteile; der rasante Niedergang setzte sich ungebremst fort.
In Rom zeigte sich der Verfall besonders deutlich. Nach 541 verschwanden die Konsuln und wenig später auch die Senatoren. Angesichts ihrer enormen politischen und bildungspolitischen Bedeutung kam das Erliegen der senatorischen Tradition einer Katastrophe gleich. Die Stadtbevölkerung blieb mit ihren Nöten allein und ging stark zurück; Teile Roms verödeten. Lediglich in Santi Apostoli wurde aus politisch-demonstrativen Gründen gebaut. Narses gewährte dem Gotteshaus Finanzhilfen, weil es eine Parallele zur Apostelkirche in Konstantinopel darstellte, in der sich Konstantin der Große im Kreis der Kenotaphien der zwölf Jünger Jesu hatte bestatten lassen. Die römische Apostelkirche symbolisierte die Brücke zwischen dem West- und dem Ostreich.
Weit wichtiger als das heruntergekommene Rom war Ravenna, das dank seines Hafens jederzeit erreichbar war. Hier residierte der byzantinische Statthalter (seit dem Ende des 6. Jahrhunderts wird der Leiter eines byzantinischen Verwaltungsdistrikts Exarch genannt). Hierher exportierte das Kaiserreich Kunstschätze und verewigte sich in wundervoll-filigranen Alabasterkapitellen und strahlenden Mosaiken. Am programmatischsten geriet San Vitale: Das gewaltige Oktogon erhebt sich in griechischen Formen. Die heute noch faszinierende Kirche muss überwältigend gewesen sein, als noch alle Wände mit Intarsien aus Marmor, feinstem Stuck und erlesenen Mosaiken verkleidet waren. – Karl dem Großen diente San Vitale als Vorlage für die Pfalzkapelle in Aachen. Gleichzeitig ließ der große Karolinger Säulen und die berühmte Reiterstatue Theoderichs als Sinnbilder der Ravennater Kaisertradition über die Alpen schaffen. – Repräsentativen Zwecken dienten die Mosaiken zu beiden Seiten des Altars: Sie zeigen Kaiser Justinian, den Gotensieger, und seine Gemahlin Theodora. Beide halten goldene Opferschalen in Händen und werden von ihrem Hofstaat begleitet. Das Kaiserpaar ist durch einen Nimbus gekennzeichnet. Die darin ausgedrückte Gottesunmittelbarkeit verlangt unbedingten Gehorsam, stand aber zugleich für Gerechtigkeit, Frieden und den Schutz des wahren Glaubens.
Kaiser Justinian mit Gefolge. Mosaik, vor 547, Ravenna, San Vitale.
Aber Ideal und Wirklichkeit klafften weit auseinander. Das einzig vom Krieg kaum berührte Sizilien, die Kornkammer Italiens, zog der Kaiser ganz an sich und unterstellte die Inseln Korsika und Sardinien der Provinz Nordafrika, um sie besser verwalten zu können, da Italien selbst nicht über eine Flotte verfügte. Die Exarchen entsandte immer Konstantinopel; nur die ihnen unterstellten Provinzialgouverneure wählte der Kaiser aus lokalen Eliten.
In der Sanctio pragmatica, dem Organisationsgesetz Justinians für Italien aus dem Jahr 554, wies der Kaiser im Wesentlichen den Kirchen die Obsorge für die öffentliche Ordnung zu. Neben der Kontrolle der Maße, Gewichte und Preise mussten die Bischöfe grundsätzlich auch über eine gerechte Administration wachen und für deren reibungsloses Funktionieren sorgen. Das Gesetz gründet weniger auf der Hochachtung des Kaisers vor dem Klerus als vielmehr auf dessen Pragmatismus. Die alten städtischen Ordnungsorgane, vor allem die Senatoren und Kurien, wanderten ab. Wer es sich leisten konnte, übersiedelte nach Konstantinopel, der Rest zog sich auf seine Landgüter zurück. Dem Zusammenbruch der urbanen Verwaltung folgte der Niedergang des Wirtschaftslebens. Die großen Grundherrschaften waren weitgehend autark; die Überreste der antiken Stadtkultur nicht.
Überall mussten die Bischöfe einspringen, denen im 6. Jahrhundert immer neue, amtsfremde Aufgaben zufielen. In Italien, einschließlich der Inseln, gab es im Norden circa 80, im Süden etwa 350 Civitates, von denen fast jede einen Bischof hatte. Mehr oder weniger freiwillig übernahmen diese immer mehr Funktionen des alten Kaiserreiches, wodurch ihr öffentliches Ansehen enorm gewann, was wiederum die Spendenbereitschaft in die Höhe schnellen ließ. Obwohl die Kirche rasch zum größten Grundbesitzer Italiens aufstieg, deckten die Einnahmen kaum die laufenden Kosten. Papst Gregor I. klagte, dass er unablässig für die Kirche, die Klöster, den Klerus, aber auch das Volk und die öffentliche Wohlfahrt und sogar für die Feinde Zahlungen leisten müsse. Trotzdem stellten sich Kirche und Papst den neuen Herausforderungen und es verwundert wenig, dass gerade im krisengeschüttelten 6. Jahrhundert der Kosename papa für das Oberhaupt der katholischen Kirche aufkam.
Trotz aller Anstrengungen konnte die Kirche nur das Allerschlimmste verhüten; an die alte Stärke der Apenninenhalbinsel konnte sich die geschundene Bevölkerung kaum mehr erinnern. Italien wurde leichte Beute für Aggressoren, die plötzlich an der Grenze auftauchten. Nach langen Wanderungen massierten sich die ursprünglich wohl aus Schonen stammenden Langobarden in Pannonien. Als sich 553 der Langobarde Alboin mit der Tochter des Merowingerkönigs Chlotar I. vermählte, unterstützte Byzanz die Feinde der Langobarden, die Gepiden. Nach einer schweren Niederlage 565 paktierten die Langobarden mit dem seit kurzem am Schwarzen Meer ansässigen asiatischen Reitervolk der Awaren, deren Politik sich gegen Byzanz richtete. Am Kaiserhof unterschätzte man die Gefahr und sah zu, wie Langobarden und Awaren die Gepiden vernichteten und Alboin die Tochter des Gepidenkönigs Kunimund, Rosamunde, gefangen nahm und heiratete. Ohne einzugreifen, überließ man am Bosporus Angehörige des Reiches Völkern, denen die römischen Traditionen nichts galten. Die siegreichen Waffen der Langobarden versprachen reiche Beute und machten ihr Heer auch für die von ihnen Unterworfenen interessant. So entstand die „Wanderlawine“ eines polyethnischen Verbands, der vom Königtum überwölbt und zusammengehalten wurde (Postel, S. 243).
Ein beutehungriges Heer musste ständig befriedigt werden und so standen die Langobarden 568 an der Grenze Italiens. Obwohl man von der Langobardischen Reichsgründung spricht, was Planhaftigkeit suggeriert, galt der erste Einfall nur den Schätzen der Apenninenhalbinsel. Schon die Zeitgenossen kolportierten, der byzantinische Feldherr Narses selbst habe die Langobarden ins Land gerufen, um sie im Norden Italiens als Puffer zur Abwehr der Franken anzusiedeln. Aus Sicht der Langobarden verschaffte ihnen die „Einladung“ eine gewisse Legitimation. Die Römer benutzten die Narses-Theorie gerne als Erklärung für den geringen Widerstand, den Italien der Einnahme durch die Langobarden entgegensetzte.
Eines ist sicher: Die Langobarden kamen als Feinde nach Italien und unterschieden sich damit grundlegend von den Goten, die unter dem ius hospitalitatis angesiedelt worden waren. Bevor sie loszogen, versicherten sie sich der Rückendeckung durch die Awaren, die in die von den Langobarden geräumten Regionen Pannoniens nachrücken sollten. Ein genialer Plan, um den Byzantinern den Landweg nach Italien zu versperren. Als Alboin an der Spitze von etwa 100 000 Mann, einschließlich der Frauen und Kinder, im Mai 568 in die venetische Ebene einfiel, flohen die Menschen in panischer Furcht in die Lagunen. Der Metropolit von Aquileja zog sich nach Grado zurück und Venedig verdankt seine Entstehung letztlich den Langobarden!
Der berühmte Geschichtsschreiber Paulus Diaconus berichtet vom Langobarden-Einfall wie von der Ankunft des auserwählten Volkes im Gelobten Land. Glaubt man seiner Schilderung, so bestieg König Alboin, in Parallelität zu Moses, einen kleinen Berg und überblickte die Weiten Italiens, das schutzlos vor ihm lag. Zunächst stießen die Langobarden im Osten Venetiens im Friaul auf Cividale. Hier errichtete Alboin – im Stil spätantiker Administrationsgewohnheiten – den ersten langobardischen Dukat, den er mit einem Verwandten besetzte. Die Inhaber der Dukate waren für die Stadt und ihr Umland verantwortlich und gewannen rasch große Selbständigkeit, vor allem wenn es galt, einen neuen König zu wählen oder lieber ohne eine Zentralgewalt auszukommen. Ihnen zugeordnet waren langobardische farae, erstaunlich feste Siedlungs-, Kampf- und Wandereinheiten, die sich schon früher bewährt hatten.
Unter Umgehung der befestigten Städte drangen die Langobarden rasch in die Lombardei und die Toskana vor, wobei sie auf dem Land kaum Widerstand fanden; vielfach kooperierte die romanische Bevölkerung offen mit den Eroberern, konnten sie doch nur besser sein als die gefürchteten byzantinischen Steuereintreiber. 569 eroberte Alboin Mailand und nannte sich dominus Italiae. Während die Langobarden die Emilia einnahmen und weit nach Süden vorstießen, wo sie die Herzogtümer Spoleto und Benevent gründeten, hielt Pavia, der zukünftige Vorort des Langobardenreiches, drei Jahre dem Ansturm stand. Paulus Diaconus berichtet, Alboin habe gelobt, jeden einzelnen Pavesen zu töten. Als er endlich durch das Johannistor in die Stadt reiten wollte, brach sein Pferd unter dem Tor zusammen und war nicht mehr zum Aufstehen zu bewegen. Erst als er sein Gelübde brach und den Bewohnern zusicherte, diejenigen zu schonen, die sich ihm unterwerfen würden, erhob sich das Ross und trug Alboin in die Stadt. Tatsächlich kamen nur die zu Schaden, die nicht einlenkten.
Die Einnahme Pavias ging sogar in die Küchenlegenden der Region ein. Angeblich hatte Alboin neben allen Schätzen Pavias auch 12 Jungfrauen zu seinem Vergnügen gefordert. Elf der Auserwählten beweinten ihr Schicksal, die Zwölfte jedoch ließ sich Mehl, Honig und kandierte Früchte bringen und buk einen Kuchen – den ersten Panettone in Form einer Colomba Pasquale. Das taubenförmige Gebäck überreichte sie Alboin. Dieser argwöhnte einen Vergiftungsversuch. Erst nachdem die Pavesin ein Stück der Colomba gegessen hatte, kostete er selbst. Aus Begeisterung über das köstliche Backwerk soll er dem Mädchen die Freiheit geschenkt haben.
Alboin blieb nicht viel Zeit, aber als er 572 starb, waren die wichtigsten Orte von der Grenze im Norden und Osten bis südlich von Rom in langobardischer Hand. Dass Ravenna und Rom noch nicht dazugehörten, änderte nichts daran, dass er die byzantinische Rückeroberungspolitik annulliert hatte. Die Dukateinteilung der Apenninenhalbinsel orientierte sich grob an der alten civitates-Struktur und überlagerte damit spätantike Ordnungsformen, ohne sie zu zerstören.
Obwohl die Langobarden bei ihrer Landnahme mit großer Brutalität vorgingen, kooperierten die meisten Bischöfe als Sprecher ihrer Gemeinden, um Schlimmeres zu verhüten und um sich gleichzeitig gegen Byzanz und den Papst zu schützen. Der sogenannte Dreikapitelstreit um die Wesenheit Jesu erzwang eine eindeutige Stellungnahme und spaltete den italischen Klerus. Rom und die von Ravenna beeinflussten Bistümer passten sich Byzanz an, aber die Bischöfe im Norden propagierten in kirchlichen Fragen die Unabhängigkeit vom Kaiser. So konnten sich die Langobarden eine ähnliche Situation zunutze machen wie schon Theoderich. Neuerlich wurden Arianer zu Garanten der freien Entfaltung der Kirche in Oberitalien.
Allerdings ging die Kirche nicht ungeschmälert aus der Langobarden-Invasion hervor. Am schlimmsten betroffen war die lange und erbittert umkämpfte Emilia, wo kein Bistum auf eine kontinuierliche Bischofslinie zurückblickt, und auch in Benevent gab es zunächst keine funktionierende Kirchenordnung mehr. In Spoleto konnte sich nur ein Bischofssitz von 19 retten. Auch das Erzbistum Mailand verzeichnete herbe Verluste und verlor drei Viertel seiner zuvor 16 Suffragane. Weitaus glimpflicher kamen Aquileja und die Toskana davon, wo es auch nach 568 noch eine zwar reduzierte, aber funktionsfähige Kirchenorganisation gab; mit den Bischöfen überlebte auch ein Teil der alten romanischen Eliten.
Bald zermürbten innere Querelen die Langobarden. König Alboin fiel 572 einem Anschlag zum Opfer. Angeblich trank er bei einem Fest in Verona aus einem Gefäß, das aus dem Schädel seines Schwiegervaters geschaffen worden war. Als er seine Frau Rosamunde zwang, aus eben jenem Schädel-Becher auf das Wohl ihres Vaters zu trinken, hatte er sie so sehr beleidigt, dass sie ihre Ehre und diejenige ihres Vaters rächte und einen Attentäter entsandte, der Alboin bei seinem Mittagsschlaf tötete. Rosamunde heiratete den Mörder, Helmegis, musste aber mit ihm nach Ravenna fliehen, wo sie sich, mittlerweile Todfeinde geworden, gegenseitig vergifteten. Nach dieser Erschütterung erhoben die Langobarden Clef zum neuen König, der aber bereits 574 ebenfalls ermordet wurde.
Nach dieser neuerlichen Bluttat gelang es den verschiedenen langobardischen Gruppierungen nicht, sich auf einen neuen König zu einigen. Zwischen 574 und 584 herrschten langobardische duces, von denen jeder seine eigene Expansionspolitik betrieb und damit den Zerfall des Reiches heraufbeschwor.
Die Instabilität lockte die Byzantiner zurück auf die Apenninenhalbinsel. Noch immer hielten sie Teile Italiens in ihrer Gewalt, vor allem die Küstenlinie von Savona bis Triest und die Romagna, deren Name an die oströmische Dominanz erinnert und sich damit deutlich von der Lombardei abhob, deren Bezeichnung auf die Langobarden verweist. Obwohl die Zeit der duces aus kirchlicher Sicht eine Katastrophe darstellte, da hemmungslos Kirchengüter eingezogen und unbotmäßige Priester abgeschlachtet wurden, gab es keine Allianz der romanischen Substratbevölkerung mit den Byzantinern. Zwar verschärften sich die Spannungen zwischen Arianern, Katholiken, Dreikapitelanhängern und Heiden, aber Byzanz konnte die Krise wegen seiner Überbeanspruchung im Perserkrieg nicht nutzen. So blieb dem Kaiser nur die schnöde Bestechung einzelner duces, wobei sich diejenigen von Piacenza, Parma und Reggio besonders empfänglich zeigten und zu Ostrom überliefen. In Mantua und Modena konnte sich der Exarch von Ravenna militärisch behaupten.
Die Gelegenheit zu wirkmächtigeren Schlägen wäre günstig gewesen, da die Langobarden erhebliche Schwierigkeiten mit den immer stärker werdenden Franken bekamen. Langobardische Raubzüge in die Provence und das Rhônegebiet, die seit 569 zur Tagesordnung gehörten, hatten die Franken gereizt. Mit finanzieller Hilfe des byzantinischen Kaisers schlugen sie nun zurück, zwangen die duces 584 zum Frieden und griffen über die Alpen auf das Aostatal zu. Aosta und Susa schlossen sich den Merowingern an. Die Westausrichtung der Landschaft am Fuße des Mont Cenis und des Großen St. Bernhard überlebte das Mittelalter; noch heute spricht man dort Französisch. Die Franken hatten eine Einfallspforte ins Langobardenreich gewonnen.
Das Bündnis ihrer Gegner bewog die duces doch wieder einen König zu wählen. Sie einigten sich auf Authari und bewiesen ihre Solidarität, indem sie ihm je die Hälfte ihrer Herzogsgüter übergaben, um das Königtum materiell reich auszustatten. Dieser Besitz bildete für Jahrhunderte die Grundlage des italischen Königtums.
Mit Authari begann ein neues Kapitel der Langobardengeschichte. Er formte aus dem plündernden Haufen eine geschlossene gens, die sich kulturellen Werten gegenüber aufgeschlossen zeigte. Er beschnitt die wild wuchernde Abgabenflut und gewann so das Vertrauen der romanischen Bevölkerung, der ein geregeltes Steuersystem Sicherheit versprach. Zugleich gelang es ihm, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen. Um sich politisch abzusichern, heiratete Authari die Bayernprinzessin Theudelinde und schloss so ein Bündnis mit dem Herzogtum Bayern gegen die Franken. Dass Theudelinde katholisch war, stellte für den Langobarden kein Problem dar. Er konnte nicht ahnen, dass sie nach seinem Tod zur Speerspitze des Papsttums bei der Mission der Langobarden-Gebiete werden sollte.
Während die Befriedung im Innern Fortschritte machte, sahen sich die Langobarden mit neuerlichen Aggressionen von außen konfrontiert. 590 griffen die Franken im Verband mit den Byzantinern an. Erstere stießen über Churrätien bis weit in die Po-Ebene vor, wo sie allerdings wegen logistischer Abstimmungsprobleme nicht auf Verstärkung trafen. 591 vermittelte der Herzog von Turin einen tragfähigen Frieden zwischen Langobarden und Franken, dem wohl auch die Bayern beitraten. Noch im gleichen Jahr starb Authari.
Er hinterließ ein geordnetes, im Inneren weitgehend befriedetes Königreich, aber ein in zwei Machtblöcke gespaltenes Italien: den langobardischen Norden und den byzantinischen Süden, wobei man sich die Blöcke nicht zu geschlossen vorstellen darf. Der byzantinische Teil war nur locker zusammengefügt; die Hafenstädte Neapel, Gaeta und Amalfi entwickelten sich weitgehend selbständig; ebenso Venedig, das zur wichtigen Einfallspforte griechischer Kultur und Waren aufstieg. Die Pentapolis (Rimini, Fano, Pesaro, Senigallia und Ancona) bekannte sich zwar formell zu Byzanz, ging aber eigene Wege. Während man sich am Bosporus um Sardinien und Korsika scheinbar nicht kümmerte, lagen Sizilien und Süditalien fest in kaiserlicher Hand. Eine unter Kaiser Maurikios initiierte Verwaltungsreform sollte das lose Konglomerat unverbundener Machtinseln festigen, bewirkte aber faktisch das Gegenteil. Zwar war es für die Effektivität des Herrschaftshandelns durchaus von Vorteil, dass die Exarchen wieder das militärische Kommando und die weltliche Verwaltung in ihrer Hand vereinten, doch unterstützte diese Machtfülle das Emanzipationsstreben einzelner Provinzen. Die Identifizierung mit dem Kaiserreich nahm in dem Maße ab, in welchem die Eigenidentität der Provinzen erstarkte. Die zentrifugalen Kräfte auf byzantinisch dominiertem italischen Boden gewannen die Überhand.
Im langobardischen Teil der Apenninenhalbinsel entzogen sich Spoleto und Benevent dem Zugriff des Langobarden-Königs. Aber auch im Norden blieben einzelne Dukate selbständig und verhinderten eine Arrondierung des Königreiches. Italien stellte keine politische Einheit mehr dar und schied aus dem Kanon der möglichen westeuropäischen Bündnispartner aus.
Obwohl Theudelinde nur kurz mit Authari verheiratet war, hatte sie immensen Einfluss gewonnen. Nur so ist es zu erklären, dass sie nach seinem Tod selbständig einen neuen Ehemann wählen konnte, der mit ihrer Hand auch die Langobardenkrone erhielt. Sie heiratete Agilulf, den Herzog von Turin, der in Mailand zum König erhoben wurde; eine exzellente Wahl! Diplomatisch geschickt knüpfte Agilulf ein Bündnis mit den Franken und Awaren gegen die Byzantiner, denen er die emilianischen Städte entreißen konnte. 598 musste der Exarch um Einstellung der Kampfhandlungen bitten. Gleichzeitig schreckte Agilulf gegenüber denjenigen Herzögen, die seine Herrschaft nicht anerkannten und sich ihm widersetzten, nicht vor Hinrichtungen zurück. Frei werdende Herzogtümer erhielten Getreue oder Verwandte, um sie stärker denn je an das Königtum zu binden. Durch die Entsendung vormals im Norden angesiedelter Gefolgsmänner in den Süden vernetzte er die langobardischen Herrschaftsinseln besser miteinander und stabilisierte sein Königreich.
Der gemeinsame Kampf Agilulfs sowie der Herzöge von Benevent und Spoleto gegen das kaiserliche Süditalien führte die Langobarden erstmals vor die Tore Roms, dessen Lenkung und diplomatische Außenvertretung Papst Gregor der Große übernommen hatte. Da tatkräftige Hilfe aus Konstantinopel nicht zu erwarten war, handelte der Papst dank der Vermittlung Theudelindes einen Frieden mit den Langobarden aus. Die Korrespondenz des Papstes mit der Königin spiegelt die Wertschätzung der Bayerin, aber auch die Hoffnungen, die der Papst im Hinblick auf die Missionierung der Arianer in sie setzte. Theudelinde erfüllte alle Erwartungen. Dank ihres Einflusses auf Agilulf stabilisierte sich die kirchliche Ordnung Italiens und damit auch die weltliche. Die nach Sizilien geflohenen Kleriker kehrten zurück und Agilulf anerkannte nicht nur die Bischöfe in ihren Ämtern, sondern restituierte ihnen die von den Langobarden beschlagnahmten Kirchengüter. Obwohl Agilulf niemals an einen Übertritt zur katholischen Kirche dachte, näherten sich während seiner Herrschaftszeit Katholiken und arianische Langobarden an. Einen Höhepunkt bildete die katholische Taufe Adaloalds, des Sohnes Theudelindes und Agilulfs.
612 gestattete Agilulf sogar die Errichtung eines Klosters am Flüsschen Trebbia innerhalb seines Machtbereiches, das rasch enorme Strahlkraft entwickeln und zum kulturellen Kristallisationspunkt, aber auch zum Missionszentrum im Arianergebiet aufsteigen sollte: Bobbio, die Gründung des Iroschotten Columban. Theudelinde selbst stiftete die Kirche zu Monza und stattete sie mit königlicher Pracht aus.
Mailand, Sant’Ambrogio, Atrium und Fassade. Gegründet im 4. Jh., Neubau des 11./12. Jh.
Immer stärker verfeinerte Agilulf seine öffentliche Repräsentation und adaptierte Elemente des byzantinischen Hofzeremoniells. So erhob er vor einer größtmöglichen Öffentlichkeit 604 seinen Sohn in Mailand zum Mitherrscher und hob sein Gottesgnadentum hervor. Ob die Einrichtung einer festen Hauptstadt in Pavia auf byzantinische Vorbilder zurückzuführen ist, bleibt fraglich, unterschied aber das Langobardenreich grundlegend von allen anderen germanischen Staatsgründungen auf römischem Boden.
Die langobardische Annäherung an den katholischen Glauben und das Papsttum entfremdete Italien dem Kaiserreich und stärkte die Position der Nachfolger Petri, deren Sendungsbewusstsein und Primatsanspruch am Bosporus für wachsende Verstimmung sorgte. Im Schatten der Spannungen gelang es dem Papsttum, Italien im Innern unter dem Dach des katholischen Glaubens schrittweise zu einen, was nicht zuletzt Theudelindes Überzeugungsarbeit zu danken war.
Die Glaubensannäherung hatte aber nicht nur atmosphärische, sondern auch politische Folgen und kulminierte in einer Hochzeit: Agilulfs Sohn, Adaloald, wurde mit einer Tochter des austrasischen Herrschers Theudebert II. verlobt. Damit war der Friede mit den katholischen Franken besiegelt. Als es Agilulf auch noch gelang, einen ewigen Frieden mit den Awaren gegen die Byzantiner zu schließen, stand er im Zenit seiner Macht. Die Eigenmächtigkeiten der Herzöge hielten sich in Grenzen und dank des inneren Friedens erholte sich die Wirtschaft. Für die Prosperität des Langobardenreiches und den Aufschwung sorgte auch eine neue Straße, die auf Teilen antiker Trassierungen verlief und Rom mit Pavia verband. Sie überquerte bei Piacenza den Po, mit dem Cisa-Pass den Apennin und gelangte über Lucca, Siena und Viterbo in die Ewige Stadt. Die später irrtümlich Via Francigena genannte Trasse begründete den Aufstieg Luccas und Sienas zu urbanen und ökonomischen Zentren mit weithin ausstrahlender, überregionaler Bedeutung.
Als der wegen seiner Fürsorglichkeit auch gegenüber den Romanen mit dem spätantiken Beinamen Flavius ausgezeichnete Agilulf 615 starb, war sein einziger Sohn noch minderjährig. Für ihn übernahm Theudelinde die Vormundschaft und forcierte nicht nur den Ausgleich mit Byzanz, sondern auch die Missionierung der Langobarden. Das war zu viel! Die Unzufriedenen scharten sich um Arioald, den arianischen Herzog von Turin, der zudem als Gemahl der Tochter Agilulfs Rechte am Langobardenreich anmelden konnte. Obwohl sich das Papsttum vehement für Theudelinde und ihren Sohn einsetzte, war Adaloald nicht zu halten; er wurde vergiftet. Nur ein Jahr später starb Theudelinde.
Die Nachfolger waren konservativ-arianische Herzöge, die indessen tolerant gegenüber der katholischen Bevölkerung auftraten und keine Eheverbote aussprachen. Sie waren Traditionalisten, denen am Erhalt des Langobardentums lag, was in der Kodifikation des langobardischen Rechts durch König Rothari im Edictum Rothari vom 22. November 643 zum Ausdruck kommt. Das Edikt ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: Es nennt im Prolog die Namen von 17 langobardischen Königen, um die lange Tradition in legitimierender Absicht hervorzuheben. Dabei wurde auf zwei Legenden zurückgegriffen. Zum einen war der Romgründer Romulus der 17. König seit Aeneas, zum anderen Athalarich, der Enkel Theoderichs des Großen, der angeblich 17. König nach dem Gott Gaut. Beide Traditionslinien vereinigt Rothari als 17. König des Langobardenvolkes nun in sich. Tritt schon hier der Stolz auf die eigene gens unübersehbar zutage, so wird dies in der Datierung noch verstärkt. Das Gesetzeswerk nennt die Herrscherjahre Rotharis und die römische Indiktion, dann aber nicht die Regierungsjahre des byzantinischen Kaisers, sondern die Jahre, die seit dem Einmarsch Alboins 568 in Italien vergangen waren. Das Gesetz trat neben das Corpus iuris civilis, galt aber zugleich für Romanen und Langobarden und trieb damit die Romanisierung der ehemaligen Invasoren voran. Hierzu trug auch die großzügige Wirtschaftsförderung ihren Teil bei, welche die langobardischen Könige auch katholischen Romanen zukommen ließen, wie beispielsweise den Salzproduzenten, Fracht- und Bauunternehmern in Comacchio. Die maestri Comacini, deren Kunstfertigkeit während des gesamten Mittelalters geschätzt wurde, stammen wohl aus langobardischer Zeit.
Da sich viele Langobarden in Städten unwohl fühlten und lieber auf dem Land lebten, veränderten sie die Sozialstruktur Italiens nicht wenig. Waren die freien Bauern und Kleinbauern während der Spätantike weitestgehend verschwunden, entstanden nun neue bäuerliche Agrargemeinschaften, in denen auch eine Vielzahl freigelassener Romanen integriert wurden. Zwar blühte so die Landwirtschaft schnell auf, aber ebenso schnell verknappte sich das Siedlungsland, was seit dem 8. Jahrhundert zu einer zunehmend aggressiven langobardischen Außenpolitik führte.
Unter Aistulf (749 –756) wurde die Romanisierung der Langobarden offensichtlich. Nach römischem Vorbild verlagerte er seine Residenz nach Ravenna und ahmte die kaiserliche Goldmünzenprägung und Titelführung nach. Dank zunehmender Verschriftung von Rechtsverfügungen – auch dies ein Rückgriff auf antik-römische Traditionen – verbesserten sich das Erbrecht und die Testierfreiheit.
Die bewusste Adaption römischer Traditionen zur Optimierung der Herrschaftsrepräsentation bedeutete aber nicht, dass die Langobarden auf Byzanz zugegangen wären; im Gegenteil! Energisch bekämpften sie seit den Tagen Rotharis byzantinische Stellungen auf der Apenninenhalbinsel. Vor allem an der ligurischen Küste waren sie erfolgreich und gliederten die Städte von Luni bis Nizza in das Königsgut ein.
Gefährlich wurde den Langobarden allenfalls Kaiser Constans II. (641– 668), der 663 mit dem erklärten Ziel in Tarent landete, Italien zurückzuerobern. Die erste Station sollte Benevent sein, das er belagerte. Zunächst sah es so aus, als würde sein Plan aufgehen, denn die Byzantiner fingen einen Boten ab, der dem eingeschlossenen Herzog ausrichten sollte, ein Entsatzheer sei nahe und er möge ausharren. Trotz Lebensgefahr schrie der Bote seine Nachricht über die Mauer Benevents; er wurde sofort hingerichtet und sein Kopf mit einer Schleuder in die Stadt geworfen, aber seine Botschaft war angekommen. Das Heer Constans’ II. wurde vernichtet und der Kaiser änderte schlagartig seine Pläne. Plötzlich friedlich gestimmt, zog er mit aller Pracht 663 als letzter antiker Kaiser in Rom ein. Aber er erlebte nicht den Triumphzug zum Kapitol, sondern ging mit einer Kerze nach St. Peter, um dem Apostelfürsten ein Pallium zu überbringen. Zwölf Tage weilte er am Tiber und ließ bei seinem Abzug alle wertvollen Statuen und Kunstwerke nach Konstantinopel schaffen, denn Rom war längst nicht mehr das ehrwürdige Haupt des Imperiums, sondern eine Grenzstadt. Constans II. selbst zog es nach Sizilien in seine neue Residenz Syrakus. Dort fand er zwar Ruhe vor den Langobarden, nicht aber vor den gefährlich expandierenden Sarazenen. 668 fiel er im Bad einem Anschlag zum Opfer.
Da Byzanz von inneren Unruhen und schweren Kämpfen gegen die Araber erschüttert wurde, konnte Grimoalds Sohn, Romuald, unbehelligt den Machtbereich Benevents nach Süden ausdehnen. Als er nach neunjähriger Herrschaft starb, umfasste sein Königreich fast ganz Italien mit Ausnahme Roms, Neapels und des Exarchats. Auch unter König Perctarit stabilisierte sich die Langobardenherrschaft, da dieser sowohl Frieden mit Byzanz, das sich notgedrungen mit den Verlusten auf der Apenninenhalbinsel abfand, als auch mit der katholischen Kirche schloss.
Gerade jetzt, als die Bindung zu Byzanz immer schwächer wurde, besetzten erstaunlich viele griechische und syrische Geistliche den Stuhl Petri, was aber zu keiner neuen Annäherung führte, da 726 ein neuer theologischer Zwist entbrannte: der Bilderstreit. Kaiser Leo III. verbot den als Blasphemie empfundenen Bilderkult, wogegen sich vor allem in Italien erbitterter Widerstand erhob. Hier wollte man die Verehrung der Ikonen – eine liebgewonnene Tradition – nicht mehr missen. Die Speerspitze gegen Byzanz war Papst Gregor II. Als er nicht einlenkte, unterstellte der Kaiser die Diözesen Süditaliens der Kontrolle des Patriarchen von Konstantinopel und enteignete das Papsttum in Süditalien. Mit einem Schlag sah sich der Nachfolger Petri, bis dato größter Grundbesitzer Italiens, seiner wirtschaftlichen Existenzgrundlage beraubt und auf Rom mit seinem Umland reduziert. Die unhaltbare Situation führte zum endgültigen Bruch zwischen Rom und Byzanz.
Die Lage des bedrängten Papsttums verschlechterte sich noch erheblich, als die Langobarden vor der Ewigen Stadt nicht mehr Halt zu machen schienen. Als König Liutprand 728 Sutri einnahm, schien es nur noch eine Frage der Zeit, wann Rom in seine Hände fallen würde. Damit begann die Konfrontation der Langobarden mit dem Papsttum, die letztlich zu einer ihr Reich vernichtenden Konstellation führte. Da aus Byzanz keine Hilfe zu erwarten war, wandte sich Gregor III. 739 erstmals mit der Bitte um Hilfe an den fränkischen Hausmeier Karl Martell. Obwohl Karl auf die Anfrage höflich, aber mehr als zurückhaltend reagierte, war die Verbindung Roms mit den Karolingern für die Zukunft vorgezeichnet. Auf dem Höhepunkt seiner größten Stärke braute sich vernichtendes Unheil über dem Langobardenreich zusammen.