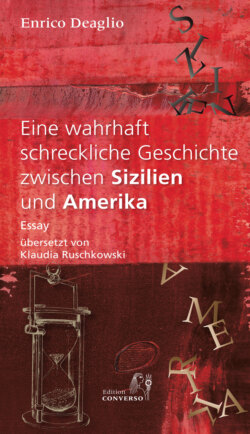Читать книгу Eine wahrhaft schreckliche Geschichte zwischen Sizilien und Amerika - Enrico Deaglio - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Das Gemälde von Antonello
ОглавлениеEs existiert nur eine einzige Fotografie von Francesco (Frank) Defatta, die seinen Aufenthalt auf dieser Erde bezeugt. Der Bauer aus Cefalù, der »am düsteren Ende des sterbenden Jahrhunderts«, wie es in einem Revolutionslied heißt, in Tallulah gelyncht wurde, hatte sie in einem Fotoatelier in Vicksburg anfertigen lassen. Diese so bedeutende wie schöne Stadt, errichtet auf einer steil vorspringenden Anhöhe über dem Zusammenfluss von Mississippi und Yazoo, gilt wegen ihrer strategischen Bedeutung im Amerikanischen Bürgerkrieg als das »Gibraltar der Konföderierten«. Frank hatte auch seinen Bruder Joe und seinen Vetter Rosario Fiduccia mitgebracht. Die drei Dagos steckten in guten Anzügen, die ihnen der Fotograf zu diesem Anlass überlassen hatte: dunkle Jacke, weißes Hemd, breite Krawatte, Weste. Darüber gut sichtbar eine schwere goldene Kette, der Verweis auf die Uhr in der Westentasche. Wie jeder andere vor dem Objektiv, machen auch Defatta und Fiduccia einen steifen Eindruck. Joe sitzt halb auf der Armlehne eines Korbschaukelstuhls und hält einen Hut in der Hand. Fiduccia steht neben einer quadratischen Säule aus falschem Marmor, den Ellbogen aufgestützt.
Unsere drei hatten demzufolge ein paar Sprossen der sozialen Leiter erklommen: Sie waren zu businessmen geworden. Und zugleich genau das geblieben, was man sich unter einem Dago, einem Sizilianer also, vorstellte – sprich, wie die Berichte der populären Zeitungen und die gelehrten Messungen der Forscher übereinstimmend erklärten, die klassischen Exemplare einer »Rasse«, die nicht wirklich weiß, sondern von einer minderwertigen Farbe war. Ihre Hautfarbe resultierte, um es wissenschaftlicher auszudrücken, aus einer jahrhundertelangen Vermischung mit afrikanischem Blut. Das hatte bereits zu Zeiten Hannibals seinen Anfang genommen, sich still und leise fortgesetzt und schließlich gar für den Niedergang und Fall des Römischen Reiches gesorgt.
Etwa neun Jahre vor dem Lynchmord war in weiten Teilen Amerikas bereits eine Klassifizierung nach Rasse, Herkunft und Intelligenz verbreitet. Die Neue Welt rief Millionen von Menschen auf der Flucht vor Hunger, Ungerechtigkeit und Verfolgung. Aber es galt auf der Hut zu sein, wen man sich da ins Haus holte. Und im Fall von Louisiana handelte es sich um eine der turbulentesten Anlaufstellen.
Die Vorstellungen der Amerikaner erwiesen sich damals als recht konfus. Die Gründerväter beispielsweise waren so sehr auf Rom und das alte Griechenland fixiert, dass sie in allen ihren öffentlichen Gebäuden und Monumenten die Bögen und Säulen der antiken mediterranen Kultur kopierten. Dann allerdings begannen sie, Unterschiede zu machen. Der Senator von Louisiana, James Eustis, ein Politiker, der später als Botschafter nach Frankreich ging, brachte es 1890 in einer öffentlichen Rede folgendermaßen auf den Punkt:
Es ist völlig in Ordnung, Einwanderer aus Norditalien aufzunehmen. Stattdessen aber kommen alle Italiener, die es derzeit zu uns zieht, von der Stiefelspitze und dem Absatz der Halbinsel und aus Sizilien. In Norditalien, da sind sie wirklich Kelten, genau wie die Franzosen und die Iren, und in der Tat stammen sie in direkter Linie von den Lombarden ab. Die Sizilianer und Kalabresen dagegen sind ein buntes Gemisch von Nachkommen ehemaliger Piraten, Mauren und degenerierten lateinischen Rassen, die es nach dem Fall des Römischen Reiches umhergetrieben hat.
Betrachtet man die Fotografien der Defattas, ihre kurzgeschnittenen, vollen Haare, deren Ansatz tief in die Stirn reicht, die riesigen schwarzen Schnurrbärte, die dichten Augenbrauen, die quadratischen Gesichter, die ganz sicher dunkler sind als die eines Iren oder Deutschen, dann bemerkt man auch etwas in ihrem Blick. Joe und Frank Defatta sind keine Denker oder Melancholiker; ihnen haftet weder etwas Rebellisches noch Unterwürfiges an. In beider Blick liegt vielmehr etwas Verhaltenes, Beobachtendes. Dem Anschein nach sind sie sehr ernsthafte, gefasste junge Männer, beinahe haben sie etwas von Märtyrern. Aber es scheint, als sei diese übermäßige Strenge nur aufgesetzt, als könnte sie nur mit Mühe für den Moment der Aufnahme bewahrt werden. Ihr Mund ist schon bereit, sich zu einem Lächeln zu verziehen, die Augen sind kurz davor, sich unter großem Gelächter zu Schlitzen zu verengen.
Die fünf Gelynchten von Tallulah stammten alle aus der antiken Stadt Cefalù an der Nordküste Siziliens. Seit Urzeiten ist Cefalù bekannt wegen seines spektakulären Kalkfelsens am Meer und der byzantinisch-normannischen Basilika, mit deren Bau König Roger II. Mitte des zwölften Jahrhunderts beginnen ließ, als Dank für seine Errettung aus Seenot. Die bedeutende Hafenstadt Cefalù liegt an einer schwierigen, im Winter von heftigen Stürmen heimgesuchten Küste, zwischen Palermo und Termini Imerese im Westen, Milazzo und Messina im Osten. Gegenüber öffnet sich der Archipel der Äolischen Inseln, der seit der Antike Zentrum der Zivilisation und des Seehandels und der Hafen schlechthin zwischen Neapel, Sizilien und Malta ist. Seit zweitausend Jahren wird das Land hier kultiviert, werden Weizen, Oliven, Wein und vor allem Zitrusfrüchte angebaut. Die Araber brachten ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem mit, dem sich üppige Zitronenhaine verdanken. Zur Zeit unserer Geschichte verkehrte eine Eisenbahn nur wenige Meter vom Meer entfernt zwischen Messina und Palermo (sie fährt heute noch, allerdings recht langsam). Von den zwölftausend Einwohnern waren damals zehntausend vollständige Analphabeten.
Cefalù, diese Stadt mit dem sonderbaren Namen, berühmt für die Mosaiken im Dom, für ihre mittelalterlichen, mit Strandkieseln gepflasterten Gassen, zählt zu den Wahrzeichen Siziliens. Auch international gilt sie als eines der wichtigsten Symbole sizilianischer Identität, seit 1961 der Regisseur Pietro Germi in seinem hinreißenden Film Scheidung auf Italienisch die Figur des »Baron Cefalù« erfunden hat, gespielt vom jungen Marcello Mastroianni, der sich in seine sechzehnjährige Cousine Angela (Stefania Sandrelli) verliebt. Dieser Baron Cefalù ist ein adliger Habenichts, ein Faulpelz mit pechschwarzem pomadisiertem Haar und Oberlippenbart. Er heckt einen raffinierten Plan aus, seine Frau aus dem Weg zu schaffen, um endlich seine Cousine heiraten zu können. Fünfzehn Jahre später – Cefalù war bereits zu einem der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte Siziliens geworden – beleuchtete Vincenzo Consolo in seinem Roman Das Lächeln des unbekannten Matrosen die Rolle der Stadt während des Risorgimento, der italienischen Einigungsbewegung im neunzehnten Jahrhundert. Erzählt wird die Geschichte des Barons Enrico Pirajno di Mandralisca: ein Adliger und Wissenschaftler – sein Gebiet war die Malakologie, die Erforschung von Schnecken und Muscheln – mit sehr liberalen Ideen, in einem Cefalù zur Zeit von Garibaldis Zug der Tausend und den blutigen Erhebungen um Grund und Boden, zu denen es in jenen Jahren kam. Pirajno (es gab ihn wirklich) mit seiner aufrichtigen Hoffnung auf eine soziale Revolution erwies sich als Gegenstück zum aristokratischen Zynismus eines Don Fabrizio Corbera, Fürst von Salina, dem Helden von Tomasi di Lampedusas Roman Der Gattopardo (in der Verfilmung von Luchino Visconti übrigens außerordentlich gelungen dargestellt von Burt Lancaster, einem amerikanischen Schauspieler mit leuchtend blauen Augen). Im Gattopardo tritt die Masse der Bauern, der Ausgebeuteten, der von Garibaldi Getäuschten kaum in Erscheinung, der Roman gibt der Unbeweglichkeit einer niedergehenden Aristokratie Raum, die sich mit einer neureichen Klasse von Aasgeiern verbündet. Dafür brechen im Lächeln des unbekannten Matrosen die Entrechteten in die Szene ein, bahnen sich mit dem Messer und dem Ideal einer Urgerechtigkeit ihren Weg und werden am Ende vom neuen Staat ermordet oder in Ketten in die Kerker geworfen. Dem armen Baron di Mandralisca bleibt nichts anderes übrig, als dem Volk seine Schneckensammlung zu vermachen, nebst einigen Malereien, die an seinen Wänden hängen.
Am faszinierendsten ist ein kleines Ölgemälde von Antonello da Messina, das Porträt eines Unbekannten. Es hatte in der Apotheke Di Salvo an der Hauptstraße von Lipari überdauert, als einer der Türflügel des Apothekerschranks (die Kunden sahen es nur von der Rückseite). Als Pirajno di Mandralisca es 1860 schließlich entdeckte, war es in schlechtem Zustand. Die Tochter des Apothekers hatte beide Pupillen des Unbekannten mit dem Dorn einer Aloe durchbohrt, vielleicht, weil er ihr Angst machte, vielleicht aber auch, weil er sie an einen Mann erinnerte, der sie nicht geliebt hatte, oder von dem sie verführt und dann verlassen worden war.
Das Bildnis zeigt das Porträt eines vor vier Jahrhunderten geborenen Mannes, wahrscheinlich ein Liparote – Schiffseigner oder Matrose. Antonello hatte zwischen 1470 und 1475 auf Lipari gelebt und dort die Wappen, Insignien und Banner des aufblühenden äolischen Hafens gemalt.
Mandralisca stellte das Gemälde in seinem Privatmuseum aus, das mit allen seinen Sammlungen bei seinem Tod 1863 der Gemeinde von Cefalù zufiel. Und so auch dieses Gemälde. Und hier ist die Geschichte zu Ende … nein! Dank Consolos Roman erwachte der Matrose wieder zum Leben und konnte weiterhin seine beunruhigende Wirkung verbreiten. Der Unbekannte, gemalt in Öl auf schwarzem Grund und in der Manier flämischer Meister in Dreiviertelansicht, trägt ein Barett, das seine Stirn bedeckt, und verzieht die Lippen zu einem spöttischen, feigen, womöglich sadistischen Lächeln. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um ein zufriedenes und selbstsicheres Schmunzeln. Es lässt sich gut nachvollziehen, dass die Tochter des Apothekers von seinem Anblick ebenso verängstigt wie fasziniert war. Der Unbekannte ist rätselhaft. Seit Erscheinen des Romans wird darüber diskutiert, ob er nicht gar als das wahre Symbol eines universellen italienischen Charakters gelten mag, eines Geheimnisses vergleichbar dem der Mona Lisa – die Bedeutung seines Blicks, seine erotische Kraft, das Zweideutige, die sicilianità.
Leonardo Sciascia beispielsweise schrieb:
… Wem ähnelt der Unbekannte aus dem Museum
Mandralisca? Dem Mafioso vom Land und dem
der besseren Viertel, dem Abgeordneten auf den
Bänken der Rechten und dem auf denen der Linken,
dem Bauern und dem Staranwalt. Er ähnelt dem,
der diese Zeilen schreibt (so wurde ihm gesagt), und
bestimmt ähnelt er Antonello. Und versucht einmal,
den sozialen Stand und das besondere Menschsein
dieses Charakters zu bestimmen. Unmöglich.
Handelt es sich um einen Adligen oder einen Mann
aus dem Volk? Einen Notar oder einen Bauer?
Einen ehrlichen Mann oder einen Gauner? Einen
Maler Dichter Meuchelmörder? »Er ähnelt«,
das ist alles.
Eben wegen dieser allgemeinen Ähnlichkeit und vielleicht, weil auch ein Meer dazwischen liegt, und Aufbrüche und die Ferne, schien mir, als ähnelte die Fotografie von Joe Defatta Antonellos Unbekanntem. Sein Haaransatz zeichnet dessen Barett nach, die Gesichtsfarbe ist ähnlich, ebenso wie die Haltung des Oberkörpers und des Kopfes. Und natürlich die Augen. Lebendig, ironisch, jungenhaft, bedrohlich.
Heute wissen wir, dass es vor allem ihre Augen und ihre Haut waren, die Defatta und seinen Brüdern den Tod brachten: Jene, die beschlossen hatten, ihrem Leben ein Ende zu machen, fürchteten sich davor. Vor der Farbe ihrer Haut und vor jenen Augen, jenem Lächeln. Genauso wie die Tochter des Apothekers von Lipari angesichts des Gemäldes von Antonello.
Mehr als das Geheimnis der Augen und eines Lächelns standen jedoch zur Zeit unserer Geschichte die Haut samt den Tätowierungen, die angewachsenen Ohrläppchen, die Schädelform der Sizilianer, speziell der armen und rebellischen, im Mittelpunkt einer besessenen Aufmerksamkeit. Von der Wissenschaft des frischgebackenen italienischen Staates wurde eine Erklärung gefordert, warum die kalabrischen, sizilianischen und sardischen Bauern so arm und so böse waren. »Das liegt ihnen im Blut«, sagten die Forscher. In den Windungen ihres Gehirns, da sei nichts zu machen. Es wäre ein Segen, gingen sie alle auf und davon nach Amerika.