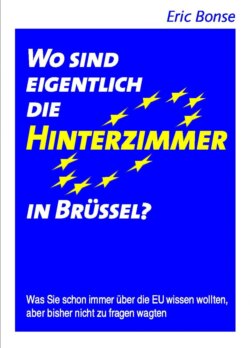Читать книгу Wo sind eigentlich die Hinterzimmer in Brüssel? - Eric Bonse - Страница 4
Wozu gibt es eigentlich Spitzenkandidaten?
ОглавлениеGesichter für die Wahlfreude
Stell Dir vor es ist Europawahl, und keiner geht hin! Das ist der Alptraum aller EU-Politiker, und er ist schon mehrfach wahr geworden. Beim letzten Urnengang 2009 gaben nur 43 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab, die Beteiligung sinkt seit der ersten Direktwahl 1979 kontinuierlich. Doch diesmal soll alles besser werden.
Das Zauberwort heißt: Europäische Spitzenkandidaten. Der Chef des Europaparlaments, Martin Schulz, sprach es als erster aus. Mit Hinweis auf den neuen EU-Vertrag von Lissabon, der dem Parlament mehr Macht gibt, forderte Schulz bisher Unerhörtes: Die Parteien sollten gemeinsame Spitzenkandidaten aufstellen - und der Wahlsieger solle dann zum nächsten Chef der EU-Kommission aufsteigen.
Die Idee dahinter ist so simpel wie einleuchtend: Nur durch gemeinsame Kandidaten, die in allen 28 EU-Ländern auftreten, lässt sich eine europäische Öffentlichkeit schaffen und eine EU-weite Debatte führen. Und nur durch das Versprechen, den Sieger zum Kommissionschef zu machen, erhält die Wahl eine tiefere Bedeutung. So wie bisher, mit rein nationalen Kandidaten und Debatten, lassen sich die Bürger nicht hinterm Ofen vor locken.
Die EU-Kommission stellte sich hinter den Vorstoß, doch der mächtige Rat, in dem auch Kanzlerin Angela Merkel sitzt, mauert. Bis heute ist nicht klar, ob Merkel und die anderen EU-Chefs das Spiel mitspielen. Ihr oberster Zeremonienmeister, Ratspräsident Herman Van Rompuy, äußert sich sogar ablehnend: „Ich bin kein begeisterter Anhänger dieser Idee mit den Spitzenkandidaten“, sagt er.
Zu spät: Schulz hat sich durchgesetzt, alle Parteien machen - wenn auch zum Teil widerstrebend - mit. Als erste schlugen die Sozialdemokraten zu und kürten Schulz zu ihrem Frontrunner. Kurz danach nominierten die Grünen José Bové und Ska Keller zu ihren EU-Spitzen. Auch die Linke zog mit; sie schickt den griechischen Eurokritiker Alexis Tsipras ins Rennen um die Wählergunst.
Die Nominierung lief nicht immer rund. Bei den Grünen nahmen nur rund 20.000 Menschen an einer europaweiten Urwahl nach US-Vorbild teil, manche Länder wie Österreich zogen gar nicht mit. Ausgerechnet die deutschen Grünen konterkarierten ihre EU-weit gewählten Spitzen mit einer nationalen Liste, die von Rebecca Harms angeführt wird.
Am chaotischsten lief die Nominierung aber bei Merkels Konservativen. Die Kanzlerin wollte zunächst gar keinen Spitzenkandidaten. Als sie sich schließlich auf den abgewählten Luxemburger Ex-Premier Jean-Claude Juncker einließ, kam es zu einer unerwünschten Gegenkandidatur aus Frankreich. Doch EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier konnte sich nicht gegen Juncker durchsetzen.
Nun darf Juncker gegen Schulz antreten - nur die beiden Kandidaten der großen Parteien haben echte Chancen, Kommissionspräsident zu werden. Doch auch dieses Duell hat seine Tücken. Zum einen torpediert Merkel die Idee der europaweiten Spitzen, indem sie sich selbst auf den Wahlplakaten zeigt - und eben nicht Juncker. Dabei steht die Kanzlerin in Europa gar nicht zur Wahl.
Zum anderen ist das Duell sehr deutschlastig. Schulz ist Deutscher, Juncker spricht deutsch, die großen TV-Debatten werden in deutscher Sprache abgehalten. In Frankreich war zunächst gar keine Live-Übertragung geplant, in den meisten EU-Ländern sieht es nicht besser aus. Ein bisschen ist es so, als würden nur die Kandidaten des „deutschen Europa“ miteinander streiten, zumal über allem das Bild von Mutti - Pardon: Merkel - schwebt.
Zudem sind Juncker und Schulz keine neuen Gesichter, sondern ziemlich alte „Hasen“ im Brüsseler Geschäft. Schulz verspricht zwar einen „Politikwechsel“ - weg von der harten Austeritätspolitik, hin zu einem sozialeren und grüneren Kurs. Doch als Parlamentschef hat er viele Sparpläne und neoliberale Reformen mit abgesegnet. Und Juncker zieht schon jetzt Ideen zurück, die Merkel stören könnten - zum Beispiel gemeinsame Anleihen (Eurobonds).
Um Kommissionschef zu werden, sind beide zudem auf Mehrheiten im neuen Europaparlament angewiesen. Da kommen dann die Liberalen ins Spiel, die sich mit ihrem Spitzenkandidaten Guy Verhofstadt - einem belgischen Föderalisten - schon als Königsmacher empfehlen. Grüne und Linke hingegen werden ausgegrenzt, von Piraten und anderen Freibeutern ganz zu schweigen. Was spitze begann, könnte so doch noch im üblichen Gekungel enden.