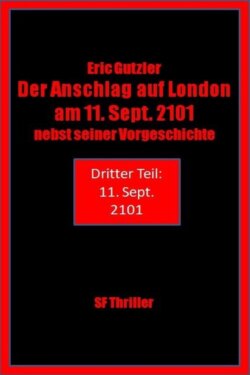Читать книгу Der Anschlag auf London am 11. Sept. 2101 nebst seiner Vorgeschichte - Eric Gutzler - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 38: 1:00 Uhr: Die leere Spielkarte
ОглавлениеSolveig war gegen Mitternacht zu Bett gegangen und hatte einen unruhigen Schlaf. Bald begann sie zu träumen. Sie träumte von Spielkarten. Sie betrat einen abgedunkelten Raum, ein beleuchteter Tisch tauchte auf, ein Platz war noch frei, es war ihr Platz. Sie saß am Tisch und hatte fünf Karten vor sich liegen. Drei hatte sie schon angesehen, nein, sie hatte sie nicht angesehen, sie wusste aber, dass sie zwei Buben und eine Dame besaß. Sie wollte jetzt die vierte Karte aufdecken, aber die Karte klebte auf dem grünen Filztuch fest und ließ sich nicht bewegen. Die anderen Spieler – wie viele es waren, konnte sie nicht erkennen, sie saßen alle im Schatten des Lichtkegels, aber O’Brien und Bouvier waren darunter – begannen, sie zu beschimpfen, sie solle sagen, ob sie mithalte oder aussteige. Sie musste gewinnen, um mit dem Geld O’Brien zu bestechen, er würde sie sonst zur Insel zurückbringen. Sie sah nach ihrem Stapel von Chips. Er war weg, sie besaß keine Chips mehr, was sollte sie tun?
„Wie hast du in der ersten Zeit nach deiner Flucht überlebt?“ hatte ihre Großtante Victoria bei einem ihrer Gespräche in Bergen gefragt. „Wie hast du dir Geld beschafft?“
„Nach wenigen Tagen als Kellnerin und Aushilfe in einem Laden erkannte ich, dass ich mit diesen Jobs nie genug Geld verdienen würde, um mir eine neue Identität mit Geburtsurkunde, Staatsangehörigkeit und einem Pass zu verschaffen. Ich begann, Poker zu spielen.“„Poker?“ „Es ist ein Spiel, bei dem man rasch viel Geld verdienen kann.“
„Aber auch verlieren“, wandte Victoria ein.
„Ich hatte mir das Spiel im Internet angesehen und nach kurzer Zeit begriffen, dass es kein reines Glücksspiel ist. Es gibt Gewinnstrategien. Die aufgedeckten Karten erlauben dem Spieler, Annahmen über die verdeckten Karten zu treffen. Außerdem hast du es bei dem Spiel überwiegend mit Männern zu tun. Das vereinfacht die Sache aus mehreren Gründen. Männer gehen höhere Risiken ein als Frauen, sie sind leichter auszurechnen und lassen sich ablenken. Männliche Pokerspieler sind oft Abenteurer und Verlierer, die ihren Traum vom schnellen Reichtum ohne Arbeit wahr machen wollen.“
Solveig versuchte, sich an einige Spieler zu erinnern, die ihr damals im Pokerzentrum in der Altstadt von Mumbai, dieser Stadthölle mit mehr als vierzig Millionen Einwohnern, besonders aufgefallen waren. Der Deutsche Kai Brauweiler zum Beispiel. Während der Schulzeit hatte er noch von einer Karriere als Tennisspieler geträumt, aber eine Schulterverletzung, die er sich beim Hallenturnen zugezogen hatte, warf ihn zurück. Mit achtzehn jobbte er im Sommer in einem Kasino in Belgien und lernte nebenher Poker. Mit dem im Kasino verdienten Geld wollte er eigentlich einen Tennistrainer finanzieren, aber stattdessen kaufte er sich fünf schnelle Rechner und begann, im Internet zu spielen – immer mehrere Partien gleichzeitig. Schnell wurde er süchtig, spielte rund um die Uhr, zerstritt sich mit seiner Freundin und ging tagelang nicht mehr vor die Tür. Nach zwei Jahren hatte er seine erste Million im Internet gemacht. Gewonnen hatte er sie nach den Regeln der Mathematik und mit Hilfe von Analyse-Programmen.
„Online-Spieler müssen analytisch vorgehen. Im Internet siehst du keinen Gegner, kannst ihre Mimik und Gestik nicht beurteilen. Deshalb ist die Anwendung der Spieltheorie außerordentlich wichtig, ja unumgänglich“, hatte er Solveig erzählt. „Es reicht nicht aus zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Vierling bei null Komma zwei und für einen Drilling bei vier Komma acht Prozent liegt. Das ist kleines Einmaleins. Ein Online-Spieler muss das Unwägbare einkalkulieren, er muss ausrechnen, wann sich ein Bluff rentiert. Aber dafür gibt es inzwischen wie beim Schach Programme.“
Später war es ihm vor dem Computer zu einsam geworden, und er hatte begonnen, an Turnieren teilzunehmen. Gewann er ein großes Turnier, nahm er eine Auszeit von einer Woche und genoss das Leben in einem Ferienhotel der Luxusklasse mit Champagner im Überfluss, verprasste aber nie mehr als die Hälfte des Gewinns. Obwohl er mit dieser Selbstdisziplin reich geworden war, war er angezogen, als lebte er in den Slums von Mumbai, trug zerrissene Hosen und zerlöcherte Turnschuhe. Tatsächlich jedoch hatte er eine Suite in einem der teuersten Hotels der Stadt angemietet. Da ihn die Atmosphäre der Turniere, bei denen gleichzeitig an fünfzig Tischen gespielt wurde, aufregte, hatte er die Gewohnheit angenommen, spät am Vormittag statt eines Frühstücks Cognac mit einer Cola zu mischen und diesen Cocktail in zwei Zügen runterzuspülen. Damit wollte er sich für den Spielstart beruhigen.
Ein ganz anderer Spieler war Dani Graves aus Schottland. Er vertraute beim Pokern auf altmodische Art seinem Instinkt und seiner Menschenkenntnis. Er rührte keinen Alkohol an und hatte beim Spiel stets eine Wärmekanne mit Gemüsesuppe dabei. Außerdem trug er eine Plastiktüte mit sich herum, die Nüsse und Bananen enthielt sowie ein dickes, zerlesenes Buch.
Mit dreizehn Jahren, so erzählte er Solveig nach einem erfolgreichen Tag, hatte er begonnen, in seiner Schule in Edinburgh Pokerspiele zu veranstalten, und knöpfte seinen Mitschülern kleine Beträge ab. Aber irgendwann stand ein Mitschüler mit eintausend neuen Euro in der Kreide. Um seine Schulden zu bezahlen, musste er Geld stehlen, stellte sich dabei dumm an und beichtete seinem Vater. Dani flog von der Schule, als er fünfzehn war. Er heuerte in einer Schnellimbisskette an und pokerte mit seinem Lohn. Mit achtzehn verabschiedete Dani sich Richtung Amerika. Er hielt sich für den Pokergott persönlich und ging nach Nevada.
„Ich war überspannt und selbstgefällig, kurz: ich spielte wie ein Idiot und verlor in kurzer Zeit fast alles, was ich in Schottland angehäuft hatte. Ich war einer der Trottel, die von den Profis ausgenommen werden. Richtig gute Zocker spielen nicht mit den Karten, sondern mit dem Gegner.“
Danach lernte er das Spiel ein zweites Mal. Er begriff, dass man beim Pokern nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen durfte, sondern nach den offenen Türen suchen musste. Er lernte, seine Gegner zu lesen, an ihren Gesten zu erkennen, ob sie ein gutes Blatt hatten oder es nur vortäuschten. Im Alter von einundzwanzig Jahren gewann er sein erstes großes Turnier und verlor den Gewinn in der folgenden Nacht wieder, weil er sich mit Alkohol zuschüttete und trotzdem zum Spaß mit ein paar Freunden spielte.
„Seitdem rühre ich keinen Alkohol mehr an“, sagte er zu Solveig und hielt die Wärmekanne hoch.
„Was ist das für ein Buch, das du beständig mit dir herumträgst?“ hatte sie gefragt, ohne auf das Thema Alkoholsucht einzugehen.
„Ein uralter Roman. Krieg und Frieden. Ein Roman aus Russland. Wenn mir danach ist, schlage ich irgendeine Seite auf und lese fünf oder zehn Seiten weiter. Der Roman ist so verwickelt und umfasst so viele Personen, dass es völlig gleichgültig ist, wo man einsetzt.“
Dani Graves war einer der Favoriten des Turniers in Mumbai, bei dem ein Spieler nur zwei Karten erhielt und sie mit fünf Karten, die der Croupier nach und nach offen auf den Tisch legte, kombinieren konnte. Vor der ersten Karte, nach der dritten, vierten und fünften konnte jeder Spieler so viel setzen, wie er wollte. Wer das beste Blatt besaß, gewann. Nach einer Minute waren die meisten Partien entschieden. Graves und Brauweiler gehörten zu einer Schar von etwa zweihundert Spielern, die durch die Welt zogen und die großen Turniere abklapperten: Im Winter spielten sie in Indien und Australien, im Sommer in Nordamerika.
„Mein erstes großes Turnier in Mumbai war ein offenes Turnier“, erzählte Solveig ihrer Großtante, „ich musste mich in Vorkämpfen qualifizieren, um zugelassen zu werden. Als ich nach der Hälfte des Turniers soviel gewonnen hatte, dass ich davon ein Jahr leben konnte, stieg ich aus. Das Geld, das ich brauchte, um unabhängig leben zu können, verdiente ich mir später mit Golfspielen. Dazu hatte mir übrigens ein Pokerspieler in Mumbai geraten, der sich zwischen den Turnieren mit Golf fit hielt. Manchmal bin ich später noch zu Pokerturnieren gegangen, aber mehr um das Verhalten der Spieler zu beobachten, als um zu gewinnen.“
Einer der Spieler, dessen Gesicht Solveig in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, war aufgestanden und hatte ihr ein Angebot gemacht: „Wenn du keine Jetons mehr hast, kann ich dir welche geben. Aber ich verlange eine Gegenleistung.“
Bei diesen Worten waren zahlreiche Lampen angegangen, und Solveig sah, dass sie sich in einem Spielkasino befand. Alle Spieler an den anderen Tischen hatten ihre Spiele unterbrochen und starrten sie an.
„Was verlangen Sie von mir?“
„Du musst einen Mann töten.“
Inzwischen standen die Spieler von den anderen Tischen um sie herum und schrien: „Du musst tun, was wir alle getan haben. Du musst einen Mann töten.“
Nach Solveigs Bemerkung über ihren Ausstieg beim Turnier in Mumbai hatte die Unterhaltung mit ihrer Großtante eine andere Wendung genommen. Sie waren nach einem langen Schneespaziergang auf dem Flǿyen angelangt, und Victoria zeigte ihr die Altstadt von Bergen und den Hafen. Die Sonne brach durch, und die Stadt präsentierte sich von ihrer schönsten Seite. Erst nach ihrer Rückkehr kam Solveig am Abend während des Essens auf das Pokern zurück: „Das Gute an dem Spiel ist, dass es jeder schnell lernen kann. Das Gefährliche ist, dass jeder genauso schnell denkt, er beherrsche das Spiel. Abenteurer und Verlierer, Enttäuschte und Egomanen, die nach oben wollen und ihren Traum vom schnellen Reichtum ohne Arbeit wahr machen möchten, bevölkern daher die Turniere, aber auch Feiglinge und Draufgänger, die in einfache Fallen tappen. Ob man gewinnt oder verliert, hat aber nicht nur mit Glück zu tun. Auf Dauer erhält jeder gleich gute wie schlechte Karten.
Beim Pokern geht es um Wetten mit unvollständigen Informationen. Permanent muss man den Wert seines Blattes kalkulieren: Lohnt es sich zum Beispiel, mit einer Karo Neun und einer Herz Zehn weiterzuspielen? Wie oft kann aus zwei Paaren ein Drilling und ein Paar werden, also ein Full House? Und die Entscheidung muss man immer in Bezug zur Summe des gesetzten Geldes treffen und berücksichtigen, dass über einhundert Millionen Kombinationen möglich sind.“
„Gibt es immer noch die berühmten Unterschiede zwischen den Geschlechtern?“
„Oh ja! Männer neigen deutlich mehr als Frauen zur Spekulation. Und sie neigen zur Überschätzung der eigenen Prognosefähigkeiten. Zudem stimmt es auch, dass diese Überschätzung bei jüngeren Männern besonders hoch ausfällt.“
„Vermutlich lässt sich der Einfluss des Alters leicht mit der fehlenden Erfahrung erklären. Denn es ist genau die Erfahrung, die einen lehrt, dass die eingebildete Kontrolle eben doch nicht vorhanden ist.“
„Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn Männer in eine Situation mit hohen Verlusten geraten, die sie nur ungern sich selbst, ihrer Ehefrau oder einem Geldgeber eingestehen wollen, haben sie neben der Möglichkeit, einzugestehen und zu verlieren, die Alternative weiterzuspielen und somit zumindest die theoretische Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Mein Eindruck ist, dass Männer im Verlustbereich deutlich risikofreudiger handeln, als wenn sie sich im Gewinnbereich befinden, obwohl sie oder vielleicht auch weil sie in solchen Verlustsituationen kaum noch realistische Einschätzungen abgeben können.“
Solveig dachte an Tasha Maltby, eine der Spielerinnen des Turniers in Mumbai. Tasha war ein Gelegenheitsmodel aus Malta und hatte vor kurzem noch bei einem Versender Waren eingepackt. Vor einem Jahr hatte sie ein Turnier im Fernsehen verfolgt und danach Spielversuche im Internet gemacht. Sie startete zum zweiten Mal bei einem großen Turnier, hatte etwas Geld gespart und witterte die Chance, auf einen Schlag genug Geld zu scheffeln, damit sie davon die nächsten dreißig Jahre leben konnte.
„Wenn ich den ersten Tag überstehe, kann ich gewinnen“, sagte sie zu Solveig, während sie an den Fingernägeln kaute.
Von den fünfhundert Spielern, die das Turnier begonnen hatten, waren am Ende des ersten Tages fast einhundert ausgeschieden, zu Beginn des dritten Tages waren noch knapp zweihundert dabei. Auch Tasha hatte den zweiten Tag überstanden und hatte schon ein Preisgeld zusammen, das nach Solveigs Erinnerungen etwa fünfhunderttausend neuen Euro entsprach und deutlich höher war als ihr eigenes Spielergebnis.
„Ich zittere am ganzen Körper, weil mein verrückter Traum wahr wird“, sagte sie zu Solveig am Morgen vor der dritten Spielrunde. „Was für ein Glück, dass hier überwiegend Männer spielen. Männer sind so einfach gestrickt. Wenn ich mich sexy anziehe, setzen sie mehr. Arsch und Titten machen sie high.“
Sie hatte ein Bustier mit Tigerfellstreifen angezogen, dazu eine Leinenhose ohne Slip und Stöckelschuhe. Am vierten Tag, an dem Solveig nicht mehr spielte, trug Tasha ein schwarzes Seidenkleid mit einem Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel ging und keinen BH erlaubte. Als Kai sie sah, bemerkte er zu Solveig: „Tasha will die Männer in den Wahnsinn treiben, die Maus präsentiert heute ihre Brüste. Sie hat gestern ganz ordentlich gespielt, aber sie ist zu unerfahren, um das Turnier zu gewinnen.“
„So ist es“, fügte Dani hinzu, „ihre naive Begeisterung, die sie bisher durchs Turnier getragen hat, wird nicht genügen. Sie ist zu gierig, der Druck wird sie auffressen.“
So war es auch. Als nur noch dreiundsechzig Spieler dabei waren, drängelten sich die Zuschauer um ihren Tisch. Tasha führte und hatte zweihundertzehntausend in den Pott geschoben. Auf dem Tisch lagen ein König, eine Dame, eine Zehn und eine Fünf. Um daraus eine Straße zu machen, hätte man ein Ass und einen Buben gebraucht. Gequält drehte Tasha ihre Karten um, denn sie hatte zwar ein As, aber keinen Buben. Ihr Gegner dagegen schob ein As und einen Buben in die Mitte. Zuschauer zeigten Schadenfreude, und einer sagte: „Brauchst du Geld, Tasha? Hast ein schönes Kleid an. Ich gebe dir tausend, wenn du es ausziehst.“
Sie verlor die Selbstkontrolle, am Ende des Tages hatte sie noch achtzigtausend.
Solveig erzählte ihrer Großtante die Geschichte von Tasha. „Am Ende sagte sie mir, sie habe bluffen wollen und dabei vergessen, dass sie eine Frau war. Bei Frauen könne man immer erkennen, was sie gerade dächten. Aber darin unterscheiden sich Männer und Frauen nicht allzu sehr. Auch bei Männern kann man, wenn man sie genau beobachtet, erkennen, ob sie schauspielern und nichts auf der Hand haben. Die meisten übertreiben beim Bluffen und verraten ihre Unsicherheiten oder ihre Verzweiflung durch versteckte Gesten.“
„Du hast“, versetzte Victoria, „den Einsatz von Computerprogrammen erwähnt. Werden sie bei Turnieren benutzt?“
„Es ist offiziell verboten, sie zu benutzen. Aber es ist bekannt, dass sich die Spieler nicht an das Verbot halten. Die Programmchips sind wie beim Schach so klein, dass man sie im Gebiss implantieren kann, die Kamera sitzt unter einem Fingernagel und ein Lautsprecher im Gehörgang. Eine Kontrolle wäre nur möglich, wenn man jeden Spieler sorgfältig untersucht, die Durchleuchtung mit einem Körperscanner genügt nicht mehr. Da sich die Programme aber gegenseitig zu neutralisieren scheinen, hat man das Verbot stillschweigend aufgehoben. Denn in Stresssituationen, wenn die aufgedeckten Karten nicht den vorausberechneten Eintrittswahrscheinlichkeiten entsprechen, muss der Spieler seine Entscheidung schnell treffen und begeht natürlich Fehler. Es kann nur einer gewinnen, die anderen verlieren, und wenn man plötzlich am Abgrund steht, hat man Angst. Jeder hat dann Angst. Männer, die vollkommen stoisch bleiben und nichts verraten, trifft man äußerst selten an.“
Solveig machte eine kurze Pause, bevor sie fortfuhr: „Der Einsatz dieser Programme hat mir nicht gefallen. Ich glaube, das war einer der Gründe warum ich mit dem Pokern aufhörte.“
Die Stimmung war bedrohlicher geworden, auch das Licht hatte sich verändert. Die den Tisch umstehenden Spieler machten feindliche oder verächtliche Bemerkungen. Das Licht hatte seinen warmen Gelbton verloren und beleuchtete den Spieltisch mit einem kalten Weißgrau. Dagegen waren die anderen Tische wieder in der Dunkelheit versunken. Solveig saß noch immer an ihrem Platz und versuchte, die Karte aufzunehmen. Wo der Direktor gestanden hatte, drängelte sich eine Frau nach vorne. Es war Tasha. Sie blickte Solveig an und sagte: „Wenn du überleben willst, musst du sein Angebot annehmen. Oder mach es wie ich.“
Sie ließ ihr Kleid zu Boden gleiten. Ihr nackter Körper war schneeweiß, doch allmählich entstanden Muster auf der Haut, bis sie über und über mit Spielkarten tätowiert war. Die Spielkarten begannen, sich zu bewegen; es schien, als würden die Könige, Damen und Buben miteinander reden oder gegeneinander kämpfen. Plötzlich sprangen einige von den Königen und Buben auf den Spieltisch und verdeckten die dort ausgelegten spielbestimmenden Karten. Tasha begann sich aufzulösen. Zuletzt verschwanden ihre Augen.
Solveig wandte ihren Blick ab, sie wollte sich auf keinen Fall ausziehen und zerrte an der festklebenden Spielkarte. Ihr Leben hing davon ab, die letzte Karte zu sehen. Sie brauchte eine Dame. Mit einer Dame würde sie ihr verlorenes Geld zurückgewinnen.
Plötzlich riefen einige Männer: „Sie ist ein Cyborg, sie betrügt uns, sie kann durch unsere Karten hindurchsehen. Bringt sie um!“
Solveig blickte nach unten und sah, dass ihr Kleid durchsichtig geworden war. Nein, nicht nur ihr Kleid, sondern auch ihre Haut. Sie sah ihre Knochen und Adern, aber die Knochen waren aus Stahl und die Adern aus Plastik. Sie war kein Mensch, sondern eine Maschine.
Heftiger zerrte sie an der Spielkarte. Endlich gelang es ihr, sie aufzunehmen und zu betrachten. Die vierte Karte war leer.