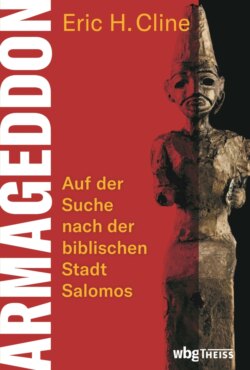Читать книгу Armageddon - Eric H. Cline - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
Оглавление„Willkommen in Armageddon“
Das ganze Jahr über bietet sich jeden Morgen dasselbe Schauspiel: Kurz nach 9 Uhr treffen die ersten Reisebusse in Megiddo ein, denen jeweils 50 Touristen entsteigen. Wenn die Ausgrabungsstätte um 17 Uhr ihre Pforten wieder schließt, werden es mehrere Dutzend Busse gewesen sein und viele Hundert Besucher. „Willkommen in Armageddon“, verkünden die Fremdenführer, bevor sie ihre Herde den steilen Abhang hinauftreiben und durch das antike Stadttor marschieren lassen. Sie rezitieren ihre eingeübten Sätze, und bald haben sie den ersten Haltepunkt erreicht. Die Gruppe schnauft und holt Luft, und oft sind Leute dabei, die spontan ein Kirchenlied anstimmen oder zu beten beginnen, vor allem, wenn sie eigentlich auf dem Weg nach Nazareth sind, das am entgegengesetzten Ende der Ebene liegt.
Wir, eine kleine Gruppe von Archäologinnen und Archäologen, lächeln und geben uns tolerant. Wir waren bereits vor Ort, bevor die Sonne aufging. Mit Spitzhacken, Kellen und Kehrblechen bewaffnet, verbarrikadiert hinter Eimern und Schubkarren voll frisch ausgehobener Erde, spielen wir unser Spiel, das nie langweilig wird: Wir versuchen auf 50 Meter Entfernung die Nationalität der Touristengruppe zu erraten, die gleich an unserer Ausgrabung vorbeikommen wird. Von der nahe gelegenen Aussichtsplattform aus können die Besucher auf der einen Seite die gesamte Jesreelebene überblicken, auf der anderen Seite schauen sie in den tiefen Graben, den unsere Vorgänger, die Ausgräber aus Chicago, angelegt haben. Am Maschendrahtzaun, der Touristen nur selten vom Betreten des Areals abhält, wo gegraben wird, hängt ein Schild: „Die Archäologen bitte nicht füttern.“ Das ist natürlich ein Scherz. Auch wenn es uns nicht jedes Mal gelingt, ihre Nationalität zu raten, können wir immer noch hoffen, dass die Touristen ein paar Kekse für uns übrig haben.
Megiddo wird im Alten Testament ein Dutzend Mal erwähnt und in anderen antiken Texten noch viel häufiger, doch bekannt ist es vor allem aus dem Neuen Testament, als Schauplatz der vorletzten Schlacht zwischen den Armeen von Gut und Böse. In Offenbarung 16,16 erfahren wir über die zwei widerstreitenden Mächte, sie würden dereinst „versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Harmagedon“.1 Der Name Armageddon kommt von Har Megiddo, das ist Hebräisch für „Hügel“ oder „Berg“ (har) von Megiddo. Bis zum Mittelalter hatten diverse Länder, Sprachen und Jahrhunderte ein N hinzugefügt, sodass aus Har Megiddo zunächst Harmageddon wurde. In der Moderne verschwand schließlich noch das H.2
In gewisser Weise gab es in Megiddo zahlreiche Armageddons: Im Laufe der Jahrtausende musste immer wieder eine Kultur, Volksgruppe oder politische Einheit einer anderen weichen – eine Welt ging unter, eine neue entstand. Das begann mit den Kanaanitern, die von den Israeliten abgelöst wurden, dann kamen die Neuassyrer, die Neubabylonier, die Perser, die Griechen und die Römer, später die Muslime, die Kreuzfahrer, die Mongolen, die Mamluken und die Osmanen. Die letzten Kriege hier waren der Erste Weltkrieg und der Israelische Unabhängigkeitskrieg von 1948.3 Doch was die Touristen sehen wollen, ist natürlich die berühmteste Inkarnation der Stadt: das Armageddon des Neuen Testaments.
Der antike Siedlungshügel ragte einst mehr als 36 Meter über den umliegenden Feldern auf, der höchste Punkt lag im Norden. Im Jahr 1904 war ein Besucher der Stätte überrascht, wie hoch der Hügel war. Anstelle der niedrigen Erhebung, die er erwartet hatte, fand er „einen richtigen Berg“ vor, der „über der Ebene thront“. Die Archäologen aus Chicago machten den Hügel ein wenig niedriger, indem sie die obersten Siedlungsschichten abtrugen. Dennoch erhebt er sich nach wie vor 20 Meter über der Jesreelebene und ist noch aus großer Entfernung gut zu sehen.4
Frühe Fotografien zeigen den Hügel in seinem ursprünglichen Zustand (Abb. 1), noch unberührt von den Schaufeln und Hacken der Ausgräber und ohne die gewaltigen Haufen ausgehobener Erde, die heute das Areal verunzieren. Diese Fotos wurden nördlich von Megiddo aufgenommen. Aus der Ferne erkennt man zwei verschiedene Ebenen: eine untere Ebene mit einer exakt horizontalen Terrasse auf halber Höhe des Hügels (hier hat Gottlieb Schumacher, der erste Ausgräber Megiddos, die Überreste einer Befestigungsmauer gefunden, die einst die Stadt vor Angreifern schützte) und eine etwas kleinere obere Ebene, die direkt darüber liegt, wie die obere Etage eines Hauses oder die obere Schicht einer Torte.5
Abb. 1: Frühes Foto von Megiddo
Heute wissen wir, dass sich in dem Hügel Reste von mindestens 20 antiken Städten verbergen, die im Laufe von fast 5000 Jahren errichtet wurden, von etwa 5000 v. Chr. bis kurz vor 300 v. Chr., und zwar immer eine auf den Überresten der letzten. Die verschiedenen Ausgräber haben jeder dieser Siedlungsschichten eine römische Ziffer zugeordnet, durchlaufend von I bis XX. Schicht I, ganz oben, ist die jüngste und stammt aus der Perserzeit. Schicht XX, direkt über dem gewachsenen Fels, ist die älteste und datiert in die Jungsteinzeit. Die Schichten dazwischen waren in der Kupfersteinzeit, in der Bronze- und in der Eisenzeit besiedelt, also auch zur Zeit der Kanaaniter und Israeliten (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1. Chronologie der Kulturperioden des Alten Orients in Bezug auf die Stratigrafie von Megiddo (nach Ussishkin 2018, 15; ungefähre Daten)
| Epoche | Schichten (Megiddo) | Ungefähre Daten | Bekannt für: |
| Neolithikum und Chakolithikum | XX | 5000–3400 v. Chr. | Domestizierung von Pflanzen und Tieren, Erfindung der Keramik, Verwendung von Kupfer |
| Frühe und Mittlere Bronzezeit | XIX–XIV | 3400–2000 v. Chr. | Erfindung/Verwendung von Bronze, Schrift, erste Städte |
| Mittlere Bronzezeit | XIII–X | 2000–1550 v. Chr. | Kanaaniter, Hyksos |
| Späte Bronzezeit | IX–VII | 1550–1130 v. Chr. | Ägyptisches Neues Reich |
| Israeliten (Eisenzeit) | VI–IV | 1130–734 v. Chr. | Frühe Israeliten, Davidisch-salomonisches Großreich, Nord-/Südreich Israel |
| Neuassyrer | III–II | 734–600 v. Chr. | Neuassyrisches Reich, Zerstörung Israels |
| Neubabylonier und Perser | I | 600–330 v. Chr. | Neubabylonisches Reich, Zerstörung Jerusalems, Kyros II. |
| Hellenismus | 330–30 v. Chr. | Seleukiden und Ptolemäer, Makkabäer | |
| Rom/ Byzanz | 1.–6. Jh. n. Chr. | Jüdischer Krieg und Bar-Kochba-Aufstand, (erneute) Zerstörung Jerusalems |
Keinem von uns fällt es leicht, jeden Morgen um 5 Uhr auf der Ausgrabungsstätte zu erscheinen. Doch uns bleibt nichts anderes übrig, wenn wir unseren achtstündigen Arbeitstag beenden wollen, bevor es zu heiß zum Arbeiten ist. Und so klingeln in dem Kibbuz, in dem wir untergebracht sind, jeden Tag in aller Herrgottsfrühe die Wecker. Bis 4:35 Uhr haben wir mehrere große Busse und eine kleine Armada von Autos bestiegen, wobei eine Armada von kleinen Autos vielleicht die passendere Bezeichnung ist. Alles in allem sind wir fast 120 Personen – das Grabungspersonal, das aus professionellen Archäologen und Doktoranden besteht, sowie die ehrenamtlichen Helfer, die allen möglichen Berufsgruppen angehören: Ärzte, Anwältinnen, Krankenschwestern, Buchhalter, Lehrerinnen, Studierende, die „schon immer mal“ bei einer Ausgrabung dabei sein wollten.
Nach nicht ganz einer halben Stunde erreichen wir Megiddo und stellen unsere Autos auf dem Parkplatz neben dem Besucherzentrum ab, das aus den Überresten des Gebäudes errichtet wurde, das das Team aus Chicago Anfang der 1920er-Jahre nutzte. Heute verfügt es über ein Restaurant, Toiletten, mehrere Andenkenläden und zwei Ausstellungsräume, in denen die Geschichte der Ausgrabung nachgezeichnet wird. Hier steht auch ein Modell der antiken Stätte.
Wir erklimmen den antiken Hügel und schleppen unsere Grabungswerkzeuge, Wasserbehälter und andere Vorräte hinauf. Wir durchqueren das spätbronzezeitliche Stadttor, das zur Zeit des ägyptischen Ketzer-Pharaos Echnaton im 14. Jahrhundert v. Chr. errichtet wurde, und nehmen denselben Weg wie später die Touristen, bis wir das Plateau des Hügels erreichen. Das mit Palmen übersäte Areal ist, so weit das Auge reicht, von einem Gewirr antiker Ruinen bedeckt.
Wir stellen Stangen auf, die schwarze Sonnensegel tragen, nippen am Kaffee, kauen auf Müsliriegeln herum und sehen zu, wie die Sonne hinter dem Berg Tabor aufgeht und den Frühnebel am Boden der Jesreelebene vertreibt. Bereits jetzt ist es über 20 Grad warm. Wenn wir am frühen Nachmittag wieder aufbrechen, ist es heiß wie in einem Backofen. Der Gedanke, dass wir tatsächlich im apokalyptischen Armageddon arbeiten, liegt nicht allzu fern; dabei haben wir es noch ganz gut, denn es ist erst Juni. Richtig heiß wird es erst im August. Dann ist niemand mehr verrückt genug, hier zu graben. Nicht einmal wir Archäologen.
Zwanzig Jahre lang, von 1994 bis 2014, war Megiddo mein zweites Zuhause. Beinahe so lange, wie ich mit meiner Frau, Diane Harris Cline, verheiratet bin, habe ich auf dem Gelände gegraben, als Mitglied einer Expedition der Universität von Tel Aviv. Diane war es, die damals den Flyer entdeckte, der dafür warb, haupt- oder ehrenamtlich an einer neuen Grabung in Megiddo teilzunehmen. Ich war aus mehreren Gründen daran interessiert. Neben der Tatsache, dass Megiddo seit nunmehr über hundert Jahren den Brennpunkt der Biblischen Archäologie bildet, war es vor allem James Micheners Buch Die Quelle, das ich sechsmal gelesen habe und das meine Berufswahl maßgeblich beeinflusst hat. Der Roman kam 1965 auf den Markt, wurde ein weltweiter Erfolg und stand fast ein Jahr lang auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Darin schildert Michener auf höchst dramatische Weise die Geschichte einer archäologischen Stätte in Israel und die Erlebnisse der Archäologen, die dort gruben. Auch wenn seine Ausgrabungsstätte mit Namen „Makor“ (hebräisch für „Quelle“) fiktiv ist, besuchte Michener im Laufe des Jahres 1963, das er mit Recherchen und Schreiben zubrachte, neben zahlreichen weiteren antiken Stätten auch Megiddo. Für jeden, der sowohl mit Makor als auch mit Megiddo vertraut ist, sind die Parallelen nur allzu offensichtlich.6
Auch Micheners fiktive Archäologen sind realen Vorbildern nachempfunden. So kommt John Cullinane, der Grabungsleiter in Makor, „vom Biblischen Museum in Chicago“ – das kann nur eine Anspielung auf den herausragenden Ägyptologen James Henry Breasted sein, den Gründer und Direktor des Oriental Institute at the University of Chicago, der stets einen Dreiteiler, eine randlose Brille und einen eleganten Schnurrbart trug (Abb. 2). Er war es, der in den Jahren 1925 bis 1939 die Grabungsteams, um die es in diesem Buch geht, nach Megiddo schickte.
Als ich mich von der Ausgrabung zurückzog, waren nur Israel Finkelstein, der Doyen der israelischen Archäologie, der seit 1992, von Beginn an, einer der Leiter des Projekts ist, und David Ussishkin, sein langjähriger Kollege, länger vor Ort als ich. Während zehn Grabungssaisons in 20 Jahren habe ich in den meisten Bereichen, die wir in Megiddo erschlossen, auch selbst gegraben, und dabei habe ich mich bis ganz nach oben gearbeitet, vom ehrenamtlichen Grabungshelfer bis zum zweiten Grabungsleiter neben Finkelstein.
Abb. 2: James Henry Breasted
Unsere Tochter Hannah begleitete uns erstmals, als sie 18 Monate alt war. Sie buddelte in der Erde herum, mit einer Kelle, die in ihren Händchen riesig aussah, und in einem viel zu großen T-Shirt, auf dem stand: „Ich habe Armageddon überlebt.“ Unser Sohn Joshua kam fünf Jahre, nachdem ich zum Grabungsteam gestoßen war, zur Welt, und er war mit in Megiddo, als ich die ersten Kapitel dieses Buches schrieb – als er 18 wurde, hatte er fast so viele Geburtstage auf Ausgrabungen in Israel gefeiert wie zu Hause in den USA.
Wir waren die vierte Gruppe von Ausgräbern, die im Laufe des letzten Jahrhunderts in Megiddo grub. Der erste Ausgräber war Gottlieb Schumacher, ein US-Amerikaner deutscher Abstammung, dessen Grabung von 1903 bis 1905 von der Deutschen Orient-Gesellschaft und dem Deutschen Verein zur Erforschung Palästinas gefördert wurde. 20 Jahre später, im Jahr 1925, kamen die Ausgräber aus Chicago, um die es in diesem Buch größtenteils geht. Sie waren wild entschlossen, Salomos Stadt zu finden, und verbrachten 15 Grabungssaisons in Megiddo, bis der Zweite Weltkrieg ausbrach.
Der namhafte israelische Archäologe Yigael Yadin leitete die dritte Expedition zur Erforschung des antiken Siedlungshügels. Er kam in den 1960er- und 1970er-Jahren mit seinen Doktoranden hierher, um in mehreren Grabungen verschiedene Hypothesen zu prüfen, nicht zuletzt die Frage, ob sich in Megiddo Bautätigkeiten König Salomos identifizieren ließen.7
Und dann begann unsere eigene Tel-Aviv-Expedition, unter der Leitung von Israel Finkelstein und David Ussishkin. Im Jahr 1992 gab es zunächst eine Probegrabung, 1994 ging es dann richtig los.8 Genau wie alle anderen Archäologinnen und Archäologen, die vor uns in Megiddo gegraben hatten, hofften wir, der Vergangenheit neue Geheimnisse zu entreißen. Unter anderem wollten wir die verschiedenen Schichten genauer datieren, um ein akkurateres Bild von den historischen Abläufen zu erhalten. Wir suchten aber auch Antworten auf spezifischere Fragen: Was aßen die Bewohner in einer bestimmten Epoche? Was trugen sie? Wovor fürchteten sie sich, woran glaubten sie? Auch wenn viele unserer Erkenntnisse nach wie vor umstritten sind und es mitunter frustrierend ist, wie wenig Gewissheit wir haben, lassen neue archäologische Untersuchungsmethoden viele Funde inzwischen in einem neuen Licht erscheinen und liefern neue Daten für Megiddo, häufig auf mikroarchäologischer Ebene.9 Zuletzt bezog sich eine ganze Reihe von Fragen auf Finkelsteins umstrittene Hypothese, dass ein Großteil der Funde von verschiedenen Grabungsstätten, unter anderem Megiddo, die man bislang in die Zeit Salomos im 10. Jahrhundert v. Chr. datiert, in Wirklichkeit aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. stammen, der Zeit von Omri und Ahab. Diese sogenannte Low-Chronologie-Hypothese wird unter Archäologen nach wie vor heiß diskutiert.10
Da man in Megiddo inzwischen seit mehr als 100 Jahren gräbt, sind praktisch alle Gebäude, die auf dem Gelände freigelegt worden sind, Gegenstand zahlreicher Artikel und wissenschaftlicher Debatten, was ihre Form, Funktion und insbesondere ihre Datierung betrifft – von den Stadttoren der einzelnen Siedlungsschichten über den Wassertunnel, die Ställe und die Paläste bis hin zu den Wohnhäusern.11
Wie in der Archäologie gang und gäbe, muss man viele Erkenntnisse der früheren Ausgräber über ihre Entdeckungen in Megiddo angesichts neuerer Diskussionen auf den Prüfstand stellen. Sogar die abschließenden Publikationen des Teams aus Chicago, insbesondere die beiden Bände, die man für gewöhnlich schlicht als Megiddo I und Megiddo II bezeichnet, wurden praktisch ab dem Moment, als sie 1939 und 1948 veröffentlicht wurden, kontrovers diskutiert. Einige unserer eigenen Grabungsschnitte haben wir deshalb in Bereichen angelegt, von denen wir hofften, dass sie einige Streitfragen klären und genauere Antworten liefern könnten.
Die Archäologen aus Chicago gruben sich durch den kompletten Hügel, bis zum anstehenden Fels. Grabungsleiter war zuerst Clarence Fisher, dann Philip Langstaffe Ord Guy (meist der Einfachheit halber P.L.O. Guy genannt) und schließlich Gordon Loud; alle drei wurden von Breasted nach Megiddo geschickt. Breasted war vor allem an den Überresten zweier Städte interessiert: der Stadt Salomos, die der König laut Altem Testament im 10. Jahrhundert v. Chr. befestigen ließ, und der Stadt, die fast 500 Jahre zuvor, 1479 v. Chr., der ägyptische Pharao Thutmosis III. erobert hatte.
Doch die Suche nach Salomo und Thutmosis III. gestaltete sich nicht so einfach wie erwartet. Was das Chicagoer Team ausgrub, lieferte nur selten Antworten auf seine Fragen, und wie in der Archäologie so häufig der Fall, machte es zahlreiche unerwartete Entdeckungen. In manchen Jahren fanden sie so gut wie nichts außer Überreste von Gebäuden und Tausende Tonscherben, die höchstens für sie selbst und andere Archäologen von Interesse waren. Aber es gab auch Jahre, in denen ihre Entdeckungen die Titelseiten von Zeitungen auf der ganzen Welt zierten, insbesondere als sie verkündeten, sie hätten die legendären „Ställe Salomos“ gefunden.
Obwohl dieses Team zum größten Teil aus Architekten und Geologen bestand, die lediglich eine Zusatzausbildung in Archäologie und Keramikkunde erhalten hatten, war es eines der besten, die zur damaligen Zeit im Nahen Osten gruben. Den Mitarbeitern gelang es, die gesamte Chronologie von Megiddo zu erfassen, von der Jungsteinzeit bis zur Perserzeit, und auch die späteren römischen Gräber und weitere Überreste. Dabei verwendeten sie damals modernste Techniken: Sie nutzten die Ballonfotografie, erstellten ein Schichtenprofil und definierten die Farben des Erdbodens mit dem Munsell-Farbsystem. Ihre Entdeckungen und Innovationen hallen in der Biblischen Archäologie bis heute nach.
Die wissenschaftlichen Publikationen der Ausgräber aus Chicago beinhalten die Schlüsse, die sie aus den Ergebnissen ihrer Ausgrabungen zogen. Ihre Entdeckungen sind zu Recht berühmt, sie fanden Ställe, Elfenbein und einen beeindruckenden Wassertunnel. Die Bücher und Artikel, die sie veröffentlichten, werden noch heute von Archäologinnen und Archäologen rezipiert und diskutiert. Doch was die Teammitglieder tagtäglich taten und was in Megiddo abseits der Funde vor sich ging, verraten sie uns kaum.
Glücklicherweise hinterließen sie aber darüber hinaus eine regelrechte Schatzkammer weiterer Schriften – Briefe, Telegramme, Tagebücher, Karten und Notizen aus mehr als drei Jahrzehnten. Als ich dieses Archivmaterial sichtete, das im Oriental Institute, im Rockefeller Archive Center, bei der Israelischen Altertumsbehörde und anderswo aufbewahrt wird, wurde mir klar, dass es uns einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen gewährt. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in Amerika und der wachsenden Probleme und Spannungen im britischen Mandatsgebiet Palästina erhalten wir einen Einblick in die frühen Jahre der biblischen Archäologie zwischen den beiden Weltkriegen. Wir erfahren, wie die Archäologen arbeiteten, welche Werkzeuge und Techniken sie verwendeten; in mancherlei Hinsicht unterscheidet sich dies sehr von dem, was wir heute tun, aber manches hat sich überhaupt nicht verändert.
Und so nahm meine Recherche für dieses Buch mit einem Mal eine ganz unerwartete, spannende Wendung. Ich wollte ursprünglich lediglich über die Archäologie von Megiddo schreiben, wollte die einzelnen Siedlungsschichten und Gebäude beschreiben, vom Beginn der Besiedlung bis zum Ende, und hatte gar nicht vor, mich allzu viel um die Menschen zu kümmern, die die antiken Überreste zutage gefördert haben. Doch die Fülle von Details und Informationen, die die Briefe, Tagebücher, Telegramme und Notizen der Ausgräber aus Chicago mir boten, enthüllten so viel darüber, was abseits der eigentlichen archäologischen Entdeckungen auf der Ausgrabungsstätte vor sich ging, dass ich beschloss, die Ausgräber und ihre Arbeit in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen zu stellen (oder ihnen zumindest genauso viel Beachtung zu schenken wie ihren Funden).12
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, wie sehr ich die Arbeit der Archivarinnen und Archivare zu schätzen gelernt habe, die einem naiven Forscher, der ihnen ohne Ende Fragen stellte, auf die es meistens eine ganz naheliegende Antwort gab, stets ausgesprochen freundlich und geduldig begegneten. Zu meiner großen Überraschung und Freude fand ich ganz unerwartete Parallelen zwischen der Recherche in Archiven und einer archäologischen Ausgrabung – ich wühlte mich halt nur durch Papier statt durch Sand und Erde. Genau wie bei einer Ausgrabung, bei der die Existenz (oder das Fehlen) eines einzigen Objekts manchmal einen enormen Unterschied machen kann, tauchen auch bei der Arbeit im Archiv statt einer Antwort plötzliche viele neue Fragen auf. Es ist genauso aufregend, etwas zu entdecken, vor allem, wenn man überhaupt nicht damit rechnet; es ist genauso niederschmetternd, nichts zu finden, obwohl die Suche vielversprechend begonnen hat; und es ist genauso befriedigend, das letzte Puzzleteil zu finden, das eine plausible Hypothese für ein vergangenes Ereignis ermöglicht.
Ich nahm auch Kontakt zu Nachfahren der Mitglieder des Grabungsteams aus Chicago auf – deren Informationen sowie ein paar genealogische Nachforschungen auf der Webseite ancestry. com verschafften mir Zugang zu weiterem Material, von Briefen und Tagebüchern bis hin zu Kriegsberichten und Details zur späteren Karriere der Ausgräber. So erfuhr ich noch mehr über einzelne Teammitglieder wie Edward DeLoach, Daniel Higgins, Laurence Woolman, Gordon Loud und Clarence und Stanley Fisher. Das umfangreiche Material ermöglichte es mir, diese Personen, die bis dahin bloße Namen auf Buchrücken oder in langweiligen Teilnehmerlisten gewesen waren, als Menschen aus Fleisch und Blut kennenzulernen, im Kontext ihrer Zeit und mit ihren Hoffnungen, Ängsten und Träumen, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, sie auf den Seiten dieses Buches zum Leben zu erwecken.
Ihre Geschichte ist voll von Intrigen und Querelen, zwischenmenschlichen Verwicklungen und Beispielen für ein erstaunliches Durchhaltevermögen, und all das spielte eine wichtige Rolle bei den einschneidenden personellen Veränderungen bei Mitarbeitern und Leitern, bevor der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den Ausgrabungen ein abruptes und unerwartetes Ende bereitete. Vielfach liest sich diese Geschichte wie das Drehbuch für eine Seifenoper, zu deren Ensemble ein Architekt gehört, der sich als einer der besten Ausgräber seiner Zeit entpuppte, aber über keinerlei Führungsqualitäten verfügte, und ein britischer Zionist, der mit der Tochter des Mannes, der Hebräisch als moderne Sprache neu erfand, verheiratet war, der aber weder über einen Universitätsabschluss verfügte noch eine formelle Ausbildung in Archäologie genossen hatte und der gefeuert wurde, nachdem er dem Oriental Institute „einen der skurrilsten Briefe“ geschrieben hatte, „die das Institut jemals erhalten hat“. Außerdem mit dabei: ein Landvermesser, der wegen unrechtmäßiger Kündigung klagte, möglicherweise aber vor Ort als Spion für die Untergrundorganisation Haganah tätig war; ein junger Forscher, der auf der Heimreise festgenommen wurde, weil er Altertümer außer Landes schmuggeln wollte, und dennoch eine erfolgreiche akademische Laufbahn absolvierte sowie ein Schulabbrecher ohne archäologische Ausbildung und ein Geologiestudent ohne Abschluss, die gemeinsam einen Großteil der Ausgrabung publizierten – angeleitet von Breasted im weit entfernten Chicago und finanziert von einem der reichsten Männer der Welt: John D. Rockefeller Jr.
Doch bevor ich damit beginne, die Geschichte der Chicagoer Ausgrabung zu erzählen, sind ein paar erklärende Worte erforderlich. In Teil I und II dieses Buches sind die Kapitel ab dem dritten paarweise geschrieben: Das erste Kapitel jedes Paares (z. B. Kapitel III) befasst sich mit dem Personal in Megiddo und den dort auftretenden Problemen während eines bestimmten Zeitraums, das zweite (z. B. Kapitel IV) behandelt die eigentliche Archäologie während desselben Zeitraums.
Auf diese Weise wollte ich bei den von Fisher und Guy geleiteten Grabungen das Persönliche vom Beruflichen trennen (für die Phase mit Loud als Grabungsleiter ist dies nicht erforderlich). Außerdem ist dieses spezielle Format eine Hommage an James Michener, dessen Buch ebenfalls aus solchen paarweisen Kapiteln besteht. Ich hoffe, dass meine Leserinnen und Leser diesen Bericht über Megiddo und seine Ausgräber aus Chicago wenigstens halb so interessant und unterhaltsam finden werden, wie ich Micheners fiktive Geschichte über Makor und die dortigen Archäologen fand.