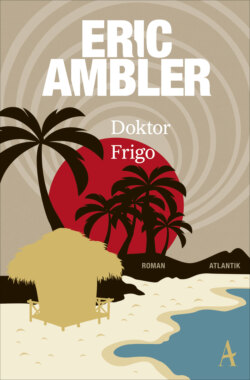Читать книгу Doktor Frigo - Eric Ambler - Страница 5
Donnerstag, 15. Mai
ОглавлениеDie neue Nachtschwester aus Guadeloupe macht einen intelligenten und fähigen Eindruck. Bin beruhigt.
Für den Nachtdienst in der Klinik spricht immerhin eines. Das Essen mag schauderhaft sein, und die Ruheliege, auf der man sich ausstrecken kann, steht vielleicht zu nah beim Hauptgenerator der Klimaanlage, aber wenn sich nicht gerade ein besonders schlimmer Verkehrsunfall ereignet oder die Nachtschwester unfähig ist, hat man Ruhe und Zeit zum Nachdenken.
Der diensthabende Arzt hat auch einen Schreibtisch und einen Vorrat an Krankenhauspapier. In den kommenden zwei Nächten werde ich endlich einen Anlauf nehmen und meine Sicht der Affäre Villegas zu Papier bringen; so habe ich sie notfalls später parat, mit Datum und Unterschrift versehen, zum Beweis, dass ich gutgläubig gehandelt habe, wenn auch nicht mit viel gesundem Menschenverstand.
Natürlich hoffe ich, dass das nicht notwendig sein wird. In den letzten vierundzwanzig Stunden hatte ich jedoch Anlass zu der Vermutung, dass hier mehr vorgeht, als ich momentan überblicke. Also gehe ich lieber kein Risiko ein.
Zunächst einmal werde ich die Umstände des Mordanschlags auf meinen Vater rekapitulieren.
Erste unnötige Störung. Die neue Schwester wollte wissen, ob sie dem Herzpatienten auf Station B Phenobarb geben soll. Stellte fest, dass sie die Dienstanweisung nicht gelesen hat, in der ganz klar steht, dass sie in diesem Fall Medikamente nach eigenem Ermessen verabreichen kann. So viel zu ihrer angeblichen Kompetenz! Als ich sie zur Rede stellte, konterte sie, in Pointe-à-Pitre werde eben anders verfahren.
Eine absurde Lüge, und jeder der französischen Ärzte hier, ob weiß oder schwarz, Kreole oder aus Frankreich entsandt, hätte ihr das ins Gesicht gesagt. Ich konnte nur extrem höflich reagieren. Sie wehrte sich, indem sie Patois sprach. Als sie merkte, dass ich sehr wohl verstand, was sie sagte und ihr sogar auf Patois antworten konnte, verdrückte sie sich. Ihre Kolleginnen haben sie bestimmt gewarnt, dass der junge Dr. Castillo ein unsympathischer Béké-Spanier ist. Jetzt hat sie ihre Kostprobe bekommen. Gut so. Sie wird es sich zweimal überlegen, bevor sie wieder ankommt und Fragen stellt.
Zur Ermordung meines Vaters, Clemente Castillo Borja.
Wer sich schon einmal mit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Mittelamerikas beschäftigen musste, weiß, dass diesem Fall noch immer etwas Mysteriöses anhaftet. Von Zeit zu Zeit haben Journalisten, die sich als intime Kenner dieses Landes bezeichnen, aufgrund angeblicher Insider-Informationen Enthüllungsstorys geschrieben. Doch keiner von ihnen hat neue Fakten vorgelegt, und die »ganze Wahrheit«, die immer wieder aufgedeckt wurde, war nicht viel aufschlussreicher als die Spekulationen und Mutmaßungen, die niemand mehr hören will.
Die beiden Attentäter, die an jenem Abend den Anschlag auf den Stufen des Hotels Nuevo Mundo verübten, wurden natürlich sofort identifiziert. Der Tatort war hell erleuchtet, und es gab Dutzende von Augenzeugen. Und doch ist bis heute nicht klar, wer die Killer beauftragt und bezahlt hat. Wir wissen nur, dass irgendjemand vor der Aktion in weiser Voraussicht einen Sprengsatz im Fluchtauto versteckt hatte. Es war das Werk von Experten. Die Täter wurden von der Explosion in Stücke gerissen, ehe man sie erwischen und verhören konnte. Laut Steckbrief wurden die beiden »gesucht wegen bewaffneten Raubüberfalls. Politische Verbindungen nicht bekannt.«
Der weithin verbreiteten, gewissermaßen »offiziellen« Version zufolge war das Attentat von der Militärjunta unmittelbar nach dem Oktober-Putsch angeordnet und unter der Regie eines Spezialkommandos des Sicherheitsdienstes ausgeführt worden.
So könnte es tatsächlich gewesen sein.
Andererseits sind manche Leute noch immer felsenfest davon überzeugt, dass die Junta zwar allen Grund hatte, meinen Vater zu beseitigen, und dazu auch sehr wohl imstande war, sie aber nicht das geringste Interesse hatte, einen Märtyrer aus ihm zu machen. Nach Ansicht dieser Leute gingen das Attentat und die Autobombe auf das Konto einer extrem antiklerikalen Gruppierung innerhalb der Demokratisch-Sozialistischen Partei meines Vaters. Demnach wäre die Aktion unternommen worden, um die Junta zu diskreditieren, bevor sich die Situation nach dem Putsch stabilisieren konnte, aber auch deswegen, weil diese linke Gruppierung wusste, dass sich mein Vater mit den Christdemokraten insgeheim auf eine Koalition verständigt hatte.
So könnte es ebenfalls gewesen sein.
Meine Mutter, die vor einem Jahr in Florida starb, glaubte bis zuletzt an diese Version, wenngleich mir die Gründe dafür nie eingeleuchtet haben. Diese außerordentlich gefühlsbetonte, überaus weibliche Frau – eigenwillig, aber doch hilflos ohne einen bestimmenden Mann an ihrer Seite – hatte einen kunterbunten Haufen hitzköpfiger, überkandidelter Emigranten um sich geschart. Als deren Chefin zog sie der landläufigen Ansicht gewiss die exotischere, üppig ausgeschmückte Theorie von Verschwörung und Verrat vor. Jedenfalls drängte sie mich immer, die Verräter aufzuspüren und Rache zu üben, wie es sich für den einzigen Sohn gehört – blutige Rache, Blutrache.
In dieser wie auch in anderer Hinsicht war ich eine Enttäuschung für sie. Zu meiner Verteidigung konnte ich nur vorbringen – und manchmal wurde ich darin von meinen Schwestern und deren Ehemännern unterstützt –, dass mir die Verratstheorie völlig unglaubwürdig erschien. Das erregte natürlich ihren Unmut, da diese unbekannten Verräter, von deren Existenz sie ausging, die einzigen möglichen Ziele meiner Rache sein konnten. Aber nicht einmal meine Mutter durfte von mir erwarten, dass ich auf eigene Faust eine Strafexpedition gegen die Junta und den Sicherheitsdienst auf deren eigenem Terrain unternahm. Nach dem Umsturz von 1968 wurde das mit der Rache noch komplizierter. Unter der Oligarchie, die von der sogenannten »patriotischen Miliz« gestützt wurde, kamen etliche der ehemaligen Juntaangehörigen zu Tode, und ein Jahr später waren die hohen Offiziere, die man nicht auf irgendwelche Abstellgleise abgeschoben hatte, entweder krank oder tot.
Und was dachte ich wirklich über die Verschwörung gegen meinen Vater?
Noch vor ein paar Tagen hätte ich geantwortet, dass ich mir längst nicht mehr den Kopf darüber zerbreche, wer (wenn überhaupt) hinter der Sache stand oder welche Clique dafür verantwortlich war.
Wenn das roh oder gefühllos klingt – meinetwegen. Zwölf Jahre sind seit dem Tod meines Vaters vergangen, und bei seiner Ermordung war ich ein unsicherer Bursche von neunzehn, der fern der Heimat, an einer französischen Universität, gerade sein Medizinstudium aufgenommen hatte. Von der damaligen Zeit habe ich weder den Schmerz noch die Verwirrung in besonders lebendiger Erinnerung, nicht einmal die Beerdigung bei strömendem Regen, die Soldaten, die die Trauernden umstellten, und die Polizisten, die am Grab standen und die Namen der Anwesenden notierten. Ich entsinne mich vor allem des Blitzlichtgewitters der Pressefotografen auf dem Flughafen Orly, als ich nach Hause fliegen wollte, und der Reporter, die mir dumme Fragen zuriefen. Ein Mann von unserer Pariser Botschaft sollte mich durchschleusen, doch er musste machtlos zusehen. Die Zeitungsleute stießen ihn beiseite, und einer baute sich direkt vor mir auf. Schwitzend und außer Atem brüllte er mir in all dem Lärm mit bemerkenswert feuchter Aussprache auf Spanisch zu: »Was haben Sie gefühlt, als Sie von der Ermordung Ihres Vaters erfuhren? Sie müssen doch gewusst haben, wie verhasst er war. Waren Sie überrascht?«
Ich holte aus, um ihm einen Kinnhaken zu verpassen, doch der Botschaftsmensch hielt meinen Arm fest. Dann erschienen Beamte der Flughafenpolizei, die mich umringten und rasch fortbrachten.
Heute bin ich klüger. Ich weiß jetzt, dass meine Empfindungen für meinen Vater gemischt waren und dass ich schon damals eine Ahnung hatte, was für ein Mensch er war. Behauptungen, die mir früher völlig unakzeptabel erschienen wären, kann ich heute ganz gelassen akzeptieren. Die offenkundige Tatsache etwa, dass Clemente Castillo, selbst wenn er schließlich doch an die Macht gekommen wäre, für mein Vaterland nicht viel mehr getan hätte als die unfähige Junta oder die zivile Oligarchie mit ihrem Marionettenpräsidenten. Eine Regierung Castillo hätte nach außen hin vielleicht ein besseres Bild abgegeben, ein liberaleres Image präsentiert, aber das wär’s dann schon gewesen. Die Probleme meines Landes, wie diejenigen anderer Kaffeerepubliken, die einst spanische Kolonien waren, sind historisch bedingt und nicht durch ein glänzendes Erscheinungsbild zu lösen, auch nicht durch bedeutungslose Opportunisten mit allzu simplen Reformvorschlägen.
Ich weiß, dass mich die meisten meiner Kollegen hier im Krankenhaus nicht leiden können. Mein Spitzname hier ist »Dr. Frigo«. »Frigo« ist französischer Jargon und bedeutet nicht nur »Kühlschrank« oder »Gefriertruhe«, sondern auch (etwas abfällig gemeint) »Tiefkühlfleisch«. Natürlich versuche ich die Sache von der humorvollen Seite zu nehmen, aber wenn ich den letzten Absatz noch einmal lese, begreife ich, warum dieser Name in der kleinen, überschaubaren Welt unserer Klinik überhaupt aufkommen konnte.
Bedeutungsloser Opportunist? Ist das das Beste, was der loyale Sohn über seinen ermordeten Vater sagen kann? Wenn er so bedeutungslos war, warum wurde er dann ermordet? Andere Politiker machen sich auch Feinde und leben trotzdem weiter. Und wenn den aufgeblasenen, jungen Dr. Frigo die Umstände der Ermordung seines Vaters tatsächlich nicht länger interessieren, warum will er dann verheilte Wunden wieder aufreißen?
Berechtigte Fragen. Ich muss versuchen, zumindest ein paar davon zu beantworten.
Als Kind habe ich meinen Vater geliebt und geachtet, gar keine Frage. Wir waren eine glückliche Familie. Als Heranwachsender habe ich ihn weiterhin geliebt, aber respektiert habe ich ihn nur noch bedingt.
Mein Vater war Anwalt, bevor er in die Politik ging, und es ist der Anwalt, an den ich mich besonders gut erinnere. Abends beim Essen und später erzählte er von seiner Arbeit. Meistens waren es natürlich triumphale Berichte von gefährlichen Gegnern, die er überlistet hatte, und von Niederlagen irgendwelcher Dummköpfe – alles höchst unterhaltsam. Und selbst wenn er eine Niederlage oder einen Rückschlag zu vermelden hatte, schilderte er die Gründe dafür mit so viel trockenem Humor und Understatement, dass wir für den Schurken des Stückes eher Mitleid als Hass oder Verachtung empfanden. Mein Vater, der unsere unkritische Bewunderung sichtlich genoss, übte und entwickelte gleichzeitig jene rhetorischen Fertigkeiten, die ihm später vor großen Zuhörermassen zugutekommen sollten.
Die meisten seiner Klienten waren kleine Gauner und Schuldner. Im Laufe der Jahre lernten wir Kinder, einfach weil wir so oft von all diesen Dingen hörten, einiges über Verteidigungstaktik, über die weniger erfreulichen Methoden der Ermittlungsbehörden und über die Regeln der Beweisführung. Ich bezweifle, dass meine Schwestern viel davon behielten (sie fanden die väterlichen Berichte über juristische Verfahrenstricks amüsant), doch bei mir war das anders. Tatsächlich waren es diese bruchstückhaften Kenntnisse, die mein (zweifellos unbegründetes) Vorurteil gegen den Juristenberuf nährten und mich zu der Ansicht brachten, dass die Medizin eine exakte Wissenschaft sei – eine nicht weniger irrige Auffassung, wie ich inzwischen festgestellt habe, aber mein damaliger Biologielehrer vertrat sie auch.
Mein Vater reagierte gelassen auf meine Entscheidung, und als er sich später bereit erklärte, mein Studium in Paris zu finanzieren, sagte er in seiner üblichen nüchternen Art: »Schön, dass es wenigstens nicht die Vereinigten Staaten sein müssen. Das wäre nämlich teuer geworden. Jedenfalls bin ich sicher, dass du fleißig arbeiten und das Beste aus deinen Möglichkeiten machen wirst.« Und dann fügte er nachdenklich hinzu: »Aus manchen Ärzten sind gute Politiker geworden. Anscheinend wirken sie vertrauenswürdig, weiß der Himmel warum.«
Wenn diese Lektionen, die ich gewissermaßen auf dem väterlichen Schoß lernte, mich auch gegen die Juristerei einnahmen, schärften sie doch mein Bewusstsein dafür, wie man gewisse juristische Fallen vermeidet.
Immer wieder kam er auf das Thema der schriftlichen Zeugenaussage zu sprechen.
»Nimm dich in Acht vor dem Polizisten mit abgegriffenem Notizbuch«, sagte er. »Vermutlich kann er gerade mal seinen eigenen Namen schreiben und mit Mühe und Not lesen. Aber im Gerichtssaal wird das, was in seiner Kladde steht, ganz egal, wer es wann dort hineingeschrieben hat, so sakrosankt behandelt wie die Heilige Schrift.«
»Also, Kinder, denkt dran«, ermahnte er uns mit erhobenem Zeigefinger, wenn er wieder einmal über einen haarsträubenden Fall von Pseudojustiz oder Rechtsbeugung berichtet hatte, »und vergesst es nicht. Solltet ihr jemals, was Gott verhindern möge, eine Straftat begehen oder Grund zu der Annahme haben, dass ihr fälschlicherweise einer Straftat oder einer Unbedachtheit beschuldigt werdet, dann müsst ihr eure Handlungen und Gedanken in den wesentlichen Phasen aufzeichnen. Handschriftlich, mit Datum und ohne nachträgliche Änderungen, wenn ihr keine einleuchtenden Gründe dafür habt.«
Dies ist eine seiner Ermahnungen, die ich nicht vergessen habe. Von Zeit zu Zeit habe ich schriftliche Notizen der besagten Art angefertigt und sie später als nützlich empfunden. Nicht dass ich je vor Gericht gestanden hätte oder damit zu rechnen gewesen wäre. Aber auf französischen Ämtern werden Ausländer nicht immer korrekt behandelt, und ein ausländischer Arzt, selbst wenn er eine französische Approbation vorweisen kann, hat einige Nachteile. Wenn er Dr. Frigo heißt und im staatlichen Krankenhaus eines französischen Überseedepartements arbeitet, ist er besonders angreifbar.
Erneute Störung, aber diesmal nicht ohne Grund. Finale Urämie auf Station C extrem unruhig, will entlassen werden und zu Hause sterben. Schwester hat sich an die Vorschriften gehalten. 5 ccm Paraldehyd, wie verordnet, aber ohne die gewünschte Wirkung.
Sah mir den Patienten an. Zuckerrohrschneider, in den Fünfzigern. Sprach mit ihm, munterte ihn auf, so gut es ging, aber einem Sterbenden zu erklären, dass die Behandlung fortgesetzt werden muss, ist jedes Mal deprimierend. Verordnete 0,5 g Chloralhydrat. Die Schwester sah mich stirnrunzelnd an, sagte aber keinen Ton.
Habe inzwischen eine andere Meinung von ihr. Sie kann sehr gut mit Patienten umgehen – einfühlsam, freundlich, bestimmt. Ist eigentlich ganz hübsch. Fast schwarz, aber mit den feinen Gesichtszügen der Chabine. Schöner Teint, allerdings Warze am Hals unterhalb des linken Ohrs. Könnte man leicht kauterisieren. Warum hat ihr das noch niemand gesagt?
Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich plötzlich sehr viel angreifbarer geworden bin.
Deswegen diese schriftlichen Aufzeichnungen. Hätte schon vor drei Tagen damit anfangen sollen.
Muss mich beeilen, solange mir meine Handlungen und Gedanken in den nachgerade relevanten Phasen noch frisch im Gedächtnis sind.