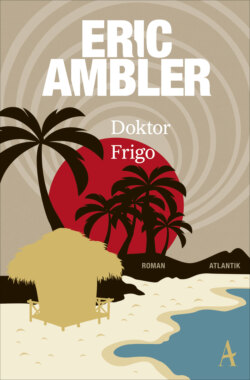Читать книгу Doktor Frigo - Eric Ambler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abends
ОглавлениеNach meinem Besuch bei Gillon kam ich am späten Nachmittag mit Dr. Brissac in dessen Dienstzimmer zusammen. Natürlich wollte er einen ausführlichen Bericht über mein Gespräch auf der Präfektur haben. Da ich aber sicher war, dass Gillon ihm bei ihrer nächsten Bridgerunde davon erzählen würde, äußerte ich mich zurückhaltend. Ich erzählte ihm jedoch von dem Honorar, und obschon ich stark bezweifelte, dass er damit zu tun hatte, bedankte ich mich bei ihm. Er winkte großzügig ab und bot mir an, dass ich im Bedarfsfall einen der tragbaren EKG-Apparate der Klinik benutzen könne. Für den Transport sollte ich mir allerdings ein Auto leihen. Er missbilligt mein Moped. Aus seiner Sicht ist es ein Verkehrsmittel, das eines Arztes nicht würdig ist. Er wies darauf hin, dass ich die fünfhundert Francs, die ich monatlich nebenbei verdienen würde, als Anzahlung für ein Auto nehmen könnte.
Nach Dienstschluss fuhr ich zu Elisabeth.
Sie wohnt ebenfalls in einem der restaurierten Häuser, wobei das ihre nicht wie meines in separate Wohnungen aufgeteilt ist. Sie hat dort ihr Atelier und eine fest angestellte Haushälterin. Außerdem besitzt sie eine Galerie in der Laden-Passage des Hotels Ajoupa. Dort verkauft sie ihre eigenen Arbeiten, aber auch solche anderer hiesiger Künstler sowie die eines talentierten kreolischen Bildhauers, der seinen Lebensunterhalt als Vorarbeiter in einer Rumbrennerei verdient.
In Saint-Paul wimmelt es von Künstlern. Die meisten taugen nicht viel. Am meisten verkauft Elisabeth die Arbeiten einer Blumenmalerin mit einem Hibiskusfimmel und die eines Automechanikers, der Öl-auf-Karton-Bilder von Sehenswürdigkeiten der Insel malt. Er verwendet ein Gerät, mit dem er Sand auf die frische Farbe bläst. So verbirgt er, zumindest teilweise, seine laienhafte Kunst, und zugleich vermittelt er die Illusion einer besonders originellen Technik. Während der Saison sind seine Werke sehr begehrt (im Bordmagazin einer amerikanischen Fluglinie wird er als »Grandma Moses von Saint-Paul« bezeichnet), und Elisabeth bereitet es ein diebisches Vergnügen, astronomische Preise für seine Bilder zu verlangen. Der talentierte Bildhauer dagegen lässt sich kaum verkaufen. Ein, zwei amerikanische Galerien, darunter auch das New Yorker Museum of Modern Art, haben inzwischen Werke von ihm erworben, und Elisabeth versucht gerade, in Paris eine Einzelausstellung für ihn zu organisieren.
Sie selbst malt entweder trompe l’œil-Bilder, die sehr gut gehen, oder »Buchstabengemälde«, die überhaupt nicht gehen.
Der Ausdruck »Buchstabengemälde« stammt von mir. Sie selbst nennt sie »Erinnerungen«. Es sind großformatige, wüste Darstellungen mittelalterlicher Folterszenen, Massaker oder Totentänze, in denen die Buchstaben A, E, I, O und U in menschlicher Gestalt gezeigt werden.
Um diese Bilder zu verstehen, um zu verstehen, warum Elisabeth sie überhaupt malt, muss man einen Blick in ihren Pass werfen.
Normalerweise verwendet sie den Namen Elisabeth Martens. In ihrem Reisepass steht jedoch der Name Maria Valeria Modena Elisabeth von Habsburg-Lothringen Martens Duplessis. Martens ist ihr Mädchenname. Ihr Vater, Jean Baptiste Martens, ein Belgier, besitzt Textilfabriken in der Nähe von Lille. Duplessis ist der Name ihres französischen Ehemannes, von dem sie getrennt lebt. Der Rest der eindrucksvollen Namen geht auf ihre Mutter zurück, die kurioserweise eine Urururenkelin von Kaiserin Maria Theresia von Österreich ist, was Elisabeth anhand von Stammbaumtafeln belegen kann.
Elisabeth ist also, über einen spanischen Zweig der Familie, eine Habsburgerin. Und AEIOU ist das Akronym eines Sinnspruchs, erfunden von oder für Kaiser Friedrich III., einem Habsburger des fünfzehnten Jahrhunderts, der seinen verständlicherweise schwindenden Glauben an den Fortbestand der Dynastie mit einem Sinnspruch untermauern wollte. AEIOU steht für Austria Est Imperare Orbi Universo.
Elisabeth findet es nicht absurd, sich immer wieder mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dass sie diesen Teil ihres Familienerbes und die langen, blutigen Kapitel der habsburgischen Geschichte weder ignorieren noch vergessen kann, ist keineswegs Ausdruck von Snobismus. Ihre Gefühle gegenüber dieser ungeheuren Dynastie, die sie nicht in Ruhe lässt, sind denn auch ausgesprochen ambivalent. Wenn sie ihre Familie in den Buchstabenbildern immer wieder spöttisch oder kritisch behandelt – es gibt unter anderem eine abscheuliche »Erinnerung« an eine kaiserliche Grablegung in der Kapuzinergruft –, so kann sie gleichwohl vehement für sie eintreten. Sie soll empört darauf hingewiesen haben, dass es nicht das britische Empire war, in dem die Sonne nie untergegangen sei, sondern das Reich Karls V., das sich »von den Karpaten bis nach Peru« erstreckt habe. Einmal muss sie, nicht mehr ganz nüchtern, einen harmlosen Bostoner Kunsthändler und dessen Frau heftig attackiert haben, man müsse doch Verständnis haben für die schwierige Lage Karls VI. – Gicht, Magenprobleme, katastrophale Schwangerschaften. Nach einem Moment größter Irritation stellte sich heraus, dass Elisabeth die Pragmatische Sanktion von 1713 rechtfertigen wollte und dass mit den Schwangerschaften die der Kaiserin gemeint waren.
Wenn sie nach all dem ein wenig exzentrisch erscheint, so muss ich doch sagen, dass sie meistens ziemlich vernünftig ist. Die Einheimischen bezeichnen sie als toquée, was auf Saint-Paul aber nicht unbedingt negativ klingt. Ein gewisses Maß an Verrücktheit wird toleriert, und wenn die betreffende Person so aussieht wie Elisabeth, ist es sogar ein Plus. Ihre Unterlippe hat nichts Habsburgisches, und ihr Unterkiefer steht auch nicht vor. Sie besitzt einen Druck von einem Stieler-Porträt der Erzherzogin Sophie, das man für ein Bildnis von ihr selbst in einem Phantasiekostüm halten könnte. Wenn sie selten etwas Gewagteres oder Modischeres als Hose und Hemd trägt, so sind es nur die Frauen gewisser französischer Beamter, die darüber die Nase rümpfen. Mal élevée, lautet ihr Urteil.
Man könnte vielleicht behaupten, dass die allermeisten Habsburger schlecht erzogen waren, wenn auch nicht in dem Sinn, wie die Beamtengattinnen ihre Bemerkung verstehen. Elisabeth kann einiges zu diesem Thema beitragen, da ihr die Großmutter mütterlicherseits, die als junges Mädchen am Hof von Franz Josef war, viel erzählt hat. Die spöttische Bemerkung des Königs von Ungarn, dass starke Nationen in den Krieg ziehen müssten, während das glückliche Österreich durch Heirat das Gewünschte bekam, ist nicht so falsch. Diese armen kleinen Erzherzöge und Erzherzoginnen, all die Franzis, Maxls, Bubis, Sissis und Lisls, die schon als Kleinkinder höfisches Benehmen und Etikette lernten und deren künftige Ehepartner schon feststanden, bevor sie überhaupt in die Pubertät kamen – kein Wunder, dass die meisten von ihnen im Erwachsenenalter mehr als nur ein bisschen neurotisch waren. Es ist wirklich ein Wunder, dass im Laufe der Jahrhunderte so wenige manifest geisteskrank waren.
Wer Elisabeth darüber sprechen hört, könnte leicht glauben, dass sie diesen Dingen ebenso distanziert gegenübersteht wie man selbst. Das aber wäre ein Missverständnis. Wenn sie auch nicht so sehr in der Vergangenheit ihrer Familie lebt, als dass sie deren Verschrobenheiten rechtfertigen würde, so bringt sie doch ein gewisses Verständnis auf. Aus ihrer Sicht sind die Liebenden von Mayerling zwei verabscheuenswerte Dummköpfe, die dem alten Kaiser unerträglich viel Schmerz und Kummer bereitet haben. Dass sie Mitleid verdient hätten, wäre für sie eine abwegige Vorstellung. Gewiss wurden in Rudolfs Erziehung Fehler gemacht. Ein dummer Hauslehrer sperrte den Buben in ein Wildgehege, um ihm zu zeigen, was Mut ist. Ganz sicher keine Methode, einem Sechsjährigen irgendetwas beizubringen. Aber Rudolf war Kronprinz, Thronfolger. Er hätte von sich aus Pflichtgefühl haben müssen. »O ja, du findest natürlich, dass ich dummes Zeug rede, trotzdem …«
Elisabeth selbst dürfte die typische Erziehung einer Tochter eines belgischen Industriellen genossen haben, aber ihre Haltung zu bestimmten Dingen bleibt die der Großmutter, die vor Franz Josef einen Hofknicks machte.
Zur Scheidung ihrer Eltern vertritt sie eine charakteristische Ansicht. Da ihr Vater Protestant war und immer bleiben wollte, sei die Ehe von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Die beiden hätten überhaupt nicht heiraten sollen, findet sie. Es wäre besser gewesen, wenn sie als uneheliches Kind zur Welt gekommen wäre.
Ihre Eltern haben unterschiedlich auf diesen Kommentar reagiert. Ihr Vater, der noch zwei Kinder aus zweiter Ehe hat, kann sich inzwischen halb belustigt damit abfinden. Ihre Mutter dagegen, die mit ihrem zweiten Mann inzwischen in Paraguay lebt, war sehr getroffen. Bei ihrem letzten Besuch auf Saint-Paul kam es zu einem heftigen Streit, bei dem sich Mutter und Tochter vermutlich die tödlichsten Beleidigungen an den Kopf warfen. Ich sage »vermutlich«, weil Attacke und Gegenattacke mit historischen Anspielungen einhergingen, die für mich weitgehend unverständlich waren. Das war auch der Grund, weshalb meine Schlichtungsversuche am Ende nicht ganz erfolglos blieben. Meine klägliche Ignoranz war so offenkundig, dass die beiden Kontrahentinnen am Ende in lautes Gelächter ausbrachen.
Über ihre eigene Ehe äußert sich Elisabeth nicht weniger dogmatisch. Sie lebt seit fünf Jahren offiziell von ihrem Mann getrennt. Aus dieser Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. Sie braucht ihn nicht und verwendet nicht einmal seinen Namen. Und obwohl sie sich meines Wissens nie in die Nähe einer Kirche oder eines Priesters begibt, ist sie der Auffassung, dass sie mit diesem Mann unwiderruflich verbunden ist. Eine Scheidung kommt für sie nicht in Betracht, und wenn er, was durchaus möglich ist, eine zivilrechtliche Auflösung der Ehe beantragte, würde sie sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Als ich einmal in einem der Bücher blätterte, die sie von der Großmutter geerbt hat, fand ich eine Passage über Anna von Tirol, die Gemahlin von Kaiser Matthias. Sie soll eine mit silbernen Spitzen versehene Peitsche bei sich getragen haben, mit der sie sich als Buße für ihre Sünden geißelte. Als ich Elisabeth fragte, ob sie in Bezug auf ihre Ehe nicht dasselbe tue, wurde sie wütend und warf einen Spachtel nach mir. Es war Farbe darauf, sodass ich die Hose in die Reinigung geben musste.
Kurz nach diesem Zwischenfall schenkte sie mir zur Versöhnung eines ihrer »Buchstabenbilder«. Thema war der Prager Fenstersturz. Meiner Ansicht nach befindet sich Elisabeth noch immer im Dreißigjährigen Krieg.
Ich erzählte nicht sofort, was ich an diesem Tag im Büro von Kommissar Gillon erlebt hatte. Wir hatten noch Arbeit zu erledigen, und ohnehin war ich mir noch nicht im Klaren darüber, wie viel ich ihr erzählen wollte. Die zusätzlichen fünfhundert Francs im Monat würden bestimmt ihren Beifall finden, aber wenn ich das Gespräch mit Gillon nicht herunterspielte, würde sie gewiss anfangen, die nahe liegenden Überlegungen anzustellen, denen ich selbst in diesem Moment eher aus dem Weg ging. Am besten, ich nahm die ganze Sache nicht zu ernst. Am besten, ich konzentrierte mich auf Dr. M.s Diagnose von Villegas als Hypochonder und beklagte den unnützen Zeitaufwand.
Doch im entscheidenden Moment erzählte ich alles.
Auslöser war die gemeinsame Arbeit. Da ich mich auf etwas anderes als die Probleme des Tages konzentrieren musste, entspannte ich mich und erzählte ihr, ohne groß nachzudenken, was passiert war. Was Dr. Brissac meine »Hobbyknipserei« nennt, ist nichts anderes als ein Job, den ich für Elisabeth übernommen habe. Als sie in Paris studierte, arbeitete sie halbtags in einer Galerie auf der Rive Droite. Vom Inhaber der Galerie lernte sie viel über das Geschäft, und als sie später auf Saint-Paul ihre eigene Galerie eröffnete, übernahm sie seine Methoden. Eine bestand darin, von jedem Objekt, ob gut oder schlecht, das durch seine Hände ging, eine Fotografie anzufertigen. Manche Fotos konnte man interessierten Kunden im Ausland zuschicken, aber die meisten dienten der Dokumentation. Abzüge oder Diapositive eines jeden Werks wurden katalogisiert und mit Verweisen auf die Rechnungsbücher versehen.
Eine Zeit lang nahm Elisabeth die Dienste des Fotografen von Fort Louis in Anspruch, der normalerweise Sportwettkämpfe und gesellschaftliche Ereignisse im Bild festhält. Doch für ihre Zwecke war er im Grunde nicht geeignet. Gemälde zu fotografieren ist leicht, solange es nicht auf größtmögliche Farbtreue ankommt, doch sobald die Farbqualität eine Rolle spielt, wird es schwierig. In vielen Großstädten gibt es ja Profis, die sich eigens auf diesen Bereich spezialisiert haben. Der Mann in Fort Louis war ohnehin nicht groß interessiert, da er von seinem Geschäft, in dem er billige Kameras und Hi-Fi-Geräte verkauft, voll in Anspruch genommen wird. Also erstand ich vor zwei Jahren, als ich in Florida zu Besuch bei meiner Mutter war, einige Fachbücher und eine gebrauchte, preiswerte 13 × 18-Kassettenkamera. Mit Hilfe eines unserer Röntgentechniker und nach einigem Experimentieren gelangen mir am Ende ganz passable Ergebnisse. Mit einiger Übung und nachdem ich in Caracas ein zuverlässiges Farblabor entdeckt hatte, erzielte ich durchweg gute Resultate.
Für diese Fotositzungen bauen wir die Kamera und die Lampen in einer Ecke des Ateliers auf und machen eine ganze Serie von Bildern, so viel wir in einem Durchgang schaffen. So kann ich immer einen neuen Film verwenden und das belichtete Material sofort in feuchtigkeitsabweisende Versandtüten packen. An diesem Abend hatten wir uns zehn Gemälde und eine Plastik vorgenommen. Da sowohl Farbnegative als auch Dias angefertigt werden, bedeutete das eine längere Sitzung. Elisabeths Haushälterin brachte uns zwischendurch kühlen Weißwein und Meeresfrüchtehäppchen. In einer Pause kam ich wieder auf die Kamera zu sprechen, die wir uns anschaffen sollten.
»Das haben wir doch schon alles diskutiert«, entgegnete Elisabeth. »Diese alte Kiste erfüllt ihren Zweck bei Gemälden ganz gut, aber bei dreidimensionalen Objekten wäre diese neue Kamera mit Zoom geeigneter. Man bekommt die räumlichen Verhältnisse besser hin, stimmt’s?«
»Genau.«
Sie zeigte mit einem Stück Brot auf mich. »Ich weiß, was mit dir los ist, mein Lieber. Du hast Feuer gefangen.«
»Blödsinn. Ich wollte nur …«
»Von wegen. Das mit den räumlichen Verhältnissen mag zwar stimmen, aber in Wahrheit möchtest du prachtvolle Fotos machen, die im Katalog einer New Yorker Galerie oder in einem Hochglanzmagazin abgedruckt werden mit deinem Namen darunter. Ich spüre es. Du entwickelst künstlerischen Ehrgeiz.«
Weil ein Körnchen Wahrheit in ihrer Behauptung steckte, reagierte ich vorsichtshalber nur mit einem leichten Schulterzucken. »Du willst schließlich Molinet bekannt machen, nicht ich.« Molinet ist der begabte Arbeiter aus der Rumbrennerei. »Ich finde, dass die Aufnahme, die wir gerade machen, dem Objekt überhaupt nicht gerecht wird.«
»Schlechte Handwerker reden sich immer mit ihrem Handwerkszeug heraus. Du kannst das Objekt anders beleuchten, bring die Textur heraus.«
»Es wird trotzdem wie ein löchriger Kalksteinblock aussehen.«
»Nicht für ein geschultes Auge. Übrigens hast du es mir selbst gesagt. Diese neue Kamera kostet tausend-fünfhundert Dollar nur für das Gehäuse, ohne Objektiv. Was es kostet, bis du alles zusammenhast, um deine Meisterwerke hervorzubringen, weiß der Teufel. Dreitausend Dollar? Viertausend? Darling, meine Galerie ist zwar nicht gerade ein Verlustgeschäft, obwohl diese Schweinebande von Hoteldirektion die Miete erhöht hat, aber so einen amerikanischen Zauberkasten können wir uns nicht leisten.«
Da ich mir gerade einen Essensfleck vom Hemd rieb, fiel meine Entgegnung nicht so energisch aus, wie sie sonst vielleicht gewesen wäre. »Ich rede nicht von amerikanischen Zauberkästen«, stöhnte ich, »sondern von einer weltweit anerkannten deutschen Kamera. Und ich erwarte auch gar nicht, dass die Galerie meine hochfliegenden Ambitionen finanziert. Dr. Brissac meinte heute, ich soll mir ein Auto zulegen und das Moped ausrangieren. Es ist mal wieder nicht angesprungen. Stattdessen könnte ich es gründlich durchsehen lassen und mir für das Geld eine Kamera kaufen.«
»Welches Geld?«
Und dann erzählte ich es ihr.
Sie hörte aufmerksam zu und machte nur eine einzige Bemerkung. Wenn Dr. M. fünfhundert im Monat bekommen habe, hätte ich tausend verlangen sollen. Es war schon recht spät, als wir fertig waren und alles wieder zusammengepackt hatten.
Da Elisabeths Schlafzimmer praktisch Teil des Ateliers ist, riecht es dort immer ein wenig nach Terpentin. Für mich ist dieser Geruch angenehm, und wenn er sich mit ihrem Parfüm verbindet, hat es eine sonderbar exotische Wirkung. Wenn ich dann zu Hause in meinem Bett liege, stelle ich oft fest, dass manche Körperteile, vor allem Arme und Schultern, danach riechen. So habe ich vor dem Einschlafen immer einen schönen Moment der Erinnerung an Elisabeth.
Doch an diesem Abend war es anders. Entspannt lagen wir im Bett, und ich dachte gerade, dass ich bald aufstehen, mich anziehen und in meine Wohnung zurückgehen müsste, als Elisabeth plötzlich verkündete, dass sie schwimmen gehen wolle.
Ich war nicht sprachlos, nur ein wenig überrascht – und verwirrt. Nachts schwimmen zu gehen ist für Elisabeth eine Art Schnelltherapie, eine Methode, überschüssiges Adrenalin abzubauen, Spannungen loszuwerden und die innere Ruhe wiederzufinden. Und normalerweise wusste ich auch immer, was das unmittelbare Motiv war – ein heftiger Streit, ein Brief von ihrer Mutter oder ein Bescheid vom Finanzamt, über den sie sich ärgerte –, und ihre Entscheidung fiel immer, wenn wir beide angezogen waren. Noch nie hatte sie beschlossen, schwimmen zu gehen, nachdem wir miteinander geschlafen hatten. Daher also meine Verwirrung. Mir schien (und ich glaube nicht, dass ich allzu eitel bin oder mir auf diesem Gebiet etwas vormache), als sei die innere Anspannung, die sie womöglich gehabt hatte, etwa zwanzig Minuten zuvor gründlich und erfolgreich abgebaut worden.
Und dann kam mir ein Gedanke. Etwas war noch nicht geklärt. »Was die Kamera betrifft«, sagte ich, »es war mir eigentlich nicht so wichtig. Du hast recht. Es wäre etwas übertrieben.«
»Du musst dich nicht sofort entscheiden.« Sie stand auf. »Wir gehen jetzt schwimmen.«
»Wir? Du weißt doch, ich habe …«
»Frühdienst. Außerdem musst du den großen Villegas untersuchen, den kommenden Mann in deiner Heimat. Du brauchst Schlaf. Ein paar Runden, und ich garantiere dir, du wirst prächtig schlafen.«
An dem Abend regnete es heftig. Ich wies darauf hin, dass der Hotelpool wahrscheinlich nicht benutzbar sei.
»Möchtest du lieber im Meer schwimmen?«
Das war eine rhetorische Frage. In diesem Teil der Welt ist nächtliches Baden im Meer eine anerkannte Methode, sich das Leben zu nehmen. Ich griff nach meinen Sachen.
Wir fuhren in Elisabeths Peugeot-Kombi zum Hotel.
Ajoupa ist das alte karibische Wort für eine Hütte aus Palmetto oder Bambus. Das Hotel Ajoupa (»200 klimatisierte Zimmer, weißer Sandstrand«) ist alles andere als das. Auf dem hoteleigenen Briefpapier ist eine stilisierte Ajoupa dargestellt, und neben der Strandbar stehen ein paar ungezieferverseuchte Cabanas ähnlicher Bauart, aber damit endet die Parallele auch. Das Ajoupa gehört einem französisch-schweizerischen Hotelkonzern und ist, nach Elisabeths Worten, ein »Fünf-Stern-Automat«, wie es im Branchenjargon nordamerikanischer Reiseveranstalter heißt.
Dieser Ausdruck ist keineswegs kritisch gemeint – obschon viele dieser gigantischen Betonklötze mit ihren endlosen Fensterreihen tatsächlich wie Essensautomaten aussehen –, sondern eine alles andere als kritische Beschreibung der Funktion, die ihnen in einem lukrativen, trickreichen Gewerbe zukommt. Wenn der Kunde, benebelt durch den Katalog mit seinen Verheißungen von Sonne, Meer, Sand und Palmen, sein Geld in den Schlitz steckt, muss er nehmen, was herauskommt. Natürlich wird genau das herauskommen, was im Katalog steht, da die Leute andernfalls womöglich ihr Geld zurückfordern. Nur die Verpflegung mag hier und da überraschen. Im Katalog wird nicht behauptet, dass das Gebotene durchweg genießbar sei.
Der Swimmingpool des Ajoupa beispielsweise sieht im Hotelkatalog ganz wunderschön aus, weil das Foto in der Trockenzeit aufgenommen wurde. Unerwähnt bleibt, dass der Landschaftsarchitekt, dem die französische Riviera vertrauter ist als die Karibik, den Pool am Fuß eines künstlich errichteten Hügels angelegt hat. Bei jedem heftigen Regen ergießt sich folglich ein Schlammstrom über die Schutzmauer in den Poolbereich. Die Kosten einer adäquaten Kanalisation für die ganze Anlage (ohne Grunderneuerung des Schwimmbeckens) werden gegenwärtig auf eine Million Francs beziffert. Angesichts dieser Situation hat sich die Hoteldirektion vorerst darauf beschränkt, die Schilder zu entfernen, auf denen vor dem Baden im Meer gewarnt wird, und in der Nebensaison Getränkegutscheine auszugeben, die nur an der Strandbar einlösbar sind. Bislang hat es nur wenige Unfälle gegeben, die in erster Linie aber auf das Konto von Seeigeln und Quallen gehen.
In dieser Nacht hatte der Regen den Pool in der üblichen Weise zugerichtet. Das Wasser war dunkelbraun und mit einer dicken Schmutzschicht überzogen. Blätter und Zweige verstopften die Abflusssiebe. Wäre der Chlorgeruch nicht gewesen, hätte man sich wie in einem Mangrovensumpf fühlen können.
Ich schwamm zwei Längen, kletterte dann hinaus und stellte mich unter die Süßwasserdusche, um mir den Dreck abzuwaschen. Ich fragte mich noch immer, warum wir hergekommen waren. Offensichtlich hatte Elisabeth verspätet auf irgendetwas reagiert, was am Abend passiert war. Wenn es nicht die neue Kamera war, dann blieb nur Villegas.
Und dann dämmerte es mir. Sie hatte ihn verächtlich als den »großen Villegas« bezeichnet, den »kommenden Mann in deiner Heimat«. Bestimmt hatte sie etwas Negatives über ihn gehört und wusste nicht, ob sie mir davon erzählen sollte. Das musste sie beschäftigen. Elisabeth hat wie viele Leute eine komische Vorstellung vom Arzt-Patient-Verhältnis. Zwischen Arzt und Patient, so der Trugschluss, muss es immer gegenseitige Sympathie und Achtung geben, es reicht einfach nicht, wenn der Patient dem Arzt nur vertraut. Ein Arzt, der einen Patienten insgeheim unsympathisch findet oder nicht akzeptiert, kann ihn nicht richtig behandeln.
Ich hatte Elisabeth schon öfters gesagt, dass sie von Wunderheilern rede, aber an diesem Abend war sie offensichtlich zu Scherzen aufgelegt. Während sie ihre Runden drehte, rief ich mir die üblichen Argumente in Erinnerung.
Ich brauchte keines. Nachdem sie geduscht hatte, setzte sie sich im Dunkeln neben mich, rubbelte sich dabei die Haare trocken und fing an, mich über das Gespräch mit Gillon auszufragen.
»Welche Rolle hat er eingenommen?«
»Rolle?«
Ungeduldig schnipste sie mit den Fingern. »Wie hat er sich verhalten, wie ist er aufgetreten? Du weißt, was ich meine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich eingeschüchtert hat. Du bist zwar ein Ausländer, aber schließlich auch Arzt und ein angesehener Bürger der Stadt. Aber Typen wie er haben so eine Art, sich auszudrücken. Die Wörter mögen harmlos wirken, wenn man sie auf der Tonbandabschrift liest, aber der Tonfall, die Gesten bedeuten manchmal mehr als die eigentlichen Wörter.«
»Du meinst, ob er unangenehm war? Nein. Manchmal war er sogar richtig nett. Natürlich hat er davon gesprochen, dass sein Büro meinen Einbürgerungsantrag befürworten muss, falls ich einen stelle.«
»Aha.«
»Das ist vermutlich normal, wenn man etwas für sie tun soll, was einem nicht so schmeckt.«
»Du meinst, Leute für sie aushorchen.«
»So hat er sich nicht ausgedrückt, aber es war klar, was er gemeint hat. Er war bestimmt, aber nicht unangenehm. Was soll’s.«
Aber sie war noch nicht zu einer Erklärung bereit. »Hat er das Gespräch auf Band aufgenommen?«
»Ein Mikrophon oder Aufnahmegerät habe ich jedenfalls nicht gesehen. Ich glaube eher nicht. Manchmal war er ganz ungezwungen. Er gab sogar zu, dass er einen missglückten Vergleich gezogen hat.«
»Hat er gesagt, warum Villegas hier ist?«
»Villegas hat eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragt – zwecks Erholung und aus gesundheitlichen Gründen, das hab ich dir doch schon erzählt.«
»Aber das hast du ihm doch bestimmt nicht abgenommen! Hast du dich nicht nach den wahren Gründen erkundigt?«
»Er hat mir keine Gelegenheit gegeben. Die Entscheidung, Villegas eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, sei in Paris gefallen, sagte er. Und dass der Grund für die Entscheidung weder ihn noch mich zu interessieren habe. Er empfahl mir auch, darüber nicht zu reden – also genau das nicht zu tun, was wir im Moment tun.«
Sie überging die letzte Bemerkung. »Mit anderen Worten: Dieses ganze Trara von wegen Urlaub und Gesundheit ist einfach die Formel, die Paris ihm vorschreibt.«
»Wahrscheinlich. Wenn Villegas gesundheitliche Probleme hätte, die einen solchen Klimawechsel erforderlich machen, hätte er sich irgendwo in Mexiko etwas suchen können. Dort gibt es alle möglichen Klimaverhältnisse.«
»Paris möchte ihn also aus anderen Gründen auf der Insel haben?«
»Anscheinend.«
Elisabeth legte ihr Handtuch beiseite. »Willst du dich nicht erkundigen?«
»Erkundigen?«
»Inwiefern Villegas hier oder sonst wo für Paris von Nutzen ist?«
»Na schön, da du die Antwort ja offenbar weißt, werde ich mich erkundigen. Aber wen meinst du mit Paris? Den Quai d’Orsay, das Ministerium für die überseeischen Gebiete, den Premierminister oder den Staatspräsidenten?«
»Diese Herumalberei passt nicht zu dir, Ernesto, aber wenn du mich schon fragst, wohl eher den Finanz- und Wirtschaftsminister. Aber wenn ich mir so überlege, wie Gillon mit dir gesprochen und was er dir gesagt hat, nehme ich an, dass sich S-dec mit der Sache befasst.«
Ich stöhnte.
»S-dec – SDECE. Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage.« Sie machte eine leicht obszöne Handbewegung, mit der sich die Einheimischen normalerweise vor dem bösen Blick schützen. »Geheimdienst.«
»Ach so.«
»Ja. Sie brauchen einen glänzenden Erfolg. Du erinnerst dich doch bestimmt an die Affäre Ben Barka – ich habe dir den Artikel in Paris Match gezeigt.«
»Ich erinnere mich.«
»Natürlich. Überall erinnert man sich. Der arme S-dec! Sie haben sich längst von den brutalen Korsen getrennt, behaupten sie jedenfalls. Der Dienst wurde reformiert und umgebaut und in die Armee eingegliedert. Entführungen, Folter und Ermordung kommen jetzt nicht mehr vor. Die Burschen haben ein reines Herz. Aber geliebt werden sie noch immer nicht, weil ihnen niemand so recht über den Weg traut. Zur Bestätigung ihres neuen Image brauchen sie einen eindrucksvollen Erfolg. Sobald dieses Image etabliert ist, interessiert es sie nicht mehr, ob sie geliebt werden oder nicht. Man wird sie noch immer fürchten, aber nach außen werden sie als verantwortungsbewusster und tüchtiger Geheimdienst auftreten, der unbeirrt den Ruhm Frankreichs aufrechterhält.«
Ich seufzte wieder, diesmal etwas lauter. »Elisabeth, ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst.«
»Du meinst, was S-dec mit Villegas zu tun hat? Das liegt doch auf der Hand. Letztlich wollen sie ihn in der Hand haben. Aber noch geht das nicht. Die Burschen von der DST können den S-dec nicht ausstehen, das ist bekannt, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Solange Villegas sich aber auf französischem Boden befindet, ist die DST zuständig. Warum sollst du Gillon berichten, hm, was glaubst du? Wen meint er, wenn er warnend von gewissen Personen spricht, die sich bei dir nach den Bewohnern von Les Muettes erkundigen könnten? Die Presse? Die CIA? Gut, die vielleicht auch, aber in erster Linie will er dich vor dem S-dec warnen.«
»Warum interessiert sich S-dec überhaupt für Villegas? Du hast mir noch immer nicht erklärt, warum er deiner Ansicht nach hier ist.«
»Stimmt, du hast recht.«
Langsam ging mir die Angelegenheit auf die Nerven. »Mir ist gerade ein guter Grund eingefallen«, sagte ich. »Ich bin sogar ziemlich sicher, dass er die Sache trifft. Es geht nicht um das Klima, sondern um seine Gesundheit. Er leidet an Dyspepsie. Er verträgt das mexikanische Essen einfach nicht mehr.«
Sie lächelte souverän und küsste mich dann auf die Wange. »Wunderbar, chéri. Ich wünschte, es wäre so, aber ich glaube nicht, dass du recht hast. Meines Erachtens wird hier ein Spiel gespielt, und Villegas ist auf einmal eine lohnende Karte, die darüber entscheidet, ob man ein phantastisches Vermögen gewinnt oder verliert.«
Ich stand auf und gähnte.
»Ja, Ernesto, ich weiß. Du bist müde und musst schlafen gehen. Wir fahren jetzt zurück, und unterwegs erzähle ich dir alles.«
Und im Auto packte sie schließlich aus.
»Vor drei Monaten tauchten hier im Hotel vier gemeinsam reisende Männer auf, die zwei Nächte blieben. Sie hatten Plätze in der Freitagsmaschine der Air France nach Paris gebucht, aber statt direkt nach Fort de France weiterzufliegen, haben sie die Reise hier unterbrochen, einer von ihnen hatte Durchfall und war noch nicht ganz wiederhergestellt. Zwei der Männer waren Franzosen, der Kranke war Norweger, der vierte Holländer, und ihn, den Holländer, habe ich kennengelernt. Er kam in die Galerie, wollte sich nur etwas umschauen, und am Ende hat er einen Molinet gekauft. Natürlich kamen wir ins Gespräch.«
Ich nickte. Jeder, der einen Molinet kauft, ist für Elisabeth interessant. Sie dürften einigen Gesprächsstoff gehabt haben.
Nach einer Weile fuhr sie fort.
»Dieser Holländer erwähnte beiläufig, wo sie gewesen waren und wo sie sich den Durchfall geholt hatten. Es hatte sie reihum erwischt, und sie seien froh gewesen, sagte er, dass sie sich nichts Schlimmeres geholt hatten. Sie waren auf den Coraza-Inseln. Kennst du sie, Ernesto?«
»Ich war mal dort.«
Schon der Name rief Kindheitserinnerungen in mir wach.
Die Corazas sind eine kleine Inselgruppe, etwa hundert Kilometer südlich der Hauptstadt und vom Festland bei Punta Careya gerade zu erkennen. Ich war als kleiner Junge dort gewesen. Kurz nachdem sich mein Vater sein erstes Auto gekauft hatte, waren wir dorthin gefahren, die ganze Familie, zu einem kleinen Picknickausflug. Von der Landspitze aus, wo wir Rast machten, konnte man gerade eben zwei der Inseln erkennen. Sie sahen aus wie kleine blauschwarze Wolken am Horizont. Ich weiß noch, dass ich meinen Vater fragte, ob wir uns nicht ein Motorboot anschaffen und dorthin fahren könnten.
Es muss wohl mehrere Gründe gegeben haben, warum das nicht möglich war.
An die Antwort meines Vaters erinnere ich mich noch gut.
»Tja, Ernesto, wir könnten dorthin fahren, aber erst müssten wir uns Genehmigungen vom Innenminister, vom Marineminister und vom Fischereiminister besorgen. Und selbst wenn wir Glück haben und all diese Papiere bekommen, wäre es vielleicht besser, nicht dorthin zu fahren.«
»Wieso denn nicht, Papa?«
»Ernesto, die Leute, die auf den Inseln wohnen, sind bettelarm – Arawak-Indianer aus der Zeit vor der Eroberung, die unsere Sprache bis heute nicht sprechen und keine Schulen haben. Es gibt nicht sehr viele von ihnen, weil nur auf einer der Inseln Quellwasser vorhanden ist – auf der größeren der beiden, die man dort drüben erkennen kann – und weil es auch kaum mehr Nahrung gibt. Früher haben die großen Schildkröten dort gebrütet, aber dann ist irgendetwas passiert, das die Küstenregion zerstört hat, und die Schildkröten sind nicht mehr gekommen.«
»Und warum bleiben die Indianer dann?«
»Weil dort ihr Zuhause ist und weil sie ihre alten Götter haben, ihre Idole. Das ist angeblich ein Geheimnis, aber die Kirche weiß natürlich davon und hilft ihnen auf ihre Weise. Man hat eine Missionsstation eingerichtet, und eine Weile schickten die Ordensleute Kopra zum Festland, um Geld für die Inseln zu verdienen. Dann kam die Seuche. Es war ein ganz besonders heimtückisches Gelbfieber, gegen das unser Impfstoff keinen Schutz bot. So starben viele Christen. Es gab noch andere Krankheiten. Gleichzeitig kamen viele der Indianer durch Krankheiten um, die vom Festland eingeschleppt worden waren. Da also weder die Indianer noch die Inseln für unsere Großgrundbesitzer viel Geld abwarfen, wurden die Coraza-Inseln zum Natur-Reservat erklärt. Man verhängte Quarantänevorschriften, um auf diese Weise sicherzustellen, dass die Indianer ihre Krankheiten für sich behielten. Jetzt lässt man sie hilflos verhungern. Vielleicht gibt es bald keinen mehr von ihnen, und wir sind sie ein für alle Mal los.«
Mein Vater war verbittert. Zu der Zeit war sein soziales Gewissen noch sehr wach, und er kämpfte gegen viele Missstände. Als er fünf Jahre später das Manifest für nationalen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit formulierte, wurde die Lage der Coraza-Insulaner nicht einmal mehr erwähnt.
»Jetzt passiert also doch noch etwas«, sagte ich zu Elisabeth. »Ich dachte immer, dass die Corazas interessant sind, auch wenn mir nicht ganz klar ist, was sie mit dem Aufenthalt von Villegas auf Saint-Paul zu tun haben.«
Elisabeth fuhr gerade am Fischmarkt entlang – nachts immer sehr riskant wegen der vielen Betrunkenen, die keine Rücksicht auf den Verkehr nehmen. »Inwiefern interessant?«, fragte sie.
»Für Soziologen und Archäologen. Und Mediziner. Dieser Holländer, was war er von Beruf? Anthropologe oder Biologe?«
»Weder noch. Geologe.«
»Aber auf den Corazas gibt es doch gar keine Bodenschätze. Sonst hätte sich die Regierung schon längst darauf gestürzt. Außer Guano gibt es praktisch nichts, und selbst den gibt es nicht in vermarktbarer Menge.«
»Der Molinet, den er gekauft hat, war als Fluggepäck zu schwer, also musste ich ihm das Ding per Schiff nach Le Havre schicken. Das bedeutete Papierkram, also warf ich einen Blick in seinen Pass. Als Beruf stand da Erdölgeologe.«
Ich schwieg.
Sie fuhr fort. »Er erzählte mir auch, was die anderen drei waren. Der eine Franzose war Hydrograph. Die anderen beiden waren Ingenieure. Welcher Richtung, hat er nicht gesagt. Unkultivierte Typen, die sich nur für irgendwelche Druckziffern interessierten, was immer das sein mag. Aber als Gruppe waren sie ein richtiges Expertenteam.«
»Hat er gesagt, welchen Auftrag sie hatten?«
»Sie haben auf einem Vermessungsschiff gearbeitet. Er sagte, die Techniker an Bord waren Engländer, die Besatzung Jamaikaner und das Essen furchtbar.«
»Haben sie nach Öl gesucht?«
»Dass es dort Ölvorkommen gibt, ist ja bekannt. Sie sollten feststellen, wie man am besten rankommt.« Sie warf mir einen reumütigen Blick zu. »Entschuldige, Ernesto, ich habe nicht richtig zugehört. Ich musste immer daran denken, dass er es sich mit dem Molinet eventuell anders überlegt, weil das Ding so schwer war. Ich war zwar erleichtert, als er weiter über seinen Job erzählte, habe aber nicht so richtig hingehört. Deshalb wollte ich noch schwimmen gehen, ich wollte versuchen, mich genauer an das zu erinnern, was er gesagt hat.«
»Aber er hat gesagt, dass sie von dem Ölvorkommen schon wussten?«
»Ja ja. Anscheinend passiert das heutzutage überall. Von Ölvorkommen zu wissen, nützt einem noch gar nichts, verstehst du. Man muss wissen, wie man rankommt und ob sich die Investitionen lohnen, das ist das Entscheidende. Wenn der Preis für ein Barrel Rohöl bei drei Dollar liegt, es aber fünf Dollar kostet, um das Öl zu fördern, braucht man gar nicht erst anzufangen. Aber dann steigt der Ölpreis auf zwölf Dollar oder mehr und dann wird man wieder unsicher. Es sind die Ingenieure und Wissenschaftler, die diese Gleichungen lösen müssen. Er sagte, dass Teams wie das seine den neuen Reichtum produzieren.«
»Aber wieso ein europäisches Team?«, fragte ich. »Wenn die Oligarchie eine Bohrkonzession für das Gebiet um die Coraza-Inseln erteilt, dann doch bestimmt an eine amerikanische Gesellschaft. Die haben ihre eigenen Teams.«
»Schon, aber dieses hat sich auf Tiefseearbeiten spezialisiert. In mehr als dreihundert Metern Tiefe! Darauf war er mächtig stolz. Es ist etwas ganz anderes als die üblichen Off-shore-Bohrungen. Man braucht ein anderes Gerät. Vieles ist anders. Na ja, diese Leute klangen nicht wie Europäer, trotz ihrer Pässe, sie haben amerikanisches Englisch untereinander gesprochen, selbst der Franzose. Und sie haben nicht für eine Gesellschaft gearbeitet, sondern für ein internationales Konsortium. Daran erinnere ich mich genau. So wie er davon gesprochen hat, klang es, als wäre es der liebe Gott.«
»Und hat er gesagt, wie viele Firmen daran beteiligt sind? Hat er darüber was gesagt?«
»Ich glaube fünf. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass Villegas hierherkommt, sonst hätte ich ihn gefragt, um welche Firmen es sich handelt.«
»Und wenn eine französische Firma dabei ist, zu wie viel Prozent sie beteiligt ist?«
»Das auch.« Elisabeth parkte auf der Place Carbet.
Ich lauschte einen Moment den zirpenden Grillen. Viele Menschen finden dieses Geräusch beruhigend. Im Gegensatz zu mir.
»Du hast noch immer nicht erklärt, warum Villegas plötzlich wichtig ist«, sagte ich. »Du hast ihn als lohnende Spielkarte bezeichnet. Aber bei welchem Spiel?«
Sie kämmte sich die Haare. »Wenn du in einem Ölkonsortium wärst, Ernesto, und vorhättest, Milliarden von Dollar in eine Kaffeerepublik zu investieren, würdest du die Regierung dann nicht genau unter die Lupe nehmen, bevor du dich entscheidest?«
»Vermutlich.«
»Und wenn du siehst, dass ein paar Großgrundbesitzer das Land mit Hilfe kleiner Gangster beherrschen, die sich als Miliz kostümieren, und dass die Inflationsrate bei achtzig Prozent liegt – was würdest du dann machen?«
»Die CIA bitten, eine neue Regierung einzusetzen, schätze ich.«
Ich lächelte dabei.
Sie runzelte die Stirn. »Nein, so etwas würde die CIA nicht machen, nicht mehr, und ganz sicher nicht in Lateinamerika. Man will das Schmuddelimage loswerden.«
»Es war nur ein Scherz.«
Sie überging meine Bemerkung. »Man könnte allerdings eine andere Agentur, die sich für die Region interessiert, und das Konsortium veranlassen, die schmutzige Arbeit für einen zu übernehmen; und natürlich auch die Verantwortung, falls die Sache dummerweise schiefgeht. Mit den Engländern und Deutschen haben sie Vereinbarungen auf dieser Grundlage getroffen.«
»Du scheinst dich auf diesem Gebiet ja auszukennen«, bemerkte ich. »Oder phantasierst du dir das alles zusammen?«
»Ich kenne mich da tatsächlich aus.« Sie schüttelte das Handtuch aus. »Ich wäre nicht überrascht, wenn sie mit S-dec und den Franzosen einen Deal machen würden.«
Ich schwieg dazu, und sie schien auch keinen Kommentar erwartet zu haben.
»Nur eines verstehe ich nicht«, fuhr sie nachdenklich fort. »Warum haben sie dich zu seinem Doktor gemacht. Franz Josef war ja immer ein bisschen eifersüchtig auf den beliebten Maximilian, der besonders in der Lombardei viele Anhänger hatte, und manchmal machte es ihm auch Angst. Dieser Onkel Paco, wie heißt er gleich?«
»Segura.«
»Genau, dieser Segura ist vielleicht der Graf Grünne, der in seinen vertraulichen Empfehlungen bewusst auf diese Angst gesetzt hat.«
Eine Habsburger-Legende war das Letzte, was ich in diesem Moment hören wollte. »Elisabeth, ich bitte dich«, rief ich ärgerlich, »Ich bin sein Arzt, weil er um jemanden gebeten hat, der Spanisch spricht. So einfach ist das!«
Sie war so freundlich, mir diese Illusion zu lassen.
Doch später, als ich einzuschlafen versuchte, gingen mir immer wieder Dinge durch den Kopf, die sie gesagt hatte, und Dinge, die mir eingefallen waren.
Diese schlimme Sache, die sich an der Küste der Coraza-Inseln ereignet hatte, weshalb die Schildkröten dort nicht mehr brüteten – war das vielleicht eine massive Ölkatastrophe gewesen? Und was passiert, wenn eine Kaffeerepublik plötzlich reich wird?
Vielleicht wird Onkel Paco es mir sagen, dachte ich.
Schwester kühl und formell, bemüht würdevoll. Offensichtlich noch immer verärgert. Meine taktlose Bemerkung betr. Warze bedauerlich, aber vielleicht heilsame Nebenwirkung. Werde wohl nicht mehr gestört, außer in absoluten Notfällen.