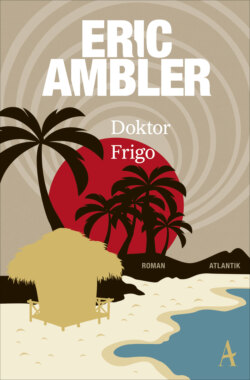Читать книгу Doktor Frigo - Eric Ambler - Страница 6
Montag, 12. Mai, vormittags
ОглавлениеIst es erst drei Tage her? Kommt mir länger vor.
Ich war in der Pathologie und assistierte Dr. Brissac bei einer Autopsie, als der Anruf von der Präfektur kam.
Die Leiche, an der wir arbeiteten, gehörte einem älteren Belgier, der mit einer Touristengruppe im Hotel Ajoupa gewohnt hatte. Er war während der Darbietung einer Steelband zusammengebrochen und tot hier eingeliefert worden. Todesursache schien ein Aneurysma der Aorta zu sein, doch die Witwe des Mannes hatte der Polizei gegenüber beharrlich darauf bestanden, dass ihr Mann an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sei, und schwere Vorwürfe gegen die Hotelleitung erhoben. Obwohl die anderen Gruppenmitglieder höchstens unter Verdauungsbeschwerden und Übellaunigkeit litten, den normalen Begleiterscheinungen eines Grillabends im Ajoupa – angekohlte Insel-Steaks sind quasi ungenießbar –, hatte der Untersuchungsrichter eine umfassende Autopsie angeordnet, und wir hielten uns strikt an die vorgeschriebene Prozedur.
Dr. Brissac ist der hiesige Direktor des Gesundheitsdienstes und zugleich Chefarzt, und falls es jemanden erstaunt, dass er eine so niedere Tätigkeit nicht delegierte, so kann ich nur sagen, dass Dr. Brissac mittlerweile darauf besteht, die Autopsien selber durchzuführen. Warum? Ich kann es nur vermuten. Einige meiner Kollegen sind der Ansicht, dass er als Arzt zu übertriebener Ängstlichkeit neigt und dass man viele interessante Fälle, die vorsichtshalber nach Fort de France ausgeflogen wurden, durchaus bei uns hätte behandeln können. Sie finden, dass er einem Jüngeren Platz machen solle. Mag sein, dass Brissac, gehemmt durch Erinnerungen an den einen oder anderen Fehler am lebenden Patienten, es inzwischen vorzieht, sein Handwerk an Toten zu praktizieren. Ich muss sagen, dass er am Seziertisch eine gewisse Leidenschaft erkennen lässt. Er arbeitet mit raschen, sicheren Handgriffen, und es ist ein Vergnügen, ihm bei der Arbeit zuzusehen.
Gerade hatte er die Bauchdecke geöffnet. Während ich am Colon ascendens zog, damit er die peritonealen Nervenstränge wegschneiden konnte, kam der Pathologiehelfer herein und teilte mit, dass ich am Telefon verlangt werde.
Ich bat ihn, den Anruf entgegenzunehmen. Er sagte, es sei jemand von der Präfektur, im Auftrag eines Kommissars Gillon, und dringend.
Dr. Brissac hielt inne und rief, ungeduldig mit der Schere herumfuchtelnd: »Bestellen Sie der Präfektur einen schönen Gruß von mir, aber Dr. Castillo kann im Moment nicht weg. Sagen Sie, dass er die Gedärme eines Toten in Händen hält und dass er zurückruft.«
Der Helfer entfernte sich grinsend, und wir arbeiteten weiter. Dr. Brissac ächzt und stöhnt sehr viel bei der Arbeit, spricht aber kaum ein Wort. Als wir zum Colon transversum kamen, blickte er zu mir herüber.
»Kennen Sie Kommissar Gillon?«
»Nur flüchtig. Vor ein paar Wochen kam er mit seinem jüngsten Sohn, der sich beim Baden an einem Felsriff ein Bein aufgeschnitten hatte. Der Kommissar wollte die Wunde versorgen lassen. Ich hatte gerade Dienst.«
Dr. Brissac spitzte die Lippen. »Davon hat er mir gar nichts erzählt.« Nach einer Weile fuhr er fort: »Neulich Abend war er bei uns zum Bridge, er hat sich nach Ihnen erkundigt. Nicht was Ihre beruflichen Fähigkeiten angeht – das steht ja alles in seinen Akten –, sondern Ihre privaten Interessen, Ihren Charakter.«
»Aha.«
»Was Sie in Ihrer Freizeit so alles machen, wenn Sie nicht gerade mit Ihrer Freundin ins Bett gehen, und abgesehen von Ihrer Hobbyknipserei. Welchen Eindruck ich von Ihnen hatte, als Sie letztes Jahr die mobile Ambulanz leiteten. Ob Sie allein zurechtkommen oder der Typ sind, den man an die Hand nehmen muss?«
»Interessante Fragen.« Ich tat so, als wäre mir egal, was er geantwortet hat.
Er sagte es mir ohnehin nicht. Er arbeitete sich zur Milz vor. Schließlich sagte er irgendwann: »Ich vermute, Sie wissen nicht, wer Kommissar Gillon ist oder was er hier macht.«
»Ich dachte, er ist Polizist. Ich wusste nicht, dass in der Präfektur Polizisten sitzen.«
»Er ist tatsächlich Polizist, aber kein gewöhnlicher. Er ist Chef der DST-Antenne in dieser Abteilung. Jedenfalls sagt er ›Antenne‹. Offiziell ist die Einheit vermutlich eine Brigade, aber vielleicht glaubt er, dass Antenne geheimnisvoller und wichtiger klingt. Diese politischen Typen …« Er unterbrach sich, als wäre ihm plötzlich bewusst, dass er sich auf heiklem Terrain bewegte. »Schon ganz sinnvoll, höflich zu ihnen zu sein«, fügte er hinzu.
Mehr bekam ich aus ihm nicht heraus. Es war klar, dass er mehr über den Telefonanruf und den Grund dafür wusste, als er mir sagen wollte.
Als wir mit der Autopsie fertig waren, tippte ich den vorläufigen Bericht, der dann von ihm unterschrieben werden musste, und schickte die entnommenen Proben ins Labor. Inzwischen war es zehn Uhr. Eigentlich hatte ich Dienst in der Ambulanz, aber dort war man selten ungestört, und ich wollte nicht belauscht werden, wenn ich mit der Präfektur über private Dinge sprach. Trotz Dr. Brissacs Andeutungen über Gillons Interesse an meiner Person konnte ich mir die Aufmerksamkeit des DST nur damit erklären, dass ich als Ausländer im Staatsdienst irgendwie verdächtig war.
Ich wurde zu einer Sekretärin durchgestellt. Sie war brüskiert. Dr. Brissacs kleiner Scherz über die Eingeweide war bei ihr offenbar nicht gut angekommen. Kommissar Gillon wolle um halb zwölf in seinem Büro mit mir sprechen. Nicht um zwölf, nicht um Viertel vor zwölf, um halb zwölf. Meine Verpflichtungen im Krankenhaus in Ehren, aber ich könne mich bestimmt von einem Kollegen vertreten lassen. Halb zwölf also, im Büro von Kommissar Gillon, im zweiten Stock des Anbaus. Auf Wiederhören.
In der Ambulanz waren an diesem Tag nur sehr wenige Patienten. Einer von ihnen war ein alter Fischer mit Diabetes, den ich kennengelernt hatte, als ich mit der mobilen Ambulanz die kleineren Inseln abgefahren hatte. Die örtliche Apotheke versorgte ihn inzwischen mit Insulin, aber alle drei Monate kam er, um sich von mir untersuchen zu lassen. Seine Frau begleitete ihn jedes Mal. Sie konnte seine Krankheit nicht verstehen – oder sich daran erinnern, was ich ihr das letzte Mal darüber gesagt hatte –, und da ich Mühe hatte, meine einfachen Erklärungen in Patois zu übersetzen, war auf beiden Seiten Geduld vonnöten. Um Viertel nach elf kam ich schließlich weg, doch mein Moped wollte nicht anspringen, sodass ich bis zur Hauptstraße in die Pedale treten musste. Ich schwitzte und war unruhig und empfand die Schussfahrt in die Stadt hinunter nicht so erfrischend wie sonst.
Die Insel Saint-Paul-les-Alizés wurde von Columbus auf seiner zweiten Westindienreise gesichtet und erhielt von ihm den Namen San Pablo de las Montañas. Die »Berge« waren die beiden Gipfel des Vulkans (er heißt heute Mont Velu), dessen Krater sich während der Ausbrüche von 1785 vereinigten. San Pablo stand nie unter spanischer Kolonialherrschaft. Die einheimischen Kariben waren ein wildes Völkchen, und die drei Dominikanermissionen, die sie zum rechten Glauben bekehren sollten, wurden am Ende allesamt massakriert. Anderthalb Jahrhunderte später, als eine französische Handelsgesellschaft die Insel in Besitz nahm, wurden die Kariben von Saint-Paul ihrerseits von besser bewaffneten europäischen Wilden massakriert. Abgesehen von einer zeitweiligen Besetzung durch die Engländer während der napoleonischen Kriege ist die Insel seit dieser Zeit bis heute französisch.
Obwohl Saint-Paul, wie Martinique, Guadeloupe und die anderen Inseln der französischen Antillen, rasant »entwickelt« wird, sind nur wenige der jüngsten Errungenschaften von Saint-Paul – der Industriekomplex (»Plan Fünf«), das Handelszentrum, die billigen Sozialblocks, die neue Grundschule, der Supermarkt »Alizés« und das Hotel Ajoupa – bis zum alten Hafen von Fort Louis und zu den weiter oberhalb gelegenen Straßen vorgedrungen. Innerhalb des Talkessels, der von den Festungsmauern auf der Landspitze, der Hafenmole und den Hügeln des Grand Mamelon begrenzt wird, sieht es noch immer wie im neunzehnten Jahrhundert aus. Zwar gibt es auf dem Dach der Zitadelle neben dem Flaggenmast inzwischen auch große Fernmeldeschüsseln, Jumbojets heben donnernd von der verlängerten Startbahn ab, und draußen auf der anderen Seite der Bucht, auf den grünen Hängen von La Pointe de Christophe, schießen wie Giftpilze die Betonmasten des neuen Club Nautique aus dem Boden, aber Fort Louis selbst hat sich kaum verändert. Die Stadt ist noch immer hässlich, übervölkert, laut, heruntergekommen und ein einziges Dreckloch.
Die Präfektur befindet sich an der Place Lamartine, auf halber Höhe den Berg hinauf.
Wenn in der Informationsbroschüre des Bureau de Tourisme behauptet wird, die Altstadt sei eine »malerische Erinnerung an die koloniale Vergangenheit«, so ist das zwar nicht völlig falsch, aber doch irreführend. Vor wenigen Jahren wurden in einer Straße die alten Fassaden aus Kalkstein und Maçonne-du-bon-Dieu restauriert. Damit hatte es sich, aber uns, die wir dort wohnen, reichte das nicht. Am Zustand der Rohrleitungen änderte sich überhaupt nichts. Er erinnert an die koloniale Vergangenheit in einer Weise, dass selbst die abgebrühten Männer vom Service Sanitaire aus dem Staunen nicht herauskommen. Mit dem Geld, das eigentlich dafür bereitgestellt worden war, installierte man stattdessen eine Klimaanlage in der Präfektur. Die Entrüstung über die bürokratischen Tricks, mit deren Hilfe man diesem eklatanten Schwindel einen Anschein von Legalität verlieh, hat sich bis heute nicht gelegt.
Die Präfektur, gebaut im Jahre 1920, nachdem das alte Gebäude bei einem Brand zerstört worden war, sieht aus wie das Rathaus einer nordfranzösischen Industriestadt, das man hierhertransportiert und dann weiß getüncht hat. Frech starrt es das Standbild von Lamartine an, dem Dichter, der als Staatsmann die Menschen zu befreien suchte und so unbestechlich war, dass er am Ende keinen Pfennig mehr besaß.
Der schwarze Polizist unter der schlaff herabhängenden Trikolore beäugte mich misstrauisch, als ich mich nach dem Büro von Kommissar Gillon erkundigte, und wies dann auf den Anbau.
Das Hauptgebäude mit seinem knarrenden Parkett ist mir sehr vertraut – das Büro für Ausländer befindet sich im Zwischengeschoss –, aber bis zum Anbau war ich noch nie vorgedrungen. Man erreicht diesen Gebäudeteil (der nach der »Angliederung« von 1946 im Garten der Präfektur errichtet worden war) über eine schmale Seufzerbrücke vom zweiten Stock aus. Ein Schild mit einer Zeigehand wies darauf hin, dass dort unter anderem die Büros des Innenministeriums und der Direction de la Surveillance du Territoire untergebracht sind.
In nordamerikanischen Zeitschriften wird die DST gelegentlich als das französische FBI bezeichnet, was zwar ein griffiger, prägnanter Vergleich ist, aber nicht ganz zutrifft. Das FBI hat die Aufgabe, gewisse Verbrechen zu bekämpfen, die unter Bundesrecht fallen, unter anderem die Spionagetätigkeit ausländischer Mächte. Die DST befasst sich nur mit Gegenspionage auf französischem Boden und allen damit zusammenhängenden Fragen und beschränkt sich, obwohl eine Abteilung der Sûreté Nationale, mehr oder weniger auf den Schutz der inneren Sicherheit. Es gibt noch andere Unterschiede. Filme und Fernsehserien, in denen FBI-Agenten als Helden dargestellt werden, mögen nicht mehr besonders populär sein, aber immerhin gibt es sie. Sollte es auch nur einen einzigen Film geben, der einen DST-Agenten in sympathischem Licht zeigt, wäre ich sehr überrascht. Jedenfalls habe ich noch keinen gesehen. Während ein normaler Bürger der Vereinigten Staaten, der von FBI-Vertretern angesprochen wird, sich womöglich geschmeichelt fühlt, dürften die meisten Franzosen, die ohnehin allen Polizisten misstrauen, einer ähnlichen Einladung seitens der DST nur äußerst unwillig und mit stärksten Bedenken Folge leisten. Ich bin zwar kein gebürtiger Franzose, aber Frankreich ist meine Wahlheimat. Dem Gespräch mit Kommissar Gillon sah ich daher mit der allergrößten Skepsis entgegen.
Der Empfang im Vorzimmer beruhigte mich nicht gerade. Die Sekretärin, eine herrische, braunhäutige Frau mit reichlich Gold im Gebiss, tippte vorwurfsvoll auf das Ziffernblatt ihrer Armbanduhr, um mich daran zu erinnern, dass ich spät dran war, zeigte dann auf eine Sitzbank und sagte, dass ich nun warten müsse. Um ihr Missfallen zu unterstreichen, packte sie ein paar Akten, die auf ihrem Schreibtisch lagen, hierhin und dorthin und zündete sich dann eine Zigarette an. In der Ecke des Zimmers tickerte ein Fernschreiber ruhig vor sich hin. Ein junger Weißer, der das Gerät bediente, stöhnte hin und wieder auf – ob aus Langeweile oder aus Unmut, war schwer zu sagen. Es schien, als würde via Fernschreiber eine Art Auseinandersetzung geführt. Das Gestöhn des jungen Mannes begann die Sekretärin zu amüsieren. Auf ihren Lippen lag schon ein sorgfältig formulierter Scherz, als die Gegensprechanlage auf ihrem Schreibtisch loskrächzte. Mit einer ungeduldigen Handbewegung schickte sie mich hinein.
Der Kommissar Gillon, den ich im Krankenhaus erlebt hatte, war ein besorgter, schwitzender Vater im Strandhemd gewesen, der mit einem verletzten, quengeligen Jungen erschienen war. Der Gillon, dem ich jetzt gegenübertrat, war ein hochrangiger Beamter, der ruhig in einem klimatisierten Büro saß. Er war untersetzt, muskulös, in den Vierzigern. An diesem Tag trug er einen grauen Anzug. Er hatte eine Lesebrille mit halben Gläsern, eine helle, gesunde Hautfarbe, kurzes blondes Haar und ein blendend weißes Gebiss. Ein gut aussehender Mann mit einer Stupsnase und schweren Lidern über lebhaften Augen. Er sprach Pariser Französisch. Er brachte es fertig, mich mit einer knappen Armbewegung zu begrüßen und gleichzeitig zum Stuhl auf der anderen Seite seines Schreibtischs zu dirigieren.
»Schön, dass Sie sofort gekommen sind.« Er saß schon wieder und lehnte sich zurück. »Dr. Brissac hat keine Schwierigkeiten gemacht?«
»Nein. Ich hoffe, das Bein Ihres Jungen ist gut verheilt.«
»Absolut. Dr. Massot hat den Verband gewechselt. Er ist unser Hausarzt, wissen Sie. Ich wollte Sie nicht unnötig ein zweites Mal beanspruchen. Kennen Sie Massot?«
Er sprach von dem Arzt, der die meisten Weißen von Fort Louis betreut und Besitzer der teuren Clinique Massot ist.
»Flüchtig. Manchmal nimmt er die Einrichtungen unseres Hauses in Anspruch.«
Gillons feines Lächeln ließ erkennen, dass meine Antwort, obschon vorsichtig formuliert, meine wahre Einstellung gegenüber Dr. M. nur unzureichend verborgen hatte. Dr. M. war dank eines krassen Fehlurteils seitens der Krankenhausverwaltung zum ehrenamtlichen Berater der orthopädischen Abteilung berufen worden, und die Tatsache, dass diese Position unbezahlt war, hatte er so interpretiert, dass er unsere Röntgen- und Laboreinrichtungen für seine Privatpatienten oder seine Privatklinik stets mit Vorrang benutzen dürfe. Er macht uns oft Stress.
Die nächste Frage verwirrte mich jedoch. »Hat Massot mit Ihnen jemals in einer anderen Sprache als Französisch gesprochen?«
»Ein, zwei Mal, ja.« Dr. M. zeigt gern, dass er rudimentäre Kenntnisse in mehreren Sprachen hat. Im Hotel Ajoupa soll er während der Touristensaison ziemlich absahnen.
»Wie ist sein Spanisch?«
Kollegiale Rücksichtnahme war in diesem Fall nicht nötig. »Sein Deutsch erschien mir verständlicher. Ich selbst kann allerdings kein Deutsch.«
Der Kommissar grinste, nahm ein grünes Dossier und hielt es mir so hin, dass ich meinen Namen sah, der darauf stand – Castillo Reye, Ernesto. Das unverbindliche Geplauder (oder was ich dafür gehalten hatte) war zu Ende. Jetzt würde sich herausstellen, warum ich herbeordert worden war.
Er setzte ein offizielles Gesicht auf. »Herr Doktor, Sie verstehen gewiss, dass wir uns für den Status und die Aktivitäten von Ausländern in unserer Mitte interessieren, selbst wenn es sich bei diesen Personen um angesehene Ärzte handelt.«
»Ja.«
»Aber natürlich kann man nicht immer über alles Bescheid wissen. Wir können observieren, was der Betreffende tut, wie er sich verhält, wer seine Freunde und Bekannten sind und so weiter und so fort. Und aus diesen Erkenntnissen können wir gewisse Schlüsse ziehen. Wenn wir es aber nicht mit Personen zu tun haben, die sich erfahrungsgemäß leicht einschätzen lassen – Betrüger, Prostituierte, kleine Abenteurer –, können wir nicht immer wissen, was der Betreffende denkt, welche Ansichten er vertritt. In manchen Bereichen können solche Informationen sehr wichtig sein. Ärzte, denke ich, haben manchmal ähnliche Schwierigkeiten bei der Diagnose. Symptome sagen nicht immer die Wahrheit.«
»Patienten auch nicht.«
Er sah mich überrascht an. »Die Leute erzählen Ihnen tatsächlich Lügen?«
»Manchmal, aber selten ganz bewusst. Meistens belügen sie sich selbst. Der Arzt soll bei der Verschwörung bloß Hilfestellung leisten. Was wollten Sie denn über mich wissen, Herr Kommissar?«
Er warf mir einen spöttischen Blick zu. »Na schön. Laien sollten die Finger von medizinischen Vergleichen lassen. Also, ein paar Fragen. Vor zwei Jahren hätten Sie einen Antrag auf Verleihung der französischen Staatsangehörigkeit stellen können. Das war Ihnen offensichtlich bekannt, denn Sie haben Maître Bussy in dieser Sache konsultiert. Sie sind sogar noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben ihm den erforderlichen Lebenslauf vorgelegt. Dann, nur einen Monat später, teilen Sie ihm mit, dass Sie den Antrag zurückziehen wollen. Wieso?«
»Meine Mutter war dagegen.«
»Ihre Mutter? Mit welchem Argument?«
»Vielleicht ist ›sie war dagegen‹ nicht ganz richtig. Sie hat an mich appelliert, als guter Sohn nicht das Land aufzugeben, für das mein Vater den Märtyrertod gestorben war.«
»Und Sie haben diese Auffassung akzeptiert?«
»Nein. Aber es ging meiner Mutter nicht besonders gut, sie hatte Schmerzen. Ich wollte nicht, dass sie zu den anderen Sorgen noch psychischen Stress hatte.«
»Aber Ihre drei Schwestern hatten doch schon eine andere Staatsangehörigkeit angenommen.« Er zeigte auf das Dossier. »Zwei sind Amerikanerinnen, die dritte Mexikanerin, jedes Mal durch Eheschließung. Hat Ihre Mutter da ähnliche Einwände vorgebracht?«
»Bei Frauen aus der Generation und der Schicht meiner Mutter waren es immer die Söhne, die in die Pflicht genommen wurden. Und wenn man der einzige Sohn ist …«
»In welche Pflicht genommen? Dass er eines Tages in die Heimat zurückkehrt und den Märtyrertod seines Vaters rächt?«
Ich dachte eine Weile nach, bevor ich antwortete. Bei manchen Themen ist es ratsam, nicht allzu offen zu sein, nicht einmal gegenüber einem intelligenten und unsentimentalen Menschen wie Gillon.
Die Wahrheit ist, dass mein Vater nie ein Märtyrer im eigentlichen Sinne des Wortes war, außer für meine Mutter und vielleicht einige seiner gläubigeren Genossen. Er war kein Martin Luther King, kein Kennedy und schon gar kein Lumumba. Mit seiner Rednergabe konnte er die Massen packen, sogar zu Tränen rühren, aber in der Achtung der Leute lag nichts Romantisches, keine Liebe. Sie glaubten wohl, dass er ihr Los verbessern würde, dass er sich für sie engagierte und wirklich ihr Freund war. Sie applaudierten ihm und äußerten lautstark ihre Begeisterung, aber wenn er sich unter sie mischte, drängte niemand vor, ihn zu berühren. In einer Menschenmenge war er derjenige, dem man respektvoll Platz machte. Die wesentliche Fähigkeit des wahren Demagogen, zu vergessen und damit andere vergessen zu machen, dass er im Grunde seines Herzens ein Politiker ist – diese Fähigkeit besaß er nicht. Die Ermordung eines solchen Menschen mag ein aufsehenerregendes Ereignis sein, Anlass zur Entstehung einer Märtyrerlegende ist sie selten.
Doch mir ist klar, dass gute Söhne nicht in dieser Weise über ihre toten Väter sprechen sollten. Gillon mochte ein hochrangiger DST-Beamter sein, aber er war auch, wie ich sehr wohl wusste, ein liebevoller Vater und Familienmensch. Da es keinen Sinn hatte, ihn unnötig vor den Kopf zu stoßen, wich ich seiner Frage aus.
»Meine Mutter hat sich jahrelang damit getröstet, dass der Tod meines Vaters gerächt werden muss und irgendwann auch gerächt werden wird. Dieser Ansicht war ich nie.«
»Haben Sie ihr das gesagt?«
»Ich habe dieses Thema wenn irgend möglich vermieden. Sie könnten sagen, dass ich ihr etwas vorgemacht habe. Als ich mich vor zwei Jahren bereit erklärte, meine Staatsangehörigkeit zu behalten, hat meine Mutter gewiss angenommen, dass ich mich nicht nur ihren Wünschen beuge, sondern auch ihre politische Vision teile. Und ich bin sicher, dass ihre engsten Vertrauten sie darin bestärkt haben.«
»Mit engsten Vertrauten meinen Sie vermutlich die Mitglieder der Partei Ihres Vaters, die im Exil sind?«
»Ich meine diejenigen Parteimitglieder, überwiegend Spinner, Betrüger und Postenjäger, die sich in Florida eingenistet haben.«
»Haben Sie noch Kontakt zu diesen Leuten?«
»So wenig wie möglich, eigentlich gar nicht.«
»Briefkontakt?«
»Hin und wieder schicken sie mir ihr schwachsinniges Mitteilungsblatt, das dort erscheint. Hin und wieder werde ich um Geldspenden gebeten. Auch darauf reagiere ich nicht.«
»Ihre Mutter hat Mitglieder dieses Kreises mit beträchtlichen Summen unterstützt.«
»In der Tat. Wie Sie vielleicht wissen, erschien es der Junta opportun, in Bezug auf das Vermögen meines Vaters eine großzügige Regelung zu treffen. Als meine Mutter nach Florida ausreiste, wurden die Devisenvorschriften eigens für sie gelockert. Die Emigranten dort haben sich jahrelang auf ihre Kosten ein schönes Leben gemacht. Für ihre hohen Arztkosten mussten dann mein Schwager und ich aufkommen. Ihr ganzes Geld war verjubelt oder einfach gestohlen. Nach ihrem Tod erklärte sich der Schatzmeister eines Vereins von Exilkubanern freundlicherweise bereit, kostenlos die Bücher zu prüfen. Er empfahl uns, zur Polizei zu gehen und in bestimmten Fällen Anzeige zu erstatten.«
»Was Sie aber nicht getan haben.«
»Nein, wir haben nur damit gedroht. Leider, bei den hohen Arztrechnungen konnten wir uns nicht auch noch Prozesskosten leisten.«
»Wir tauschen ja regelmäßig mit dem FBI Informationen auf inoffizieller Basis aus. Wären Sie überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass Sie, laut einem Bericht, den wir kürzlich erhielten, von der Gruppe in Florida als künftiger Parteichef und möglicher Chef einer Übergangsregierung genannt werden?«
»Meine Schwester Isabella hat mir davon geschrieben. Gleichzeitig erhielt ich übrigens eine Reihe jener Spendengesuche, von denen ich vorhin sprach. Nein, überrascht war ich nicht. Nichts von dem Quatsch, den die Florida-Fraktion veröffentlicht, kann mich noch erschüttern. Ich war aber betrübt, weil ich annehmen musste, dass meine Mutter die Verwendung des Namens Castillo genehmigt hatte. Aber da lag sie schon im Sterben, und unser Name war das Einzige, was sie noch hergeben konnte.«
»Sie glauben also nicht an eine Zukunft der Demokratisch-Sozialistischen Partei Ihres Vaters? Sehen Sie nicht die Chance, dass die gegenwärtige Regierung eines Tages gestürzt wird?«
»Nicht, wenn man es der Florida-Gruppe überlässt. Ob sie für die gesamte Opposition repräsentativ ist, ist eine andere Frage.«
»Wie ist Ihre Meinung dazu?«
»Ich weiß nicht genug, um dazu etwas sagen zu können. Ich lese dieselben Zeitungsmeldungen über die verschiedenen Fraktionen wie alle anderen Leute auch. Die kubanische Gruppe dürfte mehr oder weniger marxistisch orientiert sein, kein Wunder. Und die Villegas-Gruppe …«
Ich zögerte. Der Kommissar drängte mich weiter: »Ja? Was halten Sie von der Villegas-Gruppe?«
»Die sitzt ja bekanntlich in Mexiko. Nach Informationen meiner Schwester Isabella – und ich versichere Ihnen, ich habe dort keine anderen Quellen – hat die Gruppe um Villegas enge Kontakte zur Stadtguerilla in unserem Land, diesen militanten Jugendlichen, die der Oligarchie so enorm zusetzen. Von diesen Kontakten weiß ich natürlich nur vom Hörensagen. Die Florida-Fraktion kann die Mexiko-Fraktion nicht ausstehen, weil die anscheinend keine Geldsorgen hat. Es heißt immer wieder, dass Villegas von der CIA unterstützt wird. Auch das reines Gerede. Aber das ist ja mehr oder weniger üblich. Jede politische Gruppe in Lateinamerika, die nicht bettelarm ist, muss einfach von der CIA finanziert werden. Was die politische Richtung angeht, so dürfte die Villegas-Gruppe – und auch das habe ich von meiner Schwester – links von der Mitte stehen.«
»Nicht zu weit von der Position entfernt, die Ihr Vater eingenommen hätte.«
»Vermutlich. Allerdings kann ich mir meinen Vater nicht als Chef einer Gruppe treuer Emigranten vorstellen, welcher Position auch immer.«
»Nein? Er war doch Politiker.«
»Meinem Vater gefiel es, politische Macht zu haben. Und Geld wollte er auch haben. Über den Vorwurf, ein Opportunist zu sein, lachte er. Er fasste es als eine Art Kompliment auf. Wenn er ins Exil getrieben und nicht ermordet worden wäre, hätte er wieder als Anwalt gearbeitet oder, wenn das nicht gegangen wäre, sich an einem lukrativen Geschäft beteiligt. Er hatte nicht den Nerv für langwierige Kämpfe, auch wenn auf seinem Banner die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit stand. Die Ziele, für die er eintrat, mussten immer in absehbarer Zeit erreichbar sein.«
Der Kommissar sah mich einen Moment etwas merkwürdig an, so als wollte er seinen Ohren nicht recht trauen, und zuckte dann mit den Schultern. »Wie ich gehört habe, sollen Sie Ihren Vater sehr geliebt haben. Was Sie da sagen, klingt aber nicht danach.«
Da ich nun doch in die Falle gegangen war, die ich bislang erfolgreich vermieden hatte, musste ich nach Kräften versuchen, mich irgendwie herauszureden.
»Genau dieselben Worte hat meine Mutter auch verwendet, als sie mich zum soundsovielten Mal drängte, seinen Tod zu rächen.«
Es funktionierte. Gillon erstarrte. Der Vergleich mit meiner Mutter, wie entfernt auch immer, gefiel ihm nicht.
»Soweit ich Ihre Landsleute kenne, bräuchten nur wenige in einer solchen Angelegenheit gedrängt zu werden. Immerhin gibt es bei Ihnen den Machismo, dieses ausgeprägte Männlichkeitsgefühl.«
»Nicht nur in meiner Heimat. In ganz Lateinamerika. Aber ich stimme Ihnen zu. Viele sinnlose Morde werden von Leuten verübt, die es für einen Beweis von Männlichkeit halten, einen Menschen umzubringen, der sie beleidigt hat. Ich selbst sehe das anders. Vielleicht zeigt sich darin der verderbliche Einfluss meiner französischen Ausbildung.«
»Vielleicht.« Er hielt inne, um über diese ketzerische Bemerkung nachzudenken. »Oder hat es damit zu tun«, fuhr er fort, »dass Sie nie herausgefunden haben, wer für die Tat verantwortlich war? Ich meine, wer das Attentat geplant hat.«
»Werde ich in Ihrer Achtung noch tiefer sinken, wenn ich Ihnen erkläre, dass ich mich im Grunde nie darum bemüht habe?«
»Hat es Sie nicht interessiert?«
»Nein, nein. Was immer man Ihnen erzählt hat, ganz so gefühllos bin ich nicht. Aber ich lege einfach Wert auf Beweise. Was bislang zutage gefördert wurde, war keinen Pfifferling wert. Eigentlich müssten Sie das wissen. Vielleicht hätte ich mich intensiver darum kümmern sollen, aber ich bin kein Polizist, auch kein Amateurdetektiv, der jede Menge Zeit hat.«
»Glauben Sie denn, dass es irgendwo noch Beweise gibt?«
»Möglicherweise gibt es im Verteidigungsministerium, das sich in Sichtweite der Treppe befindet, auf der mein Vater ermordet wurde, Dokumente, aus denen die Namen der Verantwortlichen hervorgehen. Erst recht, wenn es sich um Mitglieder der Partei meines Vaters handelt. Und selbst wenn es Angehörige der Sicherheitskräfte waren, die auf Anweisung der Junta gehandelt haben, könnte es irgendwo noch Beweise geben. Bürokraten sind vorsichtige Leute, die vernichten nicht so schnell Unterlagen, selbst wenn man es ihnen befiehlt. Man kann schließlich nie wissen, ob sie nicht eines Tages doch nützlich sind.«
»Ich verstehe. Die Dokumente existieren vielleicht, aber niemand wird sie Ihnen einfach so zeigen. Und selbst wenn Sie wüssten, wo diese Dokumente aufbewahrt werden, müssten Sie feststellen, welcher Beamte dafür zuständig ist und welche Sorte Bestechungsgeld nötig ist. Hab ich recht?«
»Außerdem gibt es ja dieses alljährliche Ritual, das mich vor der Versuchung schützen soll, meiner Neugier nachzugeben. Wenn ich mir vom französischen Konsul in Fort de France meinen Pass verlängern lasse, werde ich immer wieder daran erinnert, dass dieses Dokument nur von begrenztem Nutzen ist. Es gilt für die ganze Welt, nur nicht für Reisen in mein Heimatland.«
»Ihre Mutter ist vor einem halben Jahr gestorben. Wollen Sie ihre sentimentalen Wünsche hinsichtlich Ihrer Staatsangehörigkeit ewig weiterbefolgen?«
»In ihrer Familie dauert die Trauerzeit mindestens ein Jahr. Daran werde ich mich halten. Ich bin aber sicher, dass das Konsulat in Fort de France einen Antrag auf Erteilung eines Einreisevisums ablehnt, wenn ich einen französischen Pass vorlege. Die Ablehnung würde nur etwas höflicher formuliert, das ist alles.«
»Ja, ich verstehe. Nur noch eine Frage. Das gegenwärtige Regime – die Oligarchie, wie sie genannt wird – ist ja bekanntlich alles andere als stabil. Sollte ein von der Armee getragener Staatsstreich zur Machtübernahme der Demokratischen Sozialisten oder zu einer Koalitionsregierung führen, die bereit wäre, das gegen Sie verhängte Einreiseverbot aufzuheben, wären Sie dann bereit zurückzukehren?«
»Für einen kurzen Besuch vielleicht. Nicht für immer. Ich habe hier meine Arbeit, und sie macht mir Spaß.«
»Als Sohn Ihres Vaters würde man Ihnen womöglich einen Posten in der neuen Regierung anbieten – das Gesundheitsministerium etwa.« Er lächelte, aber es war durchaus ernst gemeint.
»Ich würde ablehnen. Meine Kindheit hat mich gegen politischen Ehrgeiz immun gemacht. Ich bin Arzt, Karriere möchte ich nur in meinem Beruf machen.«
Apropos Beruf. Es ist jetzt 2 Uhr. Die Schwester brachte mir ein Glas Tee. Ein deutliches Friedensangebot. Dadurch ermutigt, beschloss ich, ihre Warze zu erwähnen. Ein schwerer Fehler meinerseits, in jeder Hinsicht. Es ist keine Warze, sondern ein pigmentierter Naevus. Schwester sehr gekränkt. Wortreiche Entschuldigungen. Sie akzeptierte sie nur pro forma, wie mir die aufeinandergepressten Lippen und der abgewandte Blick deutlich signalisierten. Muss mich in Zukunft um meine eigenen Dinge kümmern. Sollte nach dem Rundgang etwas schlafen, habe aber das Gefühl, dass ich zuerst den Bericht über Gillon zu Ende schreiben sollte. Zum Teufel mit pigmentierten Naevi. Zum Teufel mit Gillon.
Da er gesagt hatte, dass es seine letzte Frage sei, ging ich davon aus, dass unser Gespräch mit meiner Antwort beendet war. Ich hatte ihm erklärt, warum ich meinen Antrag auf Verleihung der französischen Staatsangehörigkeit zurückgezogen hatte. Seinen Verdacht, dass ich in Emigrantenkreisen engagiert bin, hatte ich wohl zerstreut. Also stand ich auf, um ihm die Mühe zu ersparen, mich zur Tür zu bringen.
Er reagierte gereizt. »Wir sind noch nicht fertig, Herr Doktor. Setzen Sie sich bitte wieder.«
Ich gehorchte. »Sie haben gesagt, Sie wollten mir ein paar Fragen stellen. Ich habe sie beantwortet.«
»Und Sie werden sich freundlicherweise anhören, warum ich sie Ihnen gestellt habe.«
Ich schwieg und machte wahrscheinlich ein arrogantes Gesicht. Ich habe mir sagen lassen, dass Dr. Frigo meistens so reagiert, wenn er klein beigeben muss.
Gillon beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. »Was den Antrag auf Verleihung der Staatsbürgerschaft angeht, so sollten Sie wissen, dass uns solche Anträge zur Beurteilung und Stellungnahme vorgelegt werden.« Er zeigte mit dem Finger auf mich. »Wir können ja oder nein sagen. Sie sollten darüber nachdenken, bevor Sie sich weigern, mit uns zusammenzuarbeiten.«
»Ich habe mich nicht geweigert.«
»Gut. Dann können wir ja weitermachen.« Auf seinem Schreibtisch lag ein zweites Dossier, mit einem gelben Deckel. Mit dem Zeigefinger drehte er es so, dass ich den Namen lesen konnte, der in Druckbuchstaben darauf stand.
VILLEGAS LOPEZ, MANUEL
»Was wissen Sie über ihn?«, fragte Gillon.
»Abgesehen davon, dass er die Mexiko-Gruppe anführt, nicht sehr viel. In den letzten zehn Jahren hat er als Dozent in der Ciudad Universitario gearbeitet. Er dürfte um die fünfzig sein. Als Student ging er in die Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht genau, an welche Universität, aber ich glaube, er hat Architektur studiert.«
»Ingenieurwissenschaft. Und das hat er auch in Mexiko unterrichtet. Er ist Professor.«
»Als er in das Zentralkomitee der Partei gewählt wurde, arbeitete er in einem Architekturbüro. Vielleicht als Ingenieur. Ich habe seinerzeit studiert. Das war vor ungefähr sechzehn, siebzehn Jahren. Ich weiß noch, wie mein Vater sagte, dass Villegas genau das dringend benötigte frische Blut in die Partei bringe – er war jung, aber nicht zu jung, hatte Berufserfahrung, ein Sozialist, der auf den ganzen ideologischen Kram verzichten konnte, ohne seinen Überzeugungen untreu zu werden.«
»Das klingt, als würden Sie jemanden zitieren. Waren das die Worte, mit denen Ihr Vater Villegas beschrieben hat?«
»Ja, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Diese Worte sind mir nicht eingefallen, weil wir über Villegas sprechen. Mit ihnen hat mein Vater immer aufstrebende, neue Parteimitglieder beschrieben, die sein Lob verdient hatten. Es bedeutete, dass der Betreffende so weit Pragmatiker war, dass er völlig mit meinem Vater übereinstimmte, zumindest nach Ansicht meines Vaters. Natürlich hatte er nicht immer recht. Wenn er sich geirrt hatte, hieß es von dem Mann, der die Dinge am Ende doch nicht so sah wie er, er sei ein Abenteurer.«
»War Villegas ein Abenteurer?«
»Weiß ich nicht.«
»Was hat Ihr Vater sonst noch über ihn gesagt?«
»Ich kann mich an nichts erinnern. Es hat mich ohnehin nie besonders interessiert. Villegas war einfach neu im Komitee. Die anderen Mitglieder gehörten alle zur Generation meines Vaters, Männer wie Calman, Acosta und Hermanos.«
»Und Segura Rojas?«
»Sie meinen Onkel Paco?«
»Onkel Paco?«
»So haben wir als Kinder zu ihm gesagt. Segura war eine Zeit lang oft bei uns zu Besuch. Weil er uns meistens teure Geschenke mitbrachte, wurde er für uns eine Art Onkel.«
»Villegas bezeichnet ihn als seinen Außenminister. Die beiden scheinen sich sehr nahezustehen. Wussten Sie das nicht?«
»Ich wusste, dass Segura in Mexiko war. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er sich in Cuernavaca ein Haus gekauft hat. Er war immer einer von diesen reichen Sozialisten. Seine Familie hatte Grundbesitz in Venezuela. Er muss inzwischen ziemlich alt sein.«
»Achtundsechzig, wenn Sie das alt nennen. In Ihrem Alter tut man das wohl. Aber für Sie ist er nach wie vor Onkel Paco?«
»Ich habe seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht. Erst jetzt, als Sie seinen Namen erwähnten.«
»Nun ja, Sie werden ihn wahrscheinlich bald sehen. Sie haben davon gesprochen, dass Villegas in Mexiko lebt. Das stimmt nicht mehr. Er ist seit zwei Monaten hier. Segura ist bei ihm.«
Ich starrte Kommissar Gillon ungläubig an, doch er räumte plötzlich seinen Schreibtisch auf und schob die Akte Villegas und mehrere andere Dossiers zu einem ordentlichen Stapel zusammen.
»Hier? Wieso das denn?«
Kommissar Gillon hörte mit dem Ordnen auf, verschränkte die Arme über der Brust und sah mich dann an.
»Er beantragte eine befristete Aufenthaltserlaubnis, um hier Urlaub zu machen und aus gesundheitlichen Gründen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Die Entscheidung fiel in Paris. Weshalb die Genehmigung erteilt wurde, ist nicht mein Bier und Ihres erst recht nicht. Ich empfehle Ihnen dringend, keine Spekulationen über die Sache anzustellen oder darüber zu diskutieren. Ich habe dafür zu sorgen, dass Monsieur Villegas, seine Familie und Begleitung, zu der auch Ihr Onkel Paco gehört, einen ruhigen Aufenthalt hier verbringen und so weit wie möglich von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden. Außerdem habe ich mich darum zu kümmern, dass alles für seine Gesundheit getan wird. Diese Aufgabe übertrage ich jetzt Ihnen, Herr Doktor. Sie werden Monsieur Villegas als medizinischer Betreuer zur Seite stehen, und ich sage Ihnen lieber gleich, dass Dr. Brissac seine Einwilligung gegeben hat.«
Ich sagte das Erste, was mir in den Sinn kam: »Und Monsieur Villegas? Ist er denn einverstanden?«
»Als er seine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, wurde ihm bedeutet, dass alle Maßnahmen im Zusammenhang mit seiner Sicherheit und Gesundheit hier in diesem Büro getroffen werden.«
»Aber seinen Arzt wird er sich doch aussuchen dürfen.«
»Gewiss. Auf Dr. Massot hat er bereits verzichtet.«
»Mit welcher Begründung?«
»Verständigungsschwierigkeiten. Sie haben selbst gesagt, dass Massots Spanisch zu wünschen übriglässt. Dasselbe gilt für Villegas’ Französisch. Ich nehme mal an, dass sich die beiden nicht sonderlich sympathisch waren.«
»Sie sagen, dass Villegas auch aus gesundheitlichen Gründen hierherkam. Hat er eine bestimmte Krankheit?«
»Laut Dr. Massot ist er ein Hypochonder und vielleicht auch ein heimlicher Trinker. Ich habe Dr. Massots Bericht hier, wenn Sie ihn sehen wollen.« Er griff nach der Akte Villegas.
»Ich glaube nicht, dass ich viel damit anfangen kann. Weiß Villegas denn von mir?«
»Natürlich. Sohn des alten Parteichefs, Examen und Approbation in Paris, ein geschätzter Arzt am hiesigen Krankenhaus, der direkten Zugang zu modernen diagnostischen Apparaten und kompetenten Fachkollegen hat und fließend Spanisch spricht – wir haben ihm alle Fakten gegeben, die er brauchte, um sich eine Meinung zu bilden.«
»Und er war mit mir einverstanden?«
»Er hat sofort und mit überaus herzlichen Worten eingewilligt. Ihre Ansichten über den Kreis Ihrer Mutter in Florida waren ihm übrigens bekannt. Er wird Sie wohl, genau wie ich, über Ihre politische Einstellung befragen. Nach allem, was Sie mir gesagt haben, dürfte es kaum Schwierigkeiten geben. Er könnte natürlich versuchen, Sie zu bekehren oder zu indoktrinieren und auf seine Seite zu ziehen, und sei es nur wegen Ihres Namens. Aber ich denke« – der Kommissar lächelte süß –, »dass Sie ihm genauso ausweichend oder mehrdeutig antworten werden wie mir.«
Ich reagierte nicht auf diese Provokation. »Das klingt ja, als sollte ich diesen Patienten regelmäßig besuchen. Gibt es konkrete medizinische Gründe dafür?«
»Von einer bestimmten Krankheit ist mir nichts bekannt. Ich möchte aber, dass Sie ihn mindestens zweimal die Woche besuchen und auf diese Weise ein Freund der Familie werden.« Er hielt kurz inne, um diese Worte wirken zu lassen. »Für diese Leistung erhalten Sie aus DST-Mitteln ein Honorar von monatlich fünfhundert Francs. Das ist der Betrag, den Dr. Massot bekam. Damit dürfte Ihr Aufwand an Zeit und Arbeit angemessen abgegolten sein – für Ihre Besuche in Les Muettes, so heißt die Villa, in der Villegas wohnt, und für Ihre Berichte an uns …«
»Berichte?«
Er machte eine abwehrende Handbewegung. »Bitte lassen Sie mich ausreden. Ihr Ärzte! Massot hat genauso reagiert. Ich sage doch gar nicht, dass Sie gegen Ihren Eid verstoßen sollen, gegen Ihr Berufsethos. Mir ist klar, dass Sie an Ihre ärztliche Schweigepflicht gebunden sind. Natürlich würde ich nicht von Ihnen verlangen, über den Zustand der Leber oder der Nieren Ihres Patienten zu berichten. Aber seine allgemeine Verfassung, auch die seiner Vertrauten, die Auswirkung, die bestimmte Besucher auf ihn haben – das sind generelle Dinge, über die Sie uns sehr wohl Ihre Eindrücke schildern könnten. Und wenn Sie von Personen angesprochen werden, die über die Bewohner von Les Muettes etwas erfahren wollen – das wird nämlich ganz bestimmt passieren, sobald sich herumgesprochen hat, dass Sie Villegas’ Arzt sind –, hoffe ich, dass Sie uns auch darüber informieren. Also: regelmäßige Berichte. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, unseren Gast zu beschützen. Und nicht nur vor Krankheiten, sondern vor allen möglichen Gefahren, tatsächlichen oder potenziellen, für sein Wohlergehen. Haben wir uns verstanden?«
»Ja.« Die Pille, obschon mit einer dicken Zuckerschicht ummantelt, schmeckte entschieden unangenehm. Aber es schien mir sinnlos, mit dem Hinweis, dass ich keine Lust hätte, für die DST als Spitzel zu fungieren, das Gespräch noch endlos fortzusetzen.
Gillon nickte beifällig. »Gut. Wir sind von Ihrer Einwilligung und Ihrer Kooperationsbereitschaft ausgegangen und haben mit Villegas vereinbart, dass Sie ihn morgen Vormittag um elf in seiner Villa besuchen. Hoffentlich haben Sie dadurch keine Scherereien, aber Dr. Brissac wird Ihnen gewiss helfen.«
»Alles klar.«
»Ihre Berichte können Sie telefonisch durchgeben, aber Sie müssen sie jede Woche schriftlich bestätigen.«
Ich stand auf, um zu gehen, doch er hob die Hand. »Noch ein Wort zur Villa Les Muettes. Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass sie aus Sicherheitsgründen – vielleicht wollte Villegas die Presse ablenken – nicht von ihm persönlich angemietet wurde. Segura hat das für ihn getan, Ihr Onkel Paco. Das heißt also, draußen auf dem Briefkasten am Tor steht sein Name. Außerdem werden Sie dort einen meiner Jungs vom Sicherheitsdienst vorfinden. Er hat seine Instruktionen. Sie zeigen ihm einfach Ihren Ausweis.«
»In Ordnung.«
Wieder stand ich auf. Diesmal kam ich bis zur Tür.
»Noch etwas, Herr Doktor. Eine kleine Information, die aber, wenn Sie rekapitulieren, was heute in diesem Zimmer besprochen wurde, Ihre Gedanken in Bezug auf ein heikles Thema beruhigen könnte.« Er hielt inne und fuhr dann langsam fort: »Kollegen aus einer anderen Abteilung haben verdeckte Ermittlungen über die Umstände des Mordanschlags auf Ihren Vater durchgeführt. Und zwar unmittelbar nach dem tragischen Ereignis. Eine Zusammenfassung des Berichts wurde uns kürzlich vom Quai d’Orsay übermittelt.« Er nahm ein Blatt und las daraus vor: »Unsere Ermittlungen ergaben keinerlei eindeutigen Beweis dafür, dass ein Mitglied der Demokratisch-Sozialistischen Partei an dem Anschlag auf Castillo beteiligt gewesen wäre. Es steht Ihnen frei, Dr. Castillo dies zur Kenntnis zu bringen.«
»Vielen Dank. Kein eindeutiger Beweis?«
»Richtig.«
»Heißt das, dass es uneindeutige Beweise gab?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich wollte Ihnen nur die Information geben, wie mir das ja gestattet wurde.«
Ich dankte ihm erneut.
Der Fernschreiber draußen im Vorzimmer war stumm, aber der junge Mann, der inzwischen die langen Papierschlangen auf dem Nebentisch durchging, stöhnte noch immer.
Es ist jetzt 4 Uhr. Muss ein bisschen schlafen. Die Informationen, die ich am Abend des 12. Mai von Elisabeth erhielt, und die Vorgespräche in Les Muettes am 13. Mai sind viel zu wichtig, als dass ich sie in meiner gegenwärtigen Verfassung niederschreiben sollte. Würde die wichtigen Dinge vergessen. Kann nur hoffen, dass ich morgen eine ruhige Nacht habe.