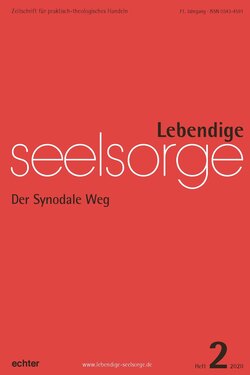Читать книгу Lebendige Seelsorge 2/2020 - Erich Garhammer - Страница 5
ОглавлениеUnterwegs – wohin?
Kirchenrechtliche Anmerkungen zum Synodalen Weg
Wer im Stichwortverzeichnis des kirchlichen Gesetzbuches, des Codex Iuris Canonici (CIC) oder in Kirchenrechtshandbüchern und -lexika den tautologischen Begriff „Synodaler Weg“ (übersetzbar etwa mit „der Weg des gemeinsamen Weges“) nachschlägt, der wird nicht fündig. Allenfalls finden sich Begriffe wie „Synode“, „Bischofssynode“, „Diözesansynode“ oder – für den Bereich einer Bischofskonferenz – „Plenarkonzil“. Markus Graulich SDB
Schon die Bezeichnung „Synodaler Weg“ verdeutlicht, dass niemand die Absicht hat, eine wirkliche Synode einzuberufen, sondern es sich beim derzeit in Deutschland stattfindenden Prozess um ein aliud, um etwas anderes handelt, als es das Recht der Kirche für synodale Prozesse vorsieht. Das kann legitim sein, denn Kirchenrecht erneuert sich; das kann aber auch auf Abwege führen, denn nicht immer ist der Weg das Ziel, vor allem dann nicht, wenn die Erwartungen hoch gesteckt sein sollten.
SYNODALITÄT IN DER KIRCHE
Um den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland aus kirchenrechtlicher Perspektive einordnen und im Hinblick auf seine Verbindlichkeit etwas sagen zu können, ist ein Blick auf das, was Synode und Synodalität in der Kirche eigentlich bedeuten, unerlässlich. Nur so kann deutlich werden, wohin die Reise geht – und wohin nicht.
Obwohl Synoden und synodale Strukturen seit jeher zur Kirche gehören und vor allem in den ersten Jahrhunderten ihr Leben entscheidend bestimmten, war bis zum Pontifikat von Papst Franziskus von ihnen in der Öffentlichkeit weniger die Rede. Papst Franziskus wird nicht müde, die Synodalität als konstitutives Element der Kirche zu unterstreichen und seinen Traum von einer synodalen Kirche vorzutragen.
Was genau meint er damit? „Eine synodale Kirche ist eine Kirche des Zuhörens, in dem Bewusstsein, dass das Zuhören ‚mehr ist als Hören‘. Es ist ein wechselseitiges Anhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat: das gläubige Volk, das Bischofskollegium, der Bischof von Rom – jeder im Hinhören auf die anderen und alle im Hinhören auf den Heiligen Geist, den ‚Geist der Wahrheit‘ (Joh 14,17), um zu erkennen, was er ‚den Kirchen sagt‘ (vgl. Offb 2,7)“ (Franziskus, Ansprache zur 50-Jahrfeier der Errichtung der Bischofssynode am 17. Oktober 2015).
Synodalität wird in der Kirche auf unterschiedlichen Ebenen gelebt: in der Teilkirche vor allem durch die Diözesansynode, aber in gewisser Weise auch durch die Räte auf der Ebene der Diözese und der Pfarreien; auf der regionalen Ebene durch die Partikularkonzilien und – wenn auch in einer Weise sui generis – durch die Bischofskonferenzen; und schließlich auf der Ebne der Universalkirche durch die Bischofssynode. Sie ist im Pontifikat von Papst Franziskus zu einer Art „Laboratorium der Synodalität“ und damit zum Vorbild für synodale Prozesse auf allen Ebenen geworden. Im Hinblick auf die Bischofssynode setzt Papst Franziskus einen Schwerpunkt auf die Vorbereitung. Er will dadurch sicherstellen, dass diese die Synode zu einem echten Prozess des Zuhörens werden lässt, welcher auf den verschiedenen Ebenen der Kirche durchgeführt wird. Es geht dabei um das Hören auf das Volk Gottes, auf den sensus fidei fidelium, dann um das Hören auf die Hirten und schließlich um das Hören auf den Papst, welcher die Ergebnisse der Synode zusammenfasst und sie dem Volk Gottes übergibt.
Markus Graulich SDB
Dr. iur. can. habil., Dipl.-Soz.päd. (FH), 1999-2014 Prof. für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts an der Università Pontificia Salesiana, Rom; seit 2014 Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte.
Letztlich geht es um die praktische Umsetzung des Axioms: quod omnis tangit ab omnibus tractari debet. Die Entscheidung aber liegt – wie im Anschluss an die Amazonassynode sehr deutlich geworden ist – beim Papst, der sich die Ergebnisse einer Synode zu Eigen machen kann, aber nicht muss.
So wird am Beispiel der Bischofssynode deutlich, was Synodalität in der Kirche nicht bedeutet: sie ist weder gleichzusetzen mit Demokratie, noch mit einem parlamentarischen System. Bei einer Audienz für die Bischöfe der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche am 2. September 2019 hat Papst Franziskus dafür sehr deutliche Worte gefunden: „Es besteht heute eine Gefahr: zu meinen, dass einen Synodalen Weg zu gehen oder eine Haltung der Synodalität zu haben bedeutet, eine Meinungsumfrage zu machen […] und dann ein Treffen abzuhalten und sich zu einigen. […] Nein, eine Synode ist kein Parlament. […] Synode bedeutet nicht, sich zu einigen, wie in der Politik: Ich gebe dir das, du gibst mir jenes. Nein, Synode bedeutet nicht, soziologische Befragungen durchzuführen, wie das mancher glauben mag: ‚Schauen wir mal, bitten wir eine Gruppe von Laien, dass sie eine Befragung durchführt, ob wir dies und jenes ändern sollen …‘ Sicher müsst ihr wissen, was eure Laien denken, aber es ist keine Befragung, es ist etwas Anderes“ (Osservatore Romano Deutsch, 6. September 2019, 3).
Synodalität unterscheidet sich von Demokratie, weil sie mit verschiedenen Grundkategorien des kirchlichen Lebens im Zusammenhang steht, ohne mit ihnen identisch zu sein.
COMMUNIO DES VOLKES GOTTES
Synodalität unterscheidet sich von Demokratie, weil sie mit verschiedenen Grundkategorien des kirchlichen Lebens im Zusammenhang steht, ohne mit ihnen identisch zu sein. Sie ist bezogen auf die communio des Volkes Gottes, auf den sensus fidei fidelium, auf die Mitverantwortung der Gläubigen an der Sendung der Kirche und ihrer gestuften Teilhabe an dieser Sendung, sowie mit der Kollegialität der Bischöfe. Keines dieser Elemente schöpft die Bedeutung der Synodalität aus.
Die ekklesiologischen Zusammenhänge, in denen die Synodalität steht, machen deutlich, dass alle Gläubigen, je nach ihrem Stand für die Sendung der Kirche Verantwortung tragen und zusammenarbeiten, wenn es darum geht, diese Sendung, „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott“ zu sein (LG 1), zu erfüllen. Daher ist es z. B. nicht möglich, Synodalität und Kollegialität gleichzusetzen, da sich dieser Begriff auf die kollegialen Akte der Bischöfe bezieht und nicht notwendig die Beteiligung der anderen Gläubigen mit einschließt. Synodalität ist mehr, denn sie impliziert die Beteiligung aller Glieder des Volkes Gottes auf den verschiedenen Ebenen. Nur in dieser weiteren Perspektive können Synodalität und ihre Ausdrucksformen in rechter Weise verstanden werden.
Es geht um die gemeinsame Verantwortung in der Kirche, in der alle Gläubigen, „gemäß der ihnen je eigenen Stellung zur Ausübung der Sendung berufen [sind], die Gott der Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat“ (can. 204 §1; vgl. can. 208 CIC). Damit wird die unterschiedliche Verantwortung der Gläubigen im Hinblick auf die Kirche beschrieben. Den Bischöfen kommt in der communio des Volkes Gottes eine andere Verantwortung und Vollmacht zu, als den Priestern und den Laien. Die gestufte Verantwortung spiegelt sich auch in den Normen wieder, die der CIC im Hinblick auf eine Synode auf Ebene eines Landes aufstellt. An einem sogenannten Plenarkonzil nehmen nur die Bischöfe mit entscheidendem (beschließendem) Stimmrecht teil, die Priester und Laien aber mit beratendem Stimmrecht (vgl. can. 443 CIC). Beratung und Entscheidung sind daher innerhalb einer Synode zu unterscheiden. Die Internationale Theologenkommission hat 2018 ein umfassendes Dokument zur Synodalität vorgelegt, das die Begriffe sehr gut klärt und Missverständnissen vorbeugen hilft. Es soll in diesem Kontext genügen, nur die Nr. 69 des Dokumentes anzuführen: „Es gibt keine Exteriorität oder Trennung zwischen der Gemeinschaft und ihren Hirten – die dazu berufen sind, im Namen des einen Hirten zu handeln – sondern die Unterscheidung von Aufgaben in der Wechselseitigkeit der Gemeinschaft. Eine Synode, eine Versammlung, ein Rat kann keine Entscheidungen treffen ohne die legitimen Hirten.“
Alle synodalen Prozesse werden in der communio des Volkes Gottes vollzogen, in der hierarchisch strukturierten Kirche. Dabei muss auf allen Ebenen der Kirche „zwischen dem Prozess der Erarbeitung einer Entscheidung (decision-making) durch gemeinsame Unterscheidung, Beratung und Zusammenarbeit und dem pastoralen Treffen einer Entscheidung (decision-taking) unterschieden werden, das der bischöflichen Autorität zusteht, dem Garanten der Apostolizität und der Katholizität. Die Erarbeitung ist eine synodale Aufgabe, die Entscheidung ist eine Verantwortung des Amtes. Eine sachbezogene Ausübung der Synodalität muss dazu beitragen, das Amt der persönlichen und kollegialen Ausübung der apostolischen Autorität besser zu strukturieren, und zwar mithilfe der synodalen Ausübung der Unterscheidung vonseiten der Gemeinschaft“.
DIE EIGENHEIT DES SYNODALEN WEGES
Wenn man sich vor diesem allgemeinkirchlichen Hintergrund die Satzung und die Geschäftsordnung des Synodalen Weges anschaut – ein anderer Blick ist dem seinem Fach verpflichteten Kirchenrechtler nicht möglich – werden sehr viele Unterschiede deutlich, die Fragen aufwerfen.
Vor allem bleibt von der nuancierten, theologisch und kirchenrechtlich stimmigen Sichtweise der Synodalität, wie sie die Theologenkommission zum Ausdruck bringt, in der Satzung und der Geschäftsordnung des Synodalen Weges wenig übrig. Im Gegenteil: Der Synodale Weg wird gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) verantwortet und veranstaltet. Beide Organe werden auf die gleiche Stufe gestellt, was ekklesiologisch zu einer Schieflage führt. Diese Gleichstellung kommt nicht nur in der Besetzung der Synodalversammlung zum Ausdruck, sondern vor allem darin, dass sich DBK und ZdK das Präsidium des Synodalen Weges teilen. Da diesem Synodenpräsidium im Hinblick auf die Durchführung und Gestaltung des Synodalen Weges erhebliche Vollmachten zukommen, ist das eine den Kirchenrechtler erstaunende Vorentscheidung.
In die gleiche Richtung der mangelnden Umsetzung des in der Kirche geltenden synodalen Prinzips weist auch eine andere Tatsache: Nach allgemeinem Kirchenrecht wäre es nicht nur Sache der Bischofskonferenz gewesen, ein Plenarkonzil als synodale Versammlung einzuberufen (vgl. can. 441, Nr. 1 CIC) (und nicht gemeinsam mit dem ZdK zum Synodalen Weg einzuladen), sondern auch seine Geschäftsordnung und die Beratungsgegenstände festzulegen (vgl. can. 441, Nr. 4). Die Geschäftsordnung wurde von der Synodenversammlung selbst verabschiedet, die Satzung gleichberechtigt von DBK und ZdK, die Beratungsgegenstände vermutlich auch.
Das führt zu einer weiteren Schwierigkeit: Als Aufgabe des Partikularkonzils gibt der CIC an: „Das Partikularkonzil bemüht sich für sein Gebiet darum, dass für die pastoralen Erfordernisse des Gottesvolkes Vorsorge getroffen wird; es besitzt Leitungsgewalt, vor allem Gesetzgebungsgewalt, so dass es, stets unter Vorbehalt des allgemeinen Rechts der Kirche, bestimmen kann, was zum Wachstum des Glaubens, zur Leitung des gemeinsamen pastoralen Wirkens, zur Ordnung der Sitten und zu Bewahrung, Einführung und Schutz der allgemeinen kirchlichen Disziplin angebracht scheint“ (can. 445 CIC).
Das Partikularkonzil hat also weitgehende Vollmachten, wenn das allgemeine Recht der Kirche und die kirchliche Disziplin beachtet werden. Die Themenfelder des Synodalen Weges hingegen betreffen in ihrer Mehrheit das allgemeine Recht der Kirche und ihre Disziplin. Über die Sexualmoral und die Zulassung zu kirchlichen Weiheämtern kann nicht in Deutschland allein entschieden werden. Gleiches gilt im Hinblick auf die priesterliche Lebensform und die Gewaltenteilung in der Kirche. Es heißt zwar im Art. 12 Abs. 2 der Satzung: „Beschlüsse, deren Themen einer gesamtkirchliche Regelung vorbehalten sind, werden dem Apostolischen Stuhl als Votum des Synodalen Weges übermittelt“ – aber wird sich das ZdK damit zufrieden geben? Welchen Sinn hätte dann ein Synodaler Weg?
Innerhalb der Synodenversammlung des Synodalen Weges gibt es keine Unterscheidung zwischen entscheidendem und beratendem Stimmrecht; allen kommt gleiches Stimmrecht zu (vgl. Satzung des Synodalen Weges, Art. 3 Abs. 2). Das allgemeine Recht der Kirche sieht aber für Synoden eine Unterscheidung zwischen dem beschließenden Stimmrecht der Bischöfe und dem beratenden Stimmrecht der anderen Teilnehmer vor. Diese Unterscheidung darf – so die Theologenkommission in ihrem Dokument (Nr. 68) – nicht mit den Kategorien des weltlichen Rechts gemessen werden. Ein beratendes Stimmrecht ist nicht zu unterschätzen, sondern in der communio des Volkes Gottes als Ausdruck der gestuften (Mit-)Verantwortung zu verstehen.
Darauf hatte schon Papst Johannes Paul II. im Hinblick auf die Bischofssynode hingewiesen, seine Worte sind auf alle synodalen Prozesse übertragbar: „In der Kirche ist […] der Zweck eines jeden Kollegialorgans, sei es beratend oder beschließend, immer auf die Wahrheit oder auf das Wohl der Kirche ausgerichtet. Wenn es sich dann um die Feststellung des gemeinsamen Glaubens handelt, wird der consensus Ecclesiae nicht durch die Auszählung der Stimmen gewonnen, sondern ist Frucht des Wirkens des Geistes, der die Seele der einzigen Kirche Christi ist“ (Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores gregis, Nr. 58).
Art. 11 Abs. 2 der Statuten des Synodalen Weges bringt diese Sichtweise nicht deutlich zum Ausdruck, sondern scheint eher ein demokratisches Verständnis von Synodalität im Blick zu haben. Dort heißt es, dass die Beschlüsse der Synodalversammlung eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder erfordern, „die eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz enthält“. Wie sich das konkret gestaltet und welchen Einfluss die auf der ersten Synodenversammlung diskutierte Möglichkeit haben wird, auch eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Frauen zu fordern, wird sich zeigen.
Für einen Kirchenrechtler verwunderlich ist zudem Abs. 5 des Artikels 11: „Beschlüsse der Synodenversammlung entfalten aus sich keine Rechtswirkung. Die Vollmacht der Bischofskonferenz und der einzelnen Diözesanbischöfe, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit Rechtsnormen zu erlassen und ihr Lehramt auszuüben, bleibt durch die Beschlüsse unberührt.“
Es sei einmal dahingestellt, dass die Bischofskonferenz nur eine geringe Lehrautorität und Gesetzgebungskompetenz hat. Im Hinblick auf die Freiheit der Diözesanbischöfe bei der Umsetzung der Beschlüsse stellt sich aber die Frage, wieweit diese Freiheit wirklich gewährleistet ist, zumal Art. 13 der Statuten drei Jahre nach Abschluss des Synodalen Weges eine „Evaluation der Umsetzung der Ergebnisse“ vorsieht. Dient diese Evaluation dazu, Druck aufzubauen? Und wie wird sie sich auf die Beschlüsse auswirken, die – mangels Zuständigkeit der Kirche in Deutschland – als Voten an den Heiligen Stuhl geschickt werden?
Darüber hinaus ist aus kirchenrechtlicher Sicht grundsätzlich zu fragen, was es bedeutet, eine Versammlung von mehr als zweihundert Mitgliedern einzuladen, nach einem Prozess von zwei Jahren Beschlüsse ohne Rechtsverbindlichkeit zu fassen.
Diese und viele andere Fragen bleiben offen. Die Entscheidung, beim Synodalen Weg in Deutschland ein neues Modell der Synodalität ins Leben zu rufen, und nicht auf die im Kirchenrecht verdichtete Erfahrung der Kirche zu rekurrieren, bleibt ein Wagnis mit offenem Ausgang. Die unsichere Rechtslage und die Weite der zu behandelnden Themen lassen befürchten, dass der Synodale Weg nicht zu einer Erneuerung des Glaubenslebens führt, sondern in die Enttäuschung.