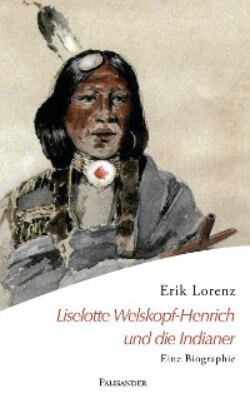Читать книгу Liselotte Welskopf-Henrich und die Indianer - Erik Lorenz - Страница 8
I – Eine vielseitige Frau Wissenschaftlerin, Autorin, Mutter
ОглавлениеÄußerlich war sie ganz schlicht –
man hätte nie gedacht, dass sie eine so große Wissenschaftlerin und Autorin war.
Detlef Rößler2
2 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und persönlicher Assistent Welskopf-Henrichs; Zitat aus einem Gespräch mit dem Autor.
Es ist einer der vielen sonnigen Tage im Sommer des Jahres 2010, als der Autor dieser Zeilen mit der Straßenbahn durch die Hauptstadt fährt und dabei Zeuge eines Gesprächs zweier etwa zehnjähriger Jungen wird. Sie tragen Flipflops, Sonnenbrillen, bunte Bermudashorts und luftige Shirts; nichts unterscheidet sie von anderen Kindern ihres Alters. Um so überraschender ist ihr Gesprächsthema. Der eine, ein Blondschopf, berichtet seinem Freund begeistert von einer sechsteiligen Bücherserie, die ihm sein Vater vor einigen Tagen geschenkt habe: »Die Söhne der Großen Bärin« von Liselotte Welskopf-Henrich. »So ein alter, vergilbter Schinken aus der DDR«, sagt der Junge, »aber echt genial geschrieben!« Das Interesse des Freundes ist verhalten, er spielt lieber an seinem iPod herum, aber der junge Bücherfreund bleibt in seinem Enthusiasmus unbeirrt und erzählt von den Abenteuern, die der Dakotajunge Harka im ersten Teil zu bestehen hat. Die gemeinsame Leidenschaft der beiden ist das Skateboarden, wie sich etwas später herausstellt, doch im Augenblick begeistert sich der Blondschopf einzig und allein für den jungen Indianer und seine tollkühnen Taten: »Er ist sehr sportlich, aber auch klug«, stellt er fest. »Also wie ich«, entgegnet der andere, spannt die Muskeln, setzt einen in die Ferne gerichteten Denkerblick auf und freut sich.
Als hundert Jahre zuvor Liselotte Welskopf-Henrich um die zehn Jahre alt war, war die Welt noch eine andere. Eine jahrzehntelange Phase relativen Friedens hatte zu einem beispiellosen Aufschwung der Wirtschaft geführt. Wissenschaftliche Erkenntnisse wie Plancks Quantentheorie, Einsteins Relativitätstheorie oder auch Freuds Psychoanalyse ließen traditionelle Weltbilder einstürzen. Kunst und Literatur standen im Zeichen der Moderne. In Indien wurden zum ersten Mal Briefe mit einem Postflugzeug transportiert. Die Titanic stand kurz vor ihrem Stapellauf. Amundsen und Scott bereiteten ihre Südpolexpeditionen vor. Bald schon würden die letzten »weißen Flecken« von den Landkarten geschwunden sein. Doch trotz allen Fortschritts wuchsen die politischen Spannungen in Europa, die sich im Ersten Weltkrieg entladen sollten, nach dem nichts mehr so sein würde wie zuvor.
Ähnlich, wie der Blondschopf sich heute für Welskopf-Henrichs Werk begeistert, hatte diese einhundert Jahre zuvor gerade die Bücher von James Fenimore Cooper für sich entdeckt. Durch Berlin, die spätere Heimat Welskopf-Henrichs, fuhr auch damals schon die elektrische Straßenbahn. Doch ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie nicht in der Hauptstadt, sondern in München, wo sie am 15. September 1901 als Elisabeth Charlotte Henrich geboren wurde.
In ihrer frühen Kindheit spielte Liselotte, wie sie allgemein genannt wurde, oft unter Aufsicht ihres Kindermädchens im botanischen Garten. Am Nachmittag, in der Zeit, die sie mit ihrer Mutter Marie verbrachte, musste sie vor allem artig sein. Sie sprang die Stufen zum Hofgarten-Café im heimatlichen Stadtteil hinauf und hinunter, und im Herbst sammelte sie Kastanien. Gelegenheiten, Freundschaften zu schließen, boten sich kaum. Das änderte sich, als die Familie 1907 nach Stuttgart zog: Im Haus wohnte ein gleichaltriges Mädchen, das Liselotte in ihre große Spielhorde einführte. Jeden Nachmittag nach den Schularbeiten kamen die Kinder zusammen und genossen völlige Freiheit. In den Unterrichtspausen am Vormittag spielten sie »Räuber und Gendarm«. Einmal verteidigte Räuberin Liselotte sich auf einer Treppe so energisch gegen acht »Gendarmen«, dass der Schulleiter kommen musste, um sie von dem Geländer loszureißen, an dem sie sich festhielt.
Manchmal fanden die Kinder sich auch zu einer Erzählgruppe zusammen. Dann war Liselotte gefragt.
1913 musste sie sich von ihren Freundinnen trennen: Die Familie übersiedelte nach Berlin, eine Stadt, die Liselotte grässlich fand. Auf eigenen Wunsch besuchte sie ein humanistisches Gymnasium, wo sie Griechisch und Latein lernte.
Im Klassenverband musste sie sich erst durchsetzen. In den Unterrichtsstunden fiel ihr das aufgrund der hohen Ansprüche der Stuttgarter Schule leicht, dennoch fühlte sie sich als Fremdling. Der Direktor hatte sie schon von vornherein eine Klasse zurückversetzen wollen; um ihn von diesem Gedanken abzubringen, strengte Liselotte sich besonders an und war schnell die Klassenbeste. In ihrer Abwesenheit ermunterte die Klassenlehrerin dann die Klasse, sich doch von der Süddeutschen nicht übertreffen zu lassen.
Bald kam ein Mädchen in die Klasse, das in einem englischen Internat erzogen worden war. Zwischen Liselotte und diesem Mädchen entwickelte sich eine enge Freundschaft, die viele Jahre halten sollte. Oft verbrachten sie ihre Nachmittage gemeinsam, gingen spazieren, besprachen ihre persönlichen Probleme, aber auch die des Theaters, und beeinflussten sich in ihrer Entwicklung gegenseitig. Diese und andere Freundschaften trugen dazu bei, dass Liselotte in Berlin nicht unglücklich wurde, wie sie es zunächst befürchtet hatte.
1921 schloss sie erfolgreich ihr Abitur ab. An der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, der späteren Humboldt-Universität, studierte sie Ökonomie, Geschichte und Philosophie – Wissenschaftsgebiete, die später ihre Forschungen in der Alten Geschichte grundsätzlich bestimmen sollten.
1925 promovierte sie an der Humboldt-Universität mit dem Hauptfach Ökonomie zum Dr. phil. Ihr Vorhaben, ihre wissenschaftliche Karriere noch in den 1920er Jahren fortzusetzen, konnte sie nicht verwirklichen. Der Vater, Dr. Rudolf Henrich, ein Versicherungsdirektor, war 1923 zwangspensioniert worden, weil er sich mit dem Gerling-Konzern angelegt hatte. Zuvor war er Rechtsanwalt in München gewesen, doch nachdem der demokratisch gesinnte Mann mit der katholischen Kirche gebrochen hatte, war er beruflich nicht mehr vorangekommen. So hatte Liselotte schon früh so manches über die Spielregeln der bürgerlichen Gesellschaft gelernt. 1926 starb der Vater. Sein Vermögen, das er vererbt hatte, schwand in der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise rasch dahin. Nach ihrer Promotion arbeitete Liselotte daher einige Zeit in einem Warenhaus und in der sozialen Frauenschule. Sie musste nun für sich selbst und ihre Mutter aufkommen. Wirtschaftliche Beweggründe hatten sie auch veranlasst, das für damalige Akademiker beruflich aussichtsreichste Gebiet Ökonomie als Hauptfach zu wählen und ihre eigentlichen Leidenschaften Geschichte und Philosophie nur als Nebenfächer zu belegen.
1906, Welskopf-Henrich (rechts) und eine Münchener Freundin
1925
1940
1946, Hochzeit
Nach einer Reihe kleinerer Jobs wurde sie 1928 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Statistischen Reichsamt in Berlin angestellt, wo sie unter anderem volkswirtschaftliche Bilanzen bearbeitete und bis zur Referentin aufstieg. Dank günstiger Arbeitszeiten konnte sie in dieser Phase viele Bücher über Völkerkunde lesen. Das bereits bestehende Interesse an den Indianern verfestigte sich. Außerdem setzte sie auf eigene Faust ihre historischen und philosophischen Studien fort. Da sie der nationalsozialistischen Ideologie höchst ablehnend gegenüberstand und sich weigerte, NSDAP-Mitglied zu werden, konnte sie die angestrebte Karriere an der Universität auch in den 1930er Jahren nicht beginnen. Als 1933 eine akademische Stelle frei wurde, lehnte sie sie aus diesem Grund ab. Von ihrer ehemals besten Freundin aus dem englischen Internat entfernte sie sich zunehmend, da ihre Gedanken und Gefühle hinsichtlich der Nationalsozialisten sehr verschiedenen voneinander waren.
Ein Jahr nach Kriegsende heiratete sie August Rudolf Welskopf (1902-1979), zwei Jahre später wurde der Sohn Rudolf geboren. Welskopf-Henrich übernahm hohe Positionen in der Berliner Bezirksverwaltung, arbeitete als persönliche Sekretärin des Bezirksbürgermeisters von Charlottenburg und wurde 1946 Hauptreferentin im Bezirksamt Charlottenburg. Im gleichen Jahr trat sie in die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und bald danach in die SED ein. Ebenfalls 1946 zog sie in den sowjetischen Sektor der Stadt, dahin, wo sie und ihr Mann glaubten, am dringendsten gebraucht zu werden.3 Sie nutzte ihre ökonomischen Kenntnisse und wirkte aktiv am Wiederaufbau mit, etwa als Handlungsbevollmächtigte der Baustoff-Beschaffungs-GmbH und als Geschäftsführerin der Baustoff-Ost-GmbH, in der auch ihr Mann arbeitete.
3 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Nachlass Liselotte Welskopf-Henrich, Nr. 189, fortan ABBAW.
1949 sah Welskopf-Henrich endlich den Zeitpunkt gekommen, an die Universität zurückzukehren und ihre wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen: Sie bewarb sich um eine Ausbildung zur Dozentin für Geschichte des Altertums und Geschichtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dabei behauptete sie, sich schon seit langem mit Marx auseinandergesetzt zu haben; tatsächlich war sie jedoch erst im Zweiten Weltkrieg durch ihren späteren Mann mit den kommunistischen Ideen in Berührung gekommen.
Die Bewerbung war erfolgreich. Zunächst als Aspirantin an der Humboldt-Universität im Fach Alte Geschichte angestellt, wurde sie 1952 mit einer Dozentur beauftragt und nach Vollendung ihrer Habilitation 1960 zur Dozentin ernannt.
1964
Bereits seit 1952 hatte sie vor Philosophiestudenten Vorlesungen über die Geschichte des Altertums gehalten, nachdem sie ihre eigenen historischen und altsprachlichen Kenntnisse aufgefrischt hatte. »Auch Fernstudenten betreute sie, und so mancher hielt noch lange Jahre den Kontakt zu ihr, beeindruckt von der Humanität, die ihre Persönlichkeit kennzeichnete.«4 1959 habilitierte sie mit der Arbeit »Probleme der Muße im alten Hellas«, ein Jahr später wurde sie zur Professorin für Alte Geschichte mit Lehrauftrag berufen.
4 Audring, Gert: Humanistin und Forscherin: Elisabeth Charlotte Welskopf. Das Altertum, Bd. 33, Heft 2 1987, S. 122.
Am 1. Januar 1961 ernannte man sie zur Leiterin der Abteilung Altertum des Instituts für Allgemeine Geschichte an der Philosophischen Fakultät, die sie schon seit Mai 1958 kommissarisch leitete, und sie wurde zum (ersten weiblichen) ordentlichen Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt. Sie erhielt den Nationalpreis der DDR, wurde als »Verdienter Wissenschaftler des Volkes« ausgezeichnet und erhielt zahlreiche weitere staatliche und gesellschaftliche Auszeichnungen.
Am 16. Juni 1979 verstarb Liselotte Welskopf-Henrich, Autorin, Wissenschaftlerin und international engagierte Menschenrechtskämpferin nur fünf Monate nach ihrem Mann, während eines Urlaubs in Garmisch-Partenkirchen.5
5 Vgl. ABBAW 1 (Lebensläufe) und 190 (Brief vom 11.12.1975). Weitere Informationen von Isolde Stark.
* * *
Bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr der Jugendliteratur von Autoren wie Karl May und vor allem Cooper zugetan, wandte sich Welskopf-Henrich später Werken wie Schillers philosophischen und historischen Schriften sowie Lessings Schriften zu Kunst und Dramatik zu. Shakespeares Tragödien sah sie im Reinhardt-Theater in Berlin. In den folgenden Jahren galt ihre Aufmerksamkeit zunehmend der russischen Literatur, der deutschen kritischen Literatur der frühen zwanziger Jahre und französischen, englischen und norwegischen Schriftstellern. Auch für das Gebiet der historischen Wissenschaft begeisterte Welskopf-Henrich sich bald – so studierte sie mit 14 Jahren Thukydides, einen der bedeutendsten Historiker der Antike. Überhaupt interessierte sie sich schon frühzeitig für Bücher über das frühe Griechenland und die griechische Mythologie und beschloss bereits in diesen jungen Jahren, Altertumswissenschaftlerin zu werden.
Ihren Beruf als Althistorikerin übte Welskopf-Henrich mit Leidenschaft, Ehrgeiz und wissenschaftlicher Neugier aus. Zahlreiche Verdienste für die Abteilung Altertum an der Humboldt-Universität, die durch Welskopf-Henrich bedeutend an Ansehen gewann, sind ihr zuzuschreiben. Bis zum Schluss gab es in ihrem Leben nach dem Zweiten Weltkrieg kaum einen Zeitraum, in dem sie nicht an einer wissenschaftlichen Groß-Produktion arbeitete. Diese Projekte, die sie unter dem Namen Elisabeth Charlotte Welskopf herausgab, hatten internationalen Charakter: Die »Hellenische Poleis«6 etwa wurde unter der Leitung Welskopf-Henrichs von einem Autorenkreis aus aller Welt geschaffen. Wissenschaftler von Universitäten und staatlichen Museen der DDR, sowjetische und polnische Gelehrte, Fachkollegen aus Bulgarien, Rumänien, der Tschechoslowakei, Ungarn, Italien, Frankreich, der BRD, Belgien, England, der Schweiz, Portugal, Russland, Spanien, verschiedenen asiatischen Ländern und den USA – insgesamt über sechzig Wissenschaftler – arbeiteten an diesem Projekt; bei dem Nachfolgeprojekt »Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt« waren es sogar noch mehr. Begriffe wie Politik, Barbar, Demokratie und Aristokratie, die von den Griechen geprägt und von der Nachwelt übernommen worden waren, sollten gesammelt und analysiert werden, um aus den Veränderungen des Sprachgebrauchs Ableitungen über die sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse vornehmen zu können. Mit den abschließenden Veröffentlichungen zu diesen Projekten gelang es ihr, als Wissenschaftlerin internationales Ansehen zu erlangen, nachdem bei ihren vorangegangenen Beförderungen zur Professorin mit Lehrauftrag und zur Leiterin der Abteilung Altertum ihre politische und ideologische Zuverlässigkeit und ihre Anerkennung als Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus wahrscheinlich noch eine wichtigere Rolle gespielt hatten als ihre Forschungsleistungen. Schließlich war ihre wissenschaftliche Laufbahn viele Jahre unterbrochen gewesen.
6 Inhalt: Politik, Wirtschaft, Sport, Mode, Technik, Kunst etc. in den griechischen Stadtstaaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. u. Z.; das vierbändige Werk ist noch heute in fast allen altertumswissenschaftlichen Bibliotheken der Welt zu finden.
Um das enorme Arbeitspensum der großen Projekte zu bewältigen, beschäftigte Welskopf-Henrich eine Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenten, die sie privat bezahlte. Diese Mitarbeiter waren Studierende und Studierte, die aus zahlreichen antiken Schriftquellen die entscheidenden Stellen heraussuchten und bei organisatorischen Fragen behilflich waren. Anfangs beschäftigte sie einen Mitarbeiter, später waren es drei oder vier, zwischenzeitlich sogar bis zu acht.
Ein solcher Student war Gert Audring. Ihm gefiel das Pädagogikstudium in Potsdam nicht, weil ihm die Ausbildung zu oberflächlich war. In seinem Verdruss wandte er sich an einen älteren Studenten, und dieser riet ihm: »Wenn du Probleme hast, dann musst du mal mit der Welskopf reden.« Welskopf-Henrich lud ihn bald darauf ein, ließ sich seine Zeugnisnoten zeigen und überzeugte sich von seinem Wissen, seiner Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, auf die sie sehr großen Wert legte. Da sie mit dem jungen Mann zufrieden war, ermöglichte sie ihm, seinem Herzenswunsch entsprechend, den Hochschulwechsel nach Berlin; allerdings knüpfte sie daran einige Bedingungen. Ursprünglich wollte Audring nur Geschichte studieren und war auch bereit, den Marxismus zu akzeptieren; für Welskopf-Henrich als überzeugte Marxistin von grundlegender Wichtigkeit. Sie verlangte aber zusätzlich von ihm, dass er Latein studiere, was ihm zunächst völlig fern lag, wogegen er gar eine Abneigung hegte. Von dieser Forderung ließ sich Welskopf-Henrich jedoch keinen Deut abbringen, denn sie wusste: Wenn man in die Alte Geschichte eindringen wollte, musste man sein Handwerk beherrschen. Also hat Audring Latein studiert und abends noch Griechisch gelernt, weil er sonst die Quellen nicht hätte lesen können; er wäre sonst nur einer von vielen gewesen, die auf die Darstellungen anderer angewiesen waren und lediglich den Marxismus hinzufügten. Und das war für Welskopf-Henrich nicht akzeptabel. Sie wollte gründliche, marxistische Forschung auf der Grundlage von exakten Sprachkenntnissen. Diese Vorstellung setzte sie konsequent durch. Mit allen Mitteln versuchte sie zu verhindern, dass der Wissenschaftszweig Alte Geschichte, wie vorgesehen, in der DDR abgeschafft würde und dass dann nur noch die entsprechenden russischen Bücher übersetzt würden. Welskopf-Henrich wollte eine eigenständige Alte Geschichte in der DDR, neu begründet auf marxistischer Basis, und in diesem Sinne hat sie publiziert.
Um die marxistische Geschichtsforschung in der DDR zu etablieren, förderte Welskopf-Henrich besonders junge Menschen, von denen sie annahm, dass sie sich engagierten, Marx gründlich lasen und zur Weiterentwicklung beitragen würden. So holte sie Audring nach Berlin, wo er wie gewünscht studieren, sein Staatsexamen machen und in die Wissenschaft gehen konnte. Auch in ihre eigenen Forschungsprojekte bezog Welskopf-Henrich ihn mit ein.
Audring: »Für mich bleibt sie nach wie vor diejenige Frau, die mir ermöglicht hat, mir meinen Berufswunsch zu erfüllen. Das werde ich ihr nie vergessen.«
Welskopf-Henrich war eine mutige Frau, auch in Bezug auf ihre wissenschaftlichen Bücher. Sie hat sich vom Stalinismus distanziert, wo der Sklave lediglich als antiker Proletarier angesehen wurde. Dabei hat sie auch moderne Auffassungen in die Alte Geschichte hineingetragen. Das war der Schwung des Marxismus: Alles strebte vorwärts, auch in der Antike, was zu dem gewagten Vergleich »Spartakus war der Liebknecht der Antike« führte, wie er zu jener Zeit gern gebraucht wurde.
Trotzdem hat sie sich von der sowjetischen Forschung abgegrenzt, weswegen einige ihrer Veröffentlichungen in der DDR wenig beachtet wurden.
Eine weitere private wissenschaftliche Mitarbeiterin war Brigitte Johanna Schulz. Sie berichtete 2002 auf einer Konferenz in Halle: »Bei der Auswahl der Mitarbeiter fragte Frau Welskopf nicht nach dem ‚Klassenstandpunkt’;7wichtig war allein, was man konnte und für das Vorankommen des Projektes tat.«
7 Stark, Isolde (Hrsg.): Elisabeth Charlotte Welskopf und die Alte Geschichte in der DDR – Beiträge der Konferenz vom 21. bis 23. November 2002 in Halle/Saale, S. 293.
Über das Zustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses gab Schulz ebenfalls Auskunft:
Nun ging alles sehr schnell. Mein Arbeitsvertrag begann am 1. Januar 1974, aber bereits im Herbst 1973 hatte sie [Welskopf-Henrich] alles in die Wege geleitet, um mich einerseits der zentralen Absolventenlenkung zu entreißen und andererseits in die Doktorandenausbildung [Schulung in Marxismus-Leninismus und Sprachkurse] der Akademie der Wissenschaften einzuschleusen, die eigentlich nur für die Doktoranden der Akademie bestimmt war. Sicher waren etliche Telefonate und Korrespondenzen dafür nötig, aber ich bekam nur die prompten Resultate mit: »Ja, Sie können bei mir anfangen.«8, 9
8 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 292.
9 Welskopf-Henrichs Sohn Rudolf Welskopf erinnerte sich gleichfalls auf der Konferenz: »Bei aller Phantasie, über die sie verfügte – sie stand mit beiden Beinen fest in der Wirklichkeit. Das heißt auch, dass sie auf der Klaviatur der Bürokratie spielen konnte. Was sie in und an der DDR für zumindest mittelfristig unabänderlich hielt, dem unterwarf sie sich nicht einfach, sondern versuchte, es auszunutzen für ihre wissenschaftlichen Projekte.« In: Stark, Isolde: Konferenzband S. 308.
Mit ihrer Vermutung hinsichtlich der Korrespondenzen lag Schulz vollkommen richtig. Welskopf-Henrich schrieb an die Kaderleitung der Akademie, sie schrieb an die Universität, sie schrieb an das Finanzamt usw. In ihren Briefen wies sie wirkungsvoll auf die internationale Zusammensetzung des Projektes der »Sozialen Typenbegriffe« und dessen Bedeutung für das Politbüro der SED hin. In der Tat verstand es Welskopf-Henrich, sich Gehör zu verschaffen. Hierzu Isolde Stark: »Man war bei Frau Welskopf gewöhnt: Es geht alles schnell, zügig und immer mit gutem Ausgang.«10
10 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 294.
Für ihre Schreiben verwendete Welskopf-Henrich einen Kopfbogen, auf dem sämtliche ihrer Titel, Ämter, Würden und Orden verzeichnet waren. Darauf hinzuweisen, war ihr sehr wichtig. Schon Tage vor ihrer Berufung zur Professorin ließ sie Briefumschläge drucken, auf denen »Prof. Dr. Welskopf« stand. In dieser Hinsicht war sie sehr ehrgeizig und auch etwas eitel. (Immerhin musste sie sich ihre Titel hart erkämpfen.)
Und sie ließ sich von niemandem beirren. Zum Beispiel beschäftigte sie bei ihren Projekten Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften (AdW), die in Projekte der AdW eingebunden waren und dafür ihr Gehalt bekamen. Der Ur- und Frühhistoriker Joachim Herrmann (1932-2010), Direktor des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA), versuchte den Mitarbeitern seines Instituts sogar die Beteiligung am Großprojekt »Soziale Typenbegriffe im Alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt« zu verbieten. Schon das Vorgängerprojekt »Hellenische Poleis«, das er als Konkurrenzprojekt zu den Forschungen seines eigenen Instituts betrachtete, hatte er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln sabotiert: Während Welskopf-Henrich nach Vollendung des Manuskripts im Urlaub in Österreich war, ließ er kurzerhand den Druck im Akademie-Verlag stoppen. Um die Druckgenehmigung hinauszuzögern, forderte er ein überflüssiges Gutachten an, für das der Gutachter erst einmal die 3200 Seiten Text durcharbeiten musste. Er schreckte nicht davor zurück, Intrigen zu spinnen, zu denunzieren und zu lügen, »um das innerhalb von nur drei Jahren von 60 in- und ausländischen Wissenschaftlern geschaffene Gemeinschaftswerk – eine wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Leistung, von der er selbst nicht mal träumen konnte – zu Fall zu bringen«.11
11 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 245.
Welskopf-Henrich wehrte sich: Sie schrieb an den Leiter des Forschungsbereiches Gesellschaftswissenschaften und an den ersten Sekretär der SED-Kreisleitung, der dem Präsidium der AdW angehörte und die höchste Partei-Instanz an der Akademie verkörperte, und sie machte deutlich, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar seien. Sie habe nicht Tag und Nacht gearbeitet, um die internationale Gemeinschaftsarbeit zu koordinieren und innerhalb von drei Jahren zur Fertigstellung zu bringen, damit das Manuskript nun auf unabsehbare Zeit in einer Schublade verschwinde. Sie kontaktierte den Direktor des Akademie-Verlags, forderte selbst Gutachten an, setzte Briefe auf, telefonierte, bestand auf persönliche Gespräche, drängte und trieb an. »Die Angelegenheit duldet keinen Aufschub mehr«.12
12 Welskopf-Henrich an Kalweit, Brief vom 31.7.1972. Siehe auch Stark, Isolde: Konferenzband, S. 246.
Da kam ihr die Bitte der Zeitung »Neues Deutschland«, einen kleinen Text für die Rubrik »Woran arbeiten Sie?« zu verfassen, gerade recht: Mit enthusiastischen Worten kündigte sie die Veröffentlichung der vier Poleis-Bände innerhalb der nächsten Monate an und setzte so den Akademie-Verlag unter Druck. Trotzdem blieben Widerstände bestehen. Stellungnahmen wurden ausgetauscht, Besprechungen fanden statt; es war ein zermürbendes Hin und Her. Monate verstrichen, und Hermann praktizierte weiter seine Hinhaltetaktik. Das Gutachten, das er angefordert hatte, ließ weiter auf sich warten. Als Welskopf-Henrich nachhakte, behauptete Hermann wider besseren Wissens, der Gutachter sei viel beschäftigt gewesen und nun erst seit einem Monat mit der Angelegenheit befasst, doch Welskopf-Henrich kannte die Wahrheit und korrigierte den Institutsdirektor sofort. Später lag das Gutachten Hermann zufolge endlich handschriftlich vor, doch es ließe sich angeblich beim besten Willen keine Sekretärin abstellen, um es abzutippen. Als das Gutachten auch noch verhalten-kritisch ausfiel, drohte das Projekt endgültig auf Eis gelegt zu werden. Dann nahte der 7. Oktober, und im Rahmen der Feierlichkeiten zum 33. Geburtstag der DDR erhielt Welskopf-Henrich den Nationalpreis. Den Empfang beim Staatsrat nutzte sie, um einflussreiche Unterstützer zu gewinnen. Endlich wurde das Werk gedruckt.
Nach dieser Niederlage versuchte Hermann nun also, seinen Mitarbeitern zumindest die Arbeit an Welskopf-Henrichs nächstem Projekt, »Soziale Typenbegriffe«, zu verbieten. »Die betroffenen Kollegen beriefen sich daraufhin auf die Freiheit, in ihrer Freizeit machen zu können, was sie wollten, und erklärten somit ihre Arbeit an den ,Typenbegriffen‘ zum Hobby.«13
13 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 250.
Welskopf-Henrich suchte sich immer genau die Leute aus, die sie für ihre eigenen Arbeiten brauchte oder haben wollte. So auch Gert Audring, der im Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie arbeitete. Ob sich Welskopf-Henrich damit den Unwillen des Institutsdirektors Hermanns zuzog, kümmerte sie nicht weiter. Hermanns Macht war ohnehin eingeschränkter als bisher: Die »Sozialen Typenbegriffe« unterlagen nicht mehr der Planung des ZIAGA. Welskopf-Henrich kam für das Projekt in noch bedeutenderem Maße als zuvor selbst auf und sicherte sich so eine größere Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit, die es ihr auch erlaubte, private Mitarbeiter einzustellen, wurde Welskopf-Henrich vor allem durch ihre solide finanzielle Situation ermöglicht, die auf ihren belletristischen Erfolgen beruhte. Das Geld, das sie durch ihre Bücher und den Film »Die Söhne der Großen Bärin« verdiente, gab sie nahezu komplett für ihre wissenschaftlichen Projekte aus. Da die Projekte somit nicht von den Genehmigungsprozeduren der bürokratischen staatlichen Wissenschaftsorganisation abhingen, brauchte Welskopf-Henrich keine Reglementierungen zu fürchten.
Die Wissenschaftler, die für sie arbeiteten, schätzten sie sehr, so dass sie sich stets mit Freuden an ihren Projekten beteiligten. Sie wussten, dass da jemand die Fäden in der Hand hielt, der selbst fleißig arbeitete und den Überblick besaß. Und Liselotte Welskopf-Henrich hat in der Tat unglaublich viel gearbeitet; in Phasen extremer Belastung aß sie Kaffeepulver, um sich wachzuhalten.
Auch Detlef Rößler war einer ihrer Mitarbeiter und über lange Zeit Welskopf-Henrichs Assistent. In regelmäßigen wissenschaftlichen Beratungen und intensivem, auch politischem, Gedankenaustausch lernte er sie gut kennen. In einem Gespräch mit dem Autor beschrieb er Welskopf-Henrich als kleinere, etwas korpulente, freundlich-zurückhaltende, ein wenig mütterlich und einfach wirkende Frau mit einem gütigen Gesicht, die sich gern an der Natur erfreute. Doch in den zahlreichen Diskussionen mit ihr sei ihm die wahre Größe dieser Frau wieder und wieder bewusst geworden.
Liselotte Welskopf-Henrich erlaubte sich auch ein wenig Luxus: So fuhr sie prinzipiell Taxi; auch wenn es nur kurze Strecken zurückzulegen galt. Aber auf der anderen Seite war sie völlig einfach und genügsam in ihrer Lebensweise. Ging sie einkaufen, zog sie beispielsweise gern mit einem alten Kinderwagen los.
»Sie hätten die Frau mal sehen sollen, wenn sie um die Ecke kam!«, erinnerte sich Welskopf-Henrichs Kollege Audring lachend. »Sie hatte so einen grauen Mantel an, ein Tuch um den Kopf und einen klassischen Haarknoten, und dann dieser tiefe Kinderwagen mit solchen kleinen Rädern. Dass das die reichste Frau von Treptow war, hätte man nie geglaubt, weil sie eben ziemlich bescheiden aussah. Absolut bescheiden im Äußeren und dann ganz versessen auf ihre Schriftstellerei.«
Walter Eder beschreibt seine Erinnerung an Welskopf-Henrich wie folgt:
Sie hatte sehr wache Augen, aber sehr strenge Augen. Sie konnte sehr streng auf einen schauen und war aber – in den paar kurzen Stunden, in denen ich mit ihr sprechen durfte – eine eigentlich ganz freundliche Frau.14
14 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 299.
Welskopf-Henrich gewährte ihren Mitarbeitern viele Freiheiten, nicht nur hinsichtlich der Arbeitsweise, sondern auch, was die Beiträge für die verschiedenen Bände betraf, deren Herausgeberin sie war.
Rößler selbst war zu Beginn seiner Zusammenarbeit mit Welskopf-Henrich noch sehr jung und verfasste in der »Hellenischen Poleis« seinen ersten größeren Aufsatz. Dennoch ließ ihm Welskopf-Henrich völlig freie Hand. Lediglich einige Füllwörter wie »und« oder »auch« strich sie aus dem fertigen Aufsatz – sehr zur Unzufriedenheit des damaligen Anfängers Rößler, der letztendlich jedoch sämtlichen Korrekturen beipflichtete. Dank ihrer Tätigkeit als Autorin wusste Welskopf-Henrich, wie man verschiedene Dinge am besten darstellte und konnte sich auf der Bühne der Sprache und Formulierungen sicher bewegen.
Bei wissenschaftlichen Problemen diskutierte Welskopf-Henrich lebhaft, versuchte bei kleineren Meinungsverschiedenheiten jedoch nicht, ihre Diskussionspartner zu überreden. Unter ihren Angestellten und Kollegen galt sie als tolerant. Dies betont auch Stark, die unter Welskopf-Henrich ihre Doktorarbeit verfasst hat.
Für Rößler war der für die DDR ungewöhnliche »Hauch von Internationalität« beeindruckend, der durch das Haus Welskopf-Henrichs wehte. Kam eine Diskussion angesichts einer schwierigen Fachfrage ins Stocken, griff sie häufig zum Hörer, um beispielsweise János Harmatta, einen berühmten Altertumswissenschaftler aus Budapest, oder andere weltweit tätige Kollegen und Bekannte anzurufen und deren Meinung zu der aufgeworfenen Frage einzuholen.
Zu verschiedenen Anlässen lud sie auf eigene Kosten Kollegen aus aller Welt nach Berlin ein, damit diese an Tagungen oder Kolloquien mit Vorträgen teilnehmen konnten. Die Studenten lernten bei solchen Gelegenheiten internationale Leistungsstandards kennen und genossen die aufgeschlossene Atmosphäre sowie die sachlich-freundlich geführten Diskussionen, die nach Stark »bemerkenswert frei von der Ideologie des Marxismus-Leninismus« waren.15
15 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 237.
Oft wurden die Kollegen auch direkt zu Welskopf-Henrich nach Hause eingeladen. Bevor aber Welskopf-Henrichs Gäste zwecks Diskussionen im großen Besprechungsraum Platz nehmen konnten, mussten sie erst einmal in ihr Haus am Rande des Treptower Parks gelangen. Das gestaltete sich oft als abenteuerliches Unterfangen, denn Welskopf-Henrich besaß einige große Schäferhunde, die selbst bei ihren Freunden gefürchtet waren. Wenn man die Klingel neben dem Gartentor drückte, stürzten zuerst einmal die Hunde ans Tor. In den meisten Fällen wurden sie dann von Welskopf-Henrichs Mann Rudolf weggesperrt, bevor der Besuch das Grundstück betreten konnte.
Liselotte Welskopf-Henrich mit ihrer Schäferhündin Unni
Ein tschechischer Althistoriker, dessen fachliche Kompetenz Welskopf-Henrich sehr schätzte und den sie oft zu Vorträgen einlud, wohnte und schlief einige Nächte im Dachzimmer ihres Hauses. Während seines Besuches war Welskopf-Henrich eines Abends unterwegs, und die Hunde liefen frei auf dem Gelände umher, da in der Gegend viel gestohlen wurde. Als Welskopf-Henrich nach Hause kam, belagerten die Hunde die Tür des Dachzimmers; ihr Gast hatte sich vor lauter Angst von innen mit Tischen und Matratzen verbarrikadiert. Dass er mit den Hunden nicht umgehen konnte, nahm sie ihm sogar etwas übel.
Ganz im Gegensatz zu einem rumänischen Kollegen: Er kam eines Tages nichtsahnend auf ihren Hof, als er sie besuchen wollte, und ehe er sich versah, stürzten die Hunde auf ihn zu. In barschem Ton rief er ihnen auf rumänisch »Sitz!« zu, und – sie saßen. Seitdem sprach sie mit größter Hochachtung von ihm.
Natürlich stand auch Welskopf-Henrich nicht mit allen Menschen auf gutem Fuß. Zu ihren erklärten Gegnern gehörte der Gutachter ihrer Habilitation, der klassische Philologe Werner Hartke (1907-1993), späterer Rektor der Humboldt-Universität und Präsident der Akademie der Wissenschaften, der ihr nach ihren eigenen Schilderungen manchen Stein in den Weg legte und ihre wissenschaftliche Arbeit störte. 1954 lehnte Hartke ihre Habilitationsschrift mit dem Titel »Marx, Engels, Lenin und Stalin über die Sklavenhaltergesellschaft« als nicht ausreichend ab. In diesem Projekt hatte Welskopf-Henrich sämtliche Äußerungen von Marx, Engels, Lenin und Stalin zur Antike und zum Alten Orient zusammengesellt und kommentiert. Welskopf-Henrich war sich der Höhe des gesteckten Zieles wohlbewusst: Nach 23 Jahren fachfremder Tätigkeit wollte sie mit der Arbeit in die Alte Geschichte zurückkehren und das Fach selbst unterrichten. »Der Grund für dieses Versagen liegt offensichtlich darin, dass Dr. Welskopf keinen genügenden Kontakt mit der lebendigen praktischen Forschung gehabt hat«, stellt Hartke dann auch fest.16 Zwar würdigte er den »imponierenden Fleiß«, »die gestalterische Kraft« und das zweifellos vorhandene Talent Welskopf-Henrichs. Allerdings sei die Arbeit mit über 600 Seiten bei weitem zu umfangreich und erfordere einen zu hohen Zeitaufwand für ein Aspiranturverfahren, und der Mangel an wissenschaftlichen Quellen und Belegzitaten sei frappierend. Überhaupt gehöre die Arbeit eher in die Politökonomie. 1957 wurde die Arbeit in einer überarbeiteten Fassung im Akademie-Verlag unter Titel »Die Produktionsverhältnisse im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike. Ein Diskussionsbeitrag« veröffentlicht. Ein wiederum überarbeitetes und erweitertes Kapitel aus diesem Buch bildete die Grundlage für Welskopf-Henrichs zweiten Versuch für eine Habilitation (»Probleme der Muße im alten Hellas«), die Hartke nach einiger weiterer Kritik und berechtigten fachlichen Einwänden akzeptierte. Später versuchte er zu verhindern, dass Welskopf-Henrich zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt und dass ihre großen wissenschaftlichen Arbeiten wie die »Hellenische Poleis« gedruckt wurden. Der Gutachter, den der Direktor des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie Hermann wie oben beschrieben um eine Beurteilung für das Projekt bat, in der Hoffnung, es stoppen zu können, war kein anderer als Hartke.
16 HU-Archiv, Personalakte Welskopf, Bd. 1, Bl. 129. Siehe auch Stark, Isolde: Konferenzband, S. 231.
Neben diesen fachlichen Differenzen resultierten die Spannungen zwischen den beiden wohl auch aus unterschiedlichen politischen Anschauungen. Darüber hinaus warf Welskopf-Henrich, die ehemalige Widerstandskämpferin, dem früheren NSDAP-Mitglied Hartke dessen Tätigkeit unter den Nationalsozialisten vor: Er arbeitete in einer deutschen Zentrale, die versuchte, englische und amerikanische Codes zu entschlüsseln. Diesen Codes legten die Engländer und Amerikaner jeweils ein exotisches literarisches Werk zugrunde, übernahmen daraus Worte und Textteile und vermischten diese nach einem bestimmten Zahlensystem. Man musste das entsprechende Buch kennen, um den jeweiligen Code dechiffrieren zu können. Dazu brauchte man außerordentlich gebildete Menschen, die zufällig auftauchende, seltene Worte, die entschlüsselt worden waren, einem bestimmten Buch zuordnen konnten.
Während der jahrelangen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten scheute sich Welskopf-Henrich nicht, Hartke zu provozieren. Hartke wiederum verfuhr mit ihr nicht anders, wie sie berichtete. Als Welskopf-Henrich gerade an einem ihrer autobiographischen Romane arbeitete, sprach sie Hartke mit der Bemerkung an, in ihrer Geschichte tauche ein SS-Offizier auf. Sie komme mit dessen Sprache und Ausdrucksweise einfach nicht klar – da könne der verehrte Professor Hartke doch sicher einmal behilflich sein.
Differenzen gab es auch mit Erfurt, dem Lektor des Akademieverlages, in dem einige ihrer wissenschaftlichen Arbeiten erschienen. Erfurt hatte die Angewohnheit, sprachliche Verbesserungen, die er für nötig hielt, in die Manuskripte zu schreiben. Diese »Verbesserungen« waren oftmals jedoch sehr fragwürdig. So missbilligte er das schlichte Wort »und« und pflegte es stets durch ein »sowie« zu ersetzen.
Welskopf-Henrich stapelte daraufhin die von diesem Lektor durchgesehenen Arbeiten auf einem Schrank im Versammlungszimmer. Empfing sie nun Gäste oder erhielt wissenschaftlichen Besuch, konnten ihre Kollegen ein Blatt Papier sehen, das aus diesem Stapel Papier heraushing und auf dem in großen Buchstaben geschrieben stand: »Von Herrn Erfurt verdorbene Manuskripte«. Welskopf-Henrich, die ihren Mitarbeitern weitgehende Eigenständigkeit gewährte, beanspruchte und forderte diese auch für sich selbst.
Abgesehen davon war sie nur in äußerst seltenen Fällen wirklich unzufrieden. Ein solcher Fall lag etwa vor, als einer ihrer Mitarbeiter, statt konstruktive Beiträge abzuliefern, allzu oft über private Probleme klagte und für das aktuelle Projekt keine sichtbaren Erfolge erzielte. Hier wurde Welskopf-Henrich, die selbst bis ins hohe Alter sorgfältig und zügig arbeitete und das auch bei anderen voraussetzte, energisch: »Ich bin nicht Ihr Beichtvater, ich bin Ihr Arbeitgeber!«17
17 Nach der Schilderung von Rößler.
* * *
Für Außenstehende mögen Welskopf-Henrichs Tätigkeiten als Wissenschaftlerin und Schriftstellerin den Eindruck einer Art Doppelleben erwecken. Tatsächlich schenkten Welskopf-Henrichs Kollegen ihrer schriftstellerischen Arbeit nie viel Aufmerksamkeit (so zum Beispiel Rößler, der die Romane Welskopf-Henrichs nach eigener Aussage zu seinem Bedauern viel zu spät las) und bekamen Welskopf-Henrichs Begeisterung für die Indianer nur bei wenigen Gelegenheiten zu spüren, zum Beispiel wenn sie ihnen in Arbeitspausen Pemmikan servierte, eine nahrhafte Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und eventuell Beeren oder Kräutern. Aufgrund seiner Haltbarkeit war Pemmikan bei den Indianern als Proviant auf Reisen und als Wintervorrat sehr beliebt. Welskopf-Henrich verstand es ausgezeichnet, dieses Gericht zuzubereiten und ihre Gäste damit zu bewirten.
* * *
So wie es für Welskopf-Henrichs Kollegen kaum Berührungspunkte mit ihrer Schriftstellerei gab, so wussten die Bewunderer ihrer belletristischen Werke meist nichts von ihrem Beruf als Althistorikerin und ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Für Welskopf-Henrich selbst bildeten ihre beiden Passionen eine Einheit: Beim Verfassen wissenschaftlicher Abhandlungen über das Altertum, auf der Suche nach den richtigen Formulierungen und dem Umgang mit Sprache profitierte sie von ihrer Arbeit als Autorin. Bei der systematischen Recherche von Hintergrundinformationen für ihre Romane wiederum war ihre Erfahrung als Wissenschaftlerin unbezahlbar. Ihre schriftstellerische Tätigkeit wäre ohne die wissenschaftliche kaum denkbar gewesen, zumal ein wichtiger Aspekt ihrer Indianerbücher die Vermittlung eines authentischen Geschichtsbildes ist.
Während sie die Wissenschaft als geliebten Beruf betrachtete, bezeichnete Welskopf-Henrich das Schreiben als ihr persönliches Hobby und als »Ernst« ihrer Freizeit, der ihr finanzielle Unabhängigkeit ermöglichte und dem sie sich lediglich in ihrer freien Zeit widmete, das heißt abends, nachts und im Urlaub.
Auch über diese scheinbar zwei Persönlichkeiten hinaus erschien Welskopf-Henrich ihren Mitmenschen als Mensch der Gegensätze. Justus Cobet, wissenschaftlicher Fachkollege Welskopf-Henrichs:
Ich sah ihre wachen und zugleich strengen Augen. Kurz zuvor hatte sie [...] einen am Flügel verletzten Schwan aus der Kälte des Treptower Parks gerettet und in der Badewanne gepflegt, sie, die strenge Wissenschaftlerin und strenge Kommunistin. Wie passte das alles zusammen? 18
18 Stark, Isolde: Konferenzband, S. 301.
Das alles »passt zusammen«, wenn man das Wort »streng« durch »entschlossen« ersetzt. Die Begriffe scheinen eng verwandt zu sein und besitzen doch verschiedene Gewichtungen. Wenn sie etwas für richtig befunden hatte, konnte Welskopf-Henrich in der Tat einen strengen Blick aufsetzen. Diese Strenge stand jedoch nicht für Hartherzigkeit oder Unnachgiebigkeit, sondern für Willensstärke und Konsequenz. Welskopf-Henrich war von Natur aus vor allem zielstrebig und nach eigener Aussage »ganz unglaublich zäh«19. Entschlossen verfolgte sie wissenschaftliche Pläne, zäh war sie, wenn es um die Umsetzung ihrer wissenschaftlichen Projekte ging.
19 In: »Die Zeit« vom 07.07.1978.
Entschlossen war sie auch bei der Arbeit an ihren Romanen oder wenn sie für ein bereits fertiggestelltes Buch einen Verleger suchte (siehe Kapitel »ein steiniger Weg«). Das Durchsetzungs- bzw. Durchhaltevermögen Welskopf-Henrichs war sicher eine ihrer wichtigsten Eigenschaften.
Ließ sie die Idee für eine neue Erzählung nicht mehr los, zog sie sich ihrem Sohn Rudolf Welskopf zufolge zurück und schrieb, bis der neue Roman vollendet war. »Ich schreibe, weil ich es nicht lassen kann«, stellte sie einst fest.20
20 ABBAW 183. Zitiert in einem Zeitungsartikel von Gerd Noglik aus dem Jahre 1971, ohne genauere Quelle.
Warum aber kann ich es nicht lassen? Kunst und Dichtung waren historisch die erste, heute sind sie neben der Wissenschaft die zweite Form der Weltdeutung, des Verstehens der Menschen untereinander und der Selbsterkenntnis. Wem diese Form aus innerer Leidenschaft und harter Arbeit zugänglich geworden ist, der will sie nicht mehr aufgeben.
Und wahrhaftig: Welskopf-Henrich gab das Schreiben nie auf: Sie frönte dieser Leidenschaft bis ins hohe Alter, selbst in Perioden vollster Terminkalender fand sie dafür Zeit. Mit Hilfe ihrer reichen Phantasie versetzte sie sich in ihre Erzählungen hinein und arbeitete daran bis tief in die Nacht. Sah sie sich mit einem Konflikt in der Handlung einer ihrer Geschichten konfrontiert, dessen Lösung ihr nicht einfallen wollte, beschäftigte sie das zutiefst. Dann grübelte sie, überlegte hin und her, änderte und setzte von Neuem an. Aus dieser persönlichen Beziehung zu ihren Geschichten resultierten ungewöhnlich lebendige Schilderungen und glaubhafte Charaktere – beides Stärken Welskopf-Henrichs, einer Autorin, die selbst bei einem recht knappen Schreibstil, wie er für »Jan und Jutta« charakteristisch ist, das Feingefühl für leise Zwischentöne und die Vermittlung von Gefühlen besaß.
Welskopf-Henrich machte sich das Schreiben nie leicht; an jeder einzelnen Seite feilte sie solange, bis sie ihren Vorstellungen entsprach. Beinahe sämtliche Bücher verfasste sie zwei bis drei Mal, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war.
Ihren Besuchern schenkte Welskopf-Henrich in den 50er Jahren oft die gerade erschienene, wieder überarbeitete Fassung von »Die Söhne der Großen Bärin«. Der Verlag schickte der Autorin von aktuell erschienen Auflagen Belegexemplare zu. Erhielt man nun von Welskopf-Henrich ein solches Exemplar, hatte sie oft schon wieder zwanzig neue maschinengeschriebene Seiten hineingelegt. Diese enthielten Kommentare über die Stellen, die sie noch verbessern wollte.
Welskopf-Henrichs Einschätzung nach lag die subjektive Problematik einer guten Textkomposition darin, dass der Dichter den ganzen Stoff beherrschen musste, um eine Komposition tatsächlich meistern zu können und »den passenden Maßstab für das Maß des Einzelnen zu finden21. Aber ein Thema zu beherrschen, gelingt in vielen Fällen erst, wenn die Erzählung geschrieben ist. Es kann sein, dass umgestellt, umgeschrieben, neu komponiert werden muss, sobald das Manuskript in der Rohfassung abgeschlossen vorliegt.«22
21 Das bedeutet, die Gewichtung innerhalb der Erzählung musste stimmen. Welskopf-Henrich legte sehr viel Wert auf die Ausgewogenheit verschiedener erzählerischer Mittel wie der direkten und indirekten Rede, der Beschreibung von Menschen, Landschaften und Ereignissen etc.
22 Einige Probleme der Komposition. In: Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur 2, Berlin: Kinderbuchverlag Berlin, Datum unbekannt, ABBAW 148.
Sie war keine Autorin, die sich einer Thematik nur mit der Aussicht annahm, damit auf dem Buchmarkt erfolgreich zu sein und einen vorhandenen Bedarf an eben dieser Art von Literatur befriedigen zu können. Sie sagte dazu: »Natürlich kann ich [...] nur das schreiben, was ich in seinem Wesen selbst erlebt habe.«23
23 Diskussion um die Bärenbande, ABBAW 163.
Alle ihre belletristischen Veröffentlichungen haben Gegenstände zum Inhalt, die sie entweder aus eigenem Erleben kannte oder die sie außerordentlich bewegten. Das bemerkt auch Rezensent B. Heimberger, der in Hinblick auf Welskopf-Henrichs Indianerbücher feststellt: »Das Exotisch-pittoreske, das durch die Hinwendung zur Welt der Indianer eingebracht wird, ist kein Vorwand, der von bloßem Geschäftssinn zeugt« und den Büchern aufgrund der »aufrichtigen Teilnahme an den Problemen der Indianer« eine »progressive Nützlichkeit« attestiert.24
24 In einer Zeitschrift aus dem Jahre 1971, aus dem Privatbestand von Marc Zschäckel, ohne genauere Angaben.
Obwohl sie Mitglied des Schriftstellerverbandes war, wohnte sie den regelmäßigen Treffen aus Zeitgründen nur selten bei. Ihr Beruf als Wissenschaftlerin hatte bei ihr oberste Priorität und nahm sie zu sehr in Anspruch. Allerdings ließ sie sich die neuesten Ereignisse in stundenlangen Telefonaten ausführlich von einer befreundeten Übersetzerin berichten.
Auch darüber hinaus kann man ihr kaum mangelndes Interesse an der schriftstellerischen Praxis vorwerfen: Zahlreiche Aufsätze und theoretische Überlegungen beweisen eine intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe des Schriftstellers und seiner Rolle in der Gesellschaft.
In »Der Mensch und sein Werk als Problem unseres dichterischen Schaffens« gelangt Welskopf-Henrich zu folgender allgemeiner Erkenntnis:
Bleiben wir Schriftsteller da und dort bei der Wahrheit, färben wir weder rosa noch schwarz, erleben und gestalten wir leidenschaftlich alle Konflikte, hoffen, kämpfen, lieben, leiden und freuen wir uns mit unseren Helden, so werden unsere Leser uns folgen.25
25 ABBAW 15.
In »Der moderne Mensch und die Abenteuerliteratur« begründet Welskopf-Henrich die Notwendigkeit, eine neuartige Indianerliteratur zu schaffen:
Allein der Indianer als Freund des Weißen [...] ist der gute Indianer – der Indianer als Feind des Weißen, das ist der schlechte Indianer – dieses verbreitete, primitive Siegerschema, das auch den Karl-May-Erzählungen aufgedrückt ist, gilt für den modernen Europäer und Amerikaner als überholt. [...] Es bleibt die Aufgabe der freundschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Volk, das seinen Platz in der Geschichte hat und ihn darum auch in der Dichtung beanspruchen kann, im historischen Roman und im Roman der Gegenwart. Es erscheint mir als ein Irrtum, dass man Indianer- und Westernromantik nur durch die Wissenschaft der Ethnologie und der Historie überwinden könne, man muss sie auch in der Dichtung meistern.26
26 ABBAW 148.
Nicht zuletzt auf der Erfüllung dieses Anspruchs, der Bekämpfung tatsachenverfälschender Indianerromantik, beruht der Erfolg Welskopf-Henrichs als Autorin.
* * *
Als Welskopf-Henrich Mutter wurde, befand sie sich bereits in ihrem siebenundvierzigsten Lebensjahr. Nicht nur als Arbeitgeberin, sondern auch in ihrer Rolle als Mutter war sie großzügig und tolerant. Ihr Sohn Rudolf wäre dabei nicht auf die Idee gekommen, seine Freiheiten übermäßig auszunutzen – dazu beeindruckte ihn die von seiner Mutter ausgehende natürliche Autorität zu sehr. Außerdem begriff er schnell, dass seine Mutter eine angesehene Person war, ob nun in der Familie, im Freundeskreis oder bei Kollegen, dass ihr also eine hohe Achtung entgegengebracht wurde, und das machte ihn stolz. So hatte er nichts weniger im Sinn, als irgendwelchen Unfug anzustellen und dadurch die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich zu ziehen.
1953, Liselotte Welskopf-Henrich,
ihr Sohn Rudolf und ihr Mann Rudolf Welskopf
Welskopf-Henrich pflegte, intensiv auf seine Einfälle und seine Phantasie einzugehen und ihn in dieser Richtung zu fördern. Stellte sich der kleine Rudolf vor, wie es sei, ein Löwe oder ein Fuchs zu sein, dann spann Welskopf-Henrich diese Geschichten mit ihrem Sohn zusammen fort.
Auf der anderen Seite hatte sie oft sehr wenig Zeit für ihn. Wenn beispielsweise an der Universität die Semester liefen, sie eine Lehrveranstaltung neu vorbereiten musste, an einer der vielen Konferenzen in ganz Europa teilnahm27, Vorträge halten musste und eventuell gleichzeitig noch an einem Buch schrieb, dann war sie damit selbstredend voll ausgelastet, womit sich auch ihr Sohn konfrontiert sah.
27 Welskopf-Henrich hielt an verschiedensten Universitäten und Colleges in Europa Lesungen über die griechische Geschichte. Einladungen an amerikanische Universitäten ermöglichten es ihr später, Visa für ihre Nordamerikareisen zu erhalten. Die Honorare brachten ihr zusätzlich finanzielle Mittel für die Reisen ein.
Eine Anekdote, die Liselotte Welskopf-Henrich gern erzählte, war, dass der kleine Rudolf eines Tages wütend aufstampfte und sagte: »Wenn ich groß bin, dann werde ich auch Professor und fahre zur Uni und dann sitzt du allein zu Hause!«