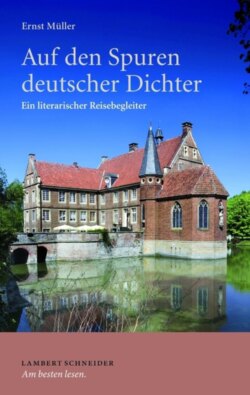Читать книгу Auf den Spuren deutscher Dichter - Ernst Müller - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление„Wer den Dichter will verstehen/Muss in Dichters Lande gehen“, empfahl Johann Wolfgang Goethe dem Literaturfreund in einem Begleittext zu seinem großen Gedichtband „Westöstlicher Divan“. In diesem Sinne führt der vorliegende literarische Reisebegleiter zu Orten, an denen verschiedene deutsche Schriftsteller geboren wurden, gelebt oder geschrieben haben. Dabei soll nach den Spuren der Dichter an jenen Orten gesucht werden genauso wie nach den Spuren, welche die Dörfer, Städte und Landschaften in Leben und Werk der Dichter hinterlassen haben. Thomas Manns Festansprache „Lübeck als geistige Lebensform“ zufolge war die Prägung durch seine Heimatstadt weit tiefer, als man es vielleicht beim weltberühmten Schriftsteller und Nobelpreisträger vermuten würde: Der Sinn für Bürgerlichkeit, das Gespür für Maß und Mitte, der Tonfall seiner dichterischen Sprache, all dies entstamme, so Mann, dem Geist der Hansestadt und schlage sich in seinen Romanen und Erzählungen nieder. Dabei war die Beziehung von Thomas Mann zu Lübeck keineswegs einfach und harmonisch, wie schon allein die Tatsache zeigt, dass er sich erst nach dem Umzug in das südliche München schriftstellerisch entfaltete. Ähnliches trifft auf die Münsteranerin Annette von Droste-Hülshoff zu. Gerade die Gedichte, die sie am fernen Bodensee niederschrieb, zeigen den tiefen Eindruck, den ihre westfälische Heimat in ihrem Leben und Werk hinterlassen hat. Vielschichtig und widersprüchlich ist also das Verhältnis zwischen den Schriftstellern und ihren Geburts- und Wohnorten, die ja auch manchmal Stätten des freiwilligen oder erzwungenen Exils sind.
Wie bei allen biografischen Spuren kann es nicht darum gehen, den Werken fein säuberlich ein Erlebnis des Dichters zuzuordnen und es damit „erklären“ zu wollen. Es ist auch offensichtlich, dass manche Schriftsteller weit weniger von Orten und Landschaften als von geistigen Bezugspunkten geprägt waren. So war wohl Gotthold Ephraim Lessing in den philosophisch-literarischen Debatten seiner Zeit weit mehr zuhause als in Wolfenbüttel. Dennoch bietet ein Besuch im beschaulichen Wolfenbüttel und in der einstigen Hofbibliothek, die er viele Jahre betreute, aufschlussreiche Perspektiven auf sein Leben und Werk. Denn nie ist der Schriftsteller völlig vom Raum, nie ist die Kunst völlig vom Leben zu trennen. Rundgänge durch die Häuser der Schriftsteller lenken die Aufmerksamkeit auf Stadtbilder, Landschaften und Mentalitäten, auf politische und soziale Umstände, auf Freunde, Geldgeber und Leser; sie öffnen damit gerade den Blick auf die Vielfalt, mit der diese Umstände und Erfahrungen literarisch verarbeitet werden.
Museen und Gedenkstätten der Literatur finden sich heute in den Geburtsorten der Dichter, an Schauplätzen ihres Wirkens oder auch an Stätten mit einer besonderen Nachwirkung. Diese Orte laden zur Begegnung mit den Dichtern und ihren Werken ein. Zumeist in sehr plastischer Weise und gleichermaßen Gefühl und Verstand ansprechend, erinnern sie an die Menschen und ihr soziales und räumliches Umfeld. Sie führen den Besucher in andere Zeiten ein, zeigen Wirkung und Fortgang der Ideen und rufen zur eigenen Beschäftigung mit den Fragen auf, die auch die Dichter umgetrieben haben. Solche Orte liegen weit verstreut überall in Deutschland. Doch springen drei Regionen ins Auge, in denen viele Literaturmuseen nah beieinanderliegen und die sich deshalb für eine abwechslungsreiche Kulturreise anbieten. Dabei lassen sich nicht nur interessante Querverbindungen zwischen den einzelnen Gedenkorten ziehen, sondern es lässt sich auch die Landschaft erkunden, in die sie eingebettet sind.
Mehrere bedeutende Literaturzentren liegen im hohen Norden in überschaubarer Nähe zueinander. In Husum an der Nordsee befindet sich das Stormhaus, das an den großen Realisten, den Erzähler und Lyriker Theodor Storm erinnert. Im benachbarten Wesselburen befasst sich ein Museum mit Friedrich Hebbel, dem großen Nachdichter des Nibelungenstoffs. Den Dichterbrüdern Thomas und Heinrich Mann hat die Vaterstadt Lübeck ein Haus gewidmet. Dort hat auch Günter Grass, nur wenige Straßen weiter, eine lebendige Begegnungsstätte für Dichtung und bildende Kunst eingerichtet.
Ein weiterer regionaler Schwerpunkt befindet sich im Harz. Das Halberstädter Wohnhaus Johann Wilhelm Ludwig Gleims, des großen Förderers junger Literaten im 18. Jahrhundert, ist heute ein Museum. Zu Gleims Netzwerk zählte einer der berühmtesten Dichter der Zeit, Friedrich Klopstock, der in der Nachbarstadt Quedlinburg geboren wurde, wo ihm ebenfalls ein Literaturhaus gewidmet ist. Nur wenige Kilometer weiter, in einem kleinen Ort im Harz, steht das Geburtshaus von Gottfried August Bürger, dem Schöpfer der deutschen Kunstballade und der Münchhausen-Volksbücher. Auf einem Landgut im nah gelegenen Oberwiederstedt erinnert die Novalis-Gesellschaft mit lohnenden Ausstellungen an den berühmten Frühromantiker. Auch Wolfenbüttel, die Stadt mit der umfangreichsten Bibliothek zu Mittelalter und früher Neuzeit und Lessings letzter Wohnort, liegt in der Nähe.
In Schwaben kann der Reisende geradezu einer „Dichterstraße“ am Neckar folgen. In Schillers Geburtsstadt, Marbach am Neckar, befindet sich heute neben dem großen Schiller-Nationalmuseum eine international bedeutende Forschungs- und Sammelstätte für die neuere deutsche Literatur. Von Lauffen, dem Geburtsort Friedrich Hölderlins, kann man mit dem Kahn flussaufwärts in die alte Universitätsstadt Tübingen gelangen, wo gleich am Ufer aus einer Häuserreihe der gelbe Turm hervorragt, den später der kranke Hölderlin jahrzehntelang bis zu seinem Tod bewohnte. Heute sind dort ein Museum und eine Bibliothek eingerichtet. Ebenfalls unweit des Neckars liegt das barocke Ludwigsburg, aus dem Eduard Mörike stammt. Dem feinsinnigen Lyriker und Theologen ist in der etwas nördlich gelegenen Ortschaft Cleversulzbach, wo er als Pfarrer wirkte, ein hübsches Museum gewidmet. Mörike war mit Justinus Kerner bekannt, dem Dichter aus dem nahen Weinsberg, der dort die berühmte Burg Weibertreu vor dem Verfall rettete. Christoph Martin Wieland, der später im thüringischen Weimar mit Goethe, Herder und Schiller zum „Viergestirn“ der deutschen Klassik gehörte, wuchs im oberschwäbischen Biberach an der Riss auf. Auch hier lädt ein Museum für den berühmten Sohn der Stadt zu einem Besuch ein. Das Ensemble schwäbischer Literaturhäuser wurde erst vor Kurzem durch das alte Forsthaus im kleinen Wilflingen ergänzt, in dem Ernst Jünger rund 50 Jahre seines langen Lebens verbrachte. Wer die Literaturmuseen in Schwaben mit dem Fahrrad erkunden möchte, der kann den Schildern mit dem Emblem einer blauen Feder folgen. Verschiedene sorgfältig ausgearbeitete Routen führen den Radfahrer durch abwechslungsreiche Landschaften mit zahlreichen literarischen Erinnerungsstätten. Der Reiz, mit dem Rad, dem Auto oder auch öffentlichen Verkehrsmitteln gleich mehrere Literaturmuseen einer Region anzusteuern, liegt nicht zuletzt darin, dass sich dabei das geografische und geistige Umfeld eines Dichters näher erschließt. Landschaftliche, architektonische, kunsthandwerkliche und vielleicht auch kulinarische Eigenarten einer Region können Verbindungen zwischen der Umgebung und dem dichterischen Werk offenbaren. Und die Beziehungen zu anderen Schriftstellern und Denkern, die in der Nähe wirkten, lassen sich auf diese Weise ebenfalls nachvollziehen.
So umfangreich die Anzahl der Literaturmuseen in Deutschland ist, so vielfältig ist auch die Art ihrer Gestaltung. Viele Museen sind in den ehemaligen Wohnhäusern der Schriftsteller eingerichtet. Manche können dabei noch ein Bild des einstigen Zustands vermitteln. Der Anblick der alten Familienmöbel im Theodor-Storm-Haus in Husum vergegenwärtigt die Vergangenheit so eindringlich, als habe der Hausherr gerade das Zimmer verlassen. Andere Erinnerungsstätten warten nur mit wenigen originalen Zeugnissen auf, beeindrucken aber mit ihrer chronologischen oder systematischen Darstellung von Leben und Werk. Immer öfter halten multimediale Präsentationstechniken Einzug in die Literaturmuseen, vielfach verbunden mit pädagogischen Konzepten für junge Besucher. Schillers Geburtshaus kann dafür als Beispiel dienen. Dabei ist es nicht immer einfach, die Balance zu halten zwischen einer zeitgemäßen Form, die den Besucher anspricht, und der Bewahrung der Atmosphäre eines alten, traditionsreichen Gebäudes. In gelungener Weise gewährt das Hermann-Hesse-Museum in Calw mit verschiedenen Themenarrangements und dichten Erklärungstexten tiefe Einblicke in die Lebensfragen des Nobelpreisträgers. Besonders reizvoll sind die Präsentationen, für die das Literaturmuseum in Marbach bekannt ist: Schriften und Exponate werden in interessanten Konstellationen zu gleichsam gegenständlichen Essays arrangiert. Und auch das Zusammentragen verstreuter Zeugnisse in vielen der kleinen Gedenkstätten nötigt nicht nur Respekt für das Engagement der oftmals privaten Betreiber ab, sondern eröffnet dem Besucher manches Mal überraschende Einblicke.
Einige Museen haben leistungsstarke Archive an ihrer Seite. Das Goethemuseum in Düsseldorf präsentiert der Öffentlichkeit nur einen Bruchteil der Zeugnisse, die in den Magazinen lagern. Allein dieser Bruchteil umfasst aber bereits über tausend Exponate, die der Besucher kaum alle würdigen kann. Weitere wertvolle Dokumente aus dem Archiv werden in Sonderausstellungen von Zeit zu Zeit ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Einige solcher Museen sind mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen verbunden, die Anlaufstellen für Wissenschaftler und Interessierte aus aller Welt geworden sind. Die deutsche Schillergesellschaft unterhält eigens ein „Collegienhaus“, um die Gastforscher bequem unterbringen zu können. Die Forschungen dieser Einrichtungen bringen auch neue Erkenntnisse und Impulse für die Ausstellungen. Darüber hinaus haben sich verschiedene Literaturmuseen zu kulturellen Begegnungszentren entwickelt, die neben ihrer Ausstellung auch Lesungen und Kolloquien organisieren. Manche dieser Stätten sind zu großen Publikumsmagneten geworden. Das Goethehaus am Frauenplan in Weimar gehört zu den festen Attraktionen einer Thüringenreise und zählt so viele Besucher, dass stets nur eine bestimmte Anzahl gleichzeitig in die Räume gelassen wird, um die historische Bausubstanz nicht zu beschädigen.
Literaturmuseen vermitteln nicht nur Geschichte, sie haben auch selbst eine. Meist waren es rührige Vereine, literarische Gesellschaften oder Bürgerinitiativen, die einen lokalen Gedenkort an einen geschätzten Dichter zum Museum ausbauten. Nicht selten gelang es ihnen, die öffentliche Hand in die Verantwortung einzubeziehen, um die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. Das schöne Fachwerkhaus in Quedlinburg, in dem Friedrich Gottlieb Klopstock 1724 geboren wurde und die frühe Kindheit verbrachte, blieb nur bis 1817 im Besitz der Familie. Auf Initiative des heimischen Klopstock-Vereins kaufte die Stadt das Haus und richtete dort 1899 ein Museum ein. Das heutige Buddenbrookhaus in der Mengstraße in Lübeck wurde 1758 von einem wohlhabenden Kaufmann erbaut und einige Jahrzehnte später von der Familie Mann gekauft. Der berühmteste Sohn der Familie, Thomas Mann, machte es 1901 mit dem Roman „Buddenbrooks“ berühmt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Manns das Haus jedoch längst verkauft. Es kam in die Hand unterschiedlicher Nutzer. Dazu zählten noch vor der NS-Zeit die Lübecker Staatslotterie, eine Volkslesehalle und eine Buchhandlung mit dem Namen „Buddenbrooks“, die immerhin schon die feste Verbindung des Gebäudes mit der fiktiven Familiengeschichte dokumentiert. Dennoch wurde das Haus erst 1993 zum Literaturmuseum „Thomas-und-Heinrich-Mann-Zentrum“. Im originalen Zustand ist hier allerdings nur noch die äußere Fassade, heute ein Wahrzeichen des hanseatischen Großbürgertums. Das Haus selber fiel den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Vollkommen zerstört im Krieg wurde das Geburtshaus Heinrich von Kleists in Frankfurt an der Oder, wo seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein erstes Kleistmuseum existiert hatte. Seit 1969 beherbergt das historische Gebäude der alten Garnisonsschule Frankfurts das heutige Museum.
Von den vielen literarischen Museen und Erinnerungsorten konnte im vorliegenden Reisebegleiter nur eine beschränkte Zahl von Zielen aufgenommen werden. Die Auswahl sollte mit Stationen von der Nordseeküste bis zur Schwäbischen Alb eine möglichst große geografische Vielfalt umfassen. Außerdem war es das Ziel, unterschiedliche literarische Epochen von der Aufklärung über Klassik, Romantik, Frührealismus bis zur klassischen Moderne zu vereinen. Und neben berühmten sollten auch heute verblasste Namen aufgenommen werden, die trotzdem einen wichtigen Anteil an der Kulturentwicklung hatten. So wird den meisten Lesern der bereits erwähnte Rokokodichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim kaum noch geläufig sein. Doch prägte er mit anderen die Sprache der im 18. Jahrhundert entstehenden Briefkultur – einer Kultur, die in unseren Tagen durch elektronische Kommunikationsformen an ihr Ende zu gelangen scheint. Diese Kultur war jedoch grundlegend für die Entstehung der neueren Literatur, wie etwa für Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774). Auch bei einem Schriftsteller wie Justinus Kerner könnte sich die Frage stellen, warum der württembergische Romantiker, der zuweilen als Regionalautor eingestuft wird, jenseits des Schwabenlandes auf Interesse stoßen sollte. Die Antwort liegt in seiner eigentümlichen Persönlichkeit. Denn wie kaum ein anderer verkörperte der Poet, Arzt, Geisterseher, Psychologe, Mittelalterforscher und Denkmalschützer die Romantik als Lebensform – von manchen schönen Gedichten, die teilweise zu beliebten Liedern vertont worden sind, ganz zu schweigen.
Auch was die in diesem Buch berücksichtigten Schriftsteller betrifft, zwingt der knappe Raum zu Reduktionen. Doch ausgiebige Interpretationen und detaillierte Analysen liegen ohnehin nicht in der Absicht dieses Bandes und sollen der einschlägigen Fachliteratur vorbehalten bleiben. Ebenso wenig soll nach Art eines Museumsführers von Objekt zu Objekt durch die unterschiedlichen Ausstellungen geführt werden. Vielmehr will das vorliegende Buch die Rundgänge durch Museen und Orte als einen besonderen Zugang zu den Dichtern und ihrer Zeit vorstellen. Die Kombination von Reisebegleiter und Literaturvermittlung will bewusst Ortsbeschreibung und literarische Erkundung miteinander verschränken, in jedem Kapitel auf eigene Weise. Die gegenseitige Durchdringung der Sphären von Reise und Literatur hebt das Buch von rein literarischen wie rein touristischen Arbeiten ab.
Der Verfasser hofft, die Neugier und Freude bei der Arbeit an diesem Buch an die Leser weitergeben zu können. Sie mögen auf der gedanklichen Reise einen altvertrauten Schriftsteller wiederentdecken oder auf einen bisher unbekannten Schatz stoßen und vielleicht Lust verspüren, die Werke selbst zur Hand zu nehmen. Und sie mögen zu eigenen Reisen durch Deutschland auf den Spuren seiner Dichter verführt werden.
| Thomasstadt Kempen, im Sommer 2011 | Ernst Müller |