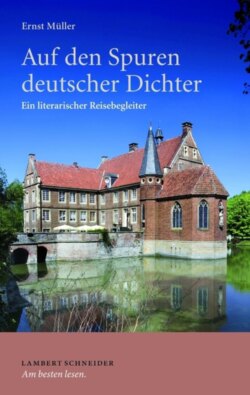Читать книгу Auf den Spuren deutscher Dichter - Ernst Müller - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Theodor Storm (1817–1888) Bürgerlichkeit und Poesie in der Nordseestadt Husum
ОглавлениеDie Stadt
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn’ Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber fürund für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.
Die Stadt, das ist Husum. Theodor Storm hat ihr mit diesem Gedicht seine Liebe erklärt. In Husum wurde der Lyriker und Erzähler geboren, hier verbrachte er als Rechtsanwalt, Landvogt und Amtsrichter mit seiner Familie die meisten Jahre seines Berufslebens. Getrennt hat sich Storm von Husum dreimal: als er in Lübeck aufs Gymnasium ging und danach in Kiel und Berlin studierte; als der deutsch-bürgerliche Patriot sich dem dänischen Machtanspruch verweigerte und für zehn Jahre ins preußische Exil zog; und dann im Alter, als sich der Pensionär im etwas südlich gelegenen Hademarschen ein Haus baute. Aber von der „Husumerei“, wie Theodor Fontane das literarische Schaffen des geschätzten Schriftstellerkollegen spöttisch nannte, hat Storm nie Abschied genommen: Seine Erzählungen spielen meist in Friesland; der Ton ist nordisch nüchtern, dennoch gefühlvoll; und die Eigentümlichkeit der Küstenlandschaft und der Menschen, die hier leben, charakterisieren die meisten seiner Geschichten.
Doch ist Storm alles andere als der Regionalautor, als der er immer wieder vereinnahmt wurde. In der Beschränkung auf seine heimatliche Erfahrungswelt gelingt es ihm gerade, das Allgemeingültige der geschilderten Schicksale, Verhaltensweisen und Gefühle zu verdeutlichen. Nicht von ungefähr wurde er schon zu Lebzeiten in ganz Deutschland und auch im Ausland gelesen.
Sein ehemaliges Wohn- und Kanzleihaus in Husum, in dem er mit seiner Familie von 1866 bis 1880 lebte, ist heute ein lebendig gestaltetes Museum. Es wird zusammen mit einem umfangreichen Archiv von der Theodor-Storm-Gesellschaft betreut und ist eine touristische Attraktion der Stadt. Ein Besuch in Husum ohne Besichtigung des Stormhauses scheint undenkbar, zu eng ist Husum mit dem Namen Theodor Storm verbunden. Das bedeutet allerdings nicht, dass Husum nicht auch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten hätte. Wer mit dem Zug anreist, kann sich vom Bahnhof aus zu Fuß auf den Weg zum Museum machen und dabei einiges über Stadt und Umland erfahren. Der Reisende sollte unbedingt das Ludwig-Nissen-Haus in der Herzog-Adolf-Straße besuchen. Dieses Museum für nordfriesische Natur, Geschichte und Lebensart wurde von dem Husumer Ludwig Nissen (1855–1924) gestiftet, der in jungen Jahren nach Amerika ausgewandert war und dort sein Glück gemacht hatte. Die Ausstellung, verteilt über mehrere Etagen, gibt Einblick in Flora und Fauna der herben Küstenlandschaft sowie in den harten Alltag der Küstenbewohner seit dem 18. Jahrhundert, der nicht wenige zur Auswanderung nach Übersee trieb.
Im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland am Hafen bekommen „Landratten“ ebenfalls anschaulichen Nachhilfeunterricht zum Leben am und mit dem Meer. Anhand von nautischen Originalgeräten, Schiffsmodellen und Filmvorführungen erfährt man Interessantes über Geschichte und Gegenwart des Schiffsbaus und Fischfangs, über Fahrten auf stürmischer See und über das segensvolle Engagement der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Highlight der Ausstellung ist das Wrack eines 400 Jahre alten Frachtenseglers.
Es lohnt sich auch, einen kleinen Abstecher nach Norden zum Husumer Schloss zu machen. Die Renaissance-Anlage, umgeben von einem romantischen Wassergraben bietet unter anderem beeindruckende barocke Kaminbauten des 17. Jahrhunderts aus Sandstein und Alabaster sowie eine Kapelle mit alter Holzbestuhlung. Der Schlosspark ist seit dem 19. Jahrhundert im naturnachahmenden Stil englischer Gärten gestaltet. Wer im Frühjahr anreist, wird geradezu überwältigt von einem Meer aus violett blühenden Krokussen. Die Husumer nehmen die faszinierende Naturerscheinung zum Anlass, ihr jährliches Krokusfest zu feiern. Die Herkunft der unzähligen Krokusse ist nicht geklärt, möglicherweise wurden sie im Mittelalter von Mönchen angepflanzt. Im Garten des Schlosses hat auch ein Theodor-Storm-Denkmal seinen Platz gefunden.
Wer mehr über den berühmtesten Sohn der Stadt erfahren will, muss sich zum Husumer Binnenhafen begeben, in dem bei Ebbe die ankernden Schiffe auf Grund liegen. Vom Hafen, wo im Sommer Stühle und Tische vor den Cafés zum Verweilen einladen, führt eine kleine Nebenstraße namens Wasserreihe ab, in der sich das Stormmuseum befindet. Die Nummer 31 ist ein freundliches, hell verputztes Kaufmannshaus aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Eingang liegt nicht an der Straße, sondern seitwärts im Garten. Im Inneren geht der Besucher durch Räume, die wie zu Storms Zeiten im Stil der biederen, gutbürgerlichen Wohnkultur des 19. Jahrhunderts eingerichtet sind. Die Bürgerlichkeit des Hauses weist auch auf Storms schriftstellerisches Blickfeld hin. Seine Erzählungen spielen meist in der gehobenen bürgerlichen Gesellschaft. Auch wenn gelegentlich Figuren aus unteren Schichten auftreten, spielt ihre soziale Realität, wie in der gesamten deutschen Literatur der Zeit, noch keine Rolle; erst die Schriftstellergeneration nach Storm und Fontane wird sich dieser Wirklichkeit literarisch annehmen. Jedoch finden sich durchaus gesellschaftskritische Töne im Werk Storms, der zeitlebens antiklerikal und antifeudal eingestellt war.
Die drei Lebenssphären, in denen sich Theodor Storm bewegte, waren in dem Haus vereint: Es war Wohnung der Familie, Sitz der Landvogtei und zudem Entstehungsort vieler Werke. Am Ende des Flurs befindet sich das Kanzleizimmer, von dem aus der Landvogt und spätere Richter Theodor Storm seine Amtsgeschäfte betrieb. Schreibpult, juristische Unterlagen und Bücher zeugen von der verantwortungsvollen Tätigkeit, der Storm hier fast 15 Jahre nachging. Links vom Eingang betritt der Besucher das ehemalige Wohnzimmer, in dem ein langer Tisch mit Deckchen und ein großer Schrank stehen. Einen bewegenden Blick in die Welt vor 150 Jahren erlauben die fotografischen Porträts der Familienmitglieder, denn Storm gehörte zu der ersten Generation, die sich der Fotografie bediente. Schon Storms Großmutter hatte sich mittels der Daguerrotypie, einer Vorform der Fotografie, ablichten lassen. Neben Storms Kindern und seiner Ehefrau zeigen die Fotografien immer wieder ihn selbst in den unterschiedlichen Abschnitten seines Lebens.
Die Fotografie spielt auch in der Novelle „Viola Tricolor“ eine Rolle, nach der das ehemalige Wohnzimmer heute in der Ausstellung benannt ist. Der Raum ist nach einem Zimmer gestaltet, das in der Erzählung genau beschrieben ist. In der Novelle nimmt dort eine junge Frau zum ersten Mal Platz, nachdem sie der Herr des Hauses in zweiter Ehe geheiratet hat und nun in ihr neues Zuhause führt. Der neuen Gattin misslingt zunächst der Versuch, eine emotionale Verbindung mit dem Kind aus erster Ehe zu finden. Das Andenken an die verstorbene Mutter lastet wie ein Mühlstein auf dem Haushalt und bedroht das Glück der neuen Ehe. Als die junge Frau selbst ein Kind zur Welt gebracht hat und im Wochenbett ihre Lebenskräfte schwinden fühlt, bittet sie darum, rasch noch einen Fotografen zu bestellen, damit das Kind später ihre Gesichtszüge kennenlernen kann. Doch die Frau erholt sich wieder. Die Erfahrung höchster Todesnot lässt die Familie die Spannungen und Schwierigkeiten überwinden und beschert ihr endlich neues Glück: Die neue Gattin akzeptiert das Andenken an die Verstorbene und Vater und Tochter treffen eine Entscheidung für das Leben im Hier und Jetzt.
Diese kunstvoll gestaltete Novelle zeigt wesentliche Elemente der stormschen Schreib- und Erzählweise. Storm vermag es, schon vor dem dramatischen Höhepunkt in scheinbar nebensächlichen Bemerkungen der Figuren oder in Beschreibungen der Zimmereinrichtung das später aufbrechende Seelendrama in einer Weise spürbar werden zu lassen, die dem Leser unter die Haut geht. Die Darstellung bleibt dem Sichtbaren und Gegebenen verhaftet, weshalb Storm auch zu den Realisten in der Literaturgeschichte gezählt wird. Aber die Bedeutung reicht darüber hinaus, öffnet den Blick auf abgründige Stimmungen und Konflikte.
Für Storms Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen, die ihn beschäftigten, ist sein Atheismus von besonderer Bedeutung. Entgegen den christlichen Vorstellungen und Erwartungen seiner Zeit betrachtete Storm den Tod als das Ende aller Existenz. Auch in der angesprochenen Novelle wird eigens darauf verwiesen, dass die verstorbene erste Gattin des Protagonisten ohne Priester, dafür aber würdevoll in frühester Morgenstunde beerdigt wurde. Auf genau diese Weise hatte sich tatsächlich die Beerdigung der ersten Ehefrau Storms, Constanze, zugetragen. Storms Aufmerksamkeit galt dem diesseitigen Leben, gerade aufgrund seiner Flüchtigkeit und Begrenzung. Daher spielen Zeit und Vergänglichkeit in vielen seiner Geschichten eine wichtige Rolle. Immer wieder streift der Blick des Erzählers in den Novellen über die Jahre und macht Sprünge über die Zeiten hinweg.
Die wehmütige Erinnerung prägt auch Storms frühen Erfolg, die Novelle „Immensee“. 1849 zunächst in einer Zeitschrift publiziert, erlangte die Buchausgabe schon zu Storms Lebzeiten rund 30 Auflagen und machte ihn als Schriftsteller bekannt. In dieser Novelle erinnert sich der alternde Erzähler seiner Jugendliebe, die lange auf ihn gewartet hat, schließlich aber auf Druck der Mutter in die Ehe mit einem wohlhabenden Gutsbesitzer einwilligen musste. Ein Besuch des Erzählers bei dem Paar, das eine unterkühlte Beziehung pflegt, lässt die früheren Gefühle schmerzhaft aufleben und endet in endgültiger Trennung und Entsagung. Die Perspektive des Rückblicks mit ihren unterschiedlichen Zeitebenen taucht das Geschehen in die Wehmut verpasster Lebenschancen. Die Sprache des Erstlingswerks ist noch stark lyrisch geprägt und trägt Züge des Romantischen. In den späteren Novellen wird Storms Tonfall herber und realitätsbezogener. Die Immensee-Geschichte gründet auch in eigenem Erleben. Der junge Storm, noch auf dem Gymnasium, verliebte sich früh in ein Mädchen, dem er später vergebens einen Heiratsantrag machte.
Alte Ausgaben von „Immensee“ und anderen Erzählungen sind in den beiden nächsten Museumsräumen ausgestellt, in denen der Besucher Näheres zu Storms Biografie erfährt. Bereits als Gymnasiast schrieb der junge Storm erste Gedichte. Auf der Universität in Kiel lernte er den späteren Historiker und Nobelpreisträger Theodor Mommsen und dessen Bruder Tycho kennen. Gemeinsam gaben sie eine Sammlung von Liedern heraus – Storm gründete übrigens auch später noch an all seinen Wohnorten Gesangsvereine oder trat ihnen bei. Überhaupt schätzte Storm Geselligkeit, im Verein wie im freundschaftlichen und familiären Rahmen, etwa in Teegesellschaften oder Kartenrunden. Er studierte Jura wie sein Vater, der ein anerkannter Anwalt in Husum war. Nach seinem Studienabschluss arbeitete Storm zunächst in der väterlichen Kanzlei, bevor er sich selbständig machte und schließlich in den Staatsdienst wechselte. Storm, der 1834 seine Cousine Constanze Esmarch heiratete, litt bald nach der Hochzeit unter Liebesqualen, da in ihm die Gefühle für seine Jugendliebe Dorothea Jensen wieder aufbrachen. Kurz nachdem er 1865 seine Amtsrichterstelle in Husum antrat, starb seine Frau bei der Geburt ihres siebten Kindes. Nur ein Jahr später heiratete er Dorothea, mit der er in das Haus an der Wasserreihe einzog, dem heutigen Stormmuseum. Der Konflikt der zweiten Ehefrau in der Novelle „Viola Tricolor“ kennt also ebenfalls ein Vorbild in Storms eigenem Leben. Mit seiner ersten Ehefrau hatte Storm bis zu seinen Jahren in Preußen 1852 ein Haus in der Nähe des Schlossparks bewohnt, das ihm der Vater zur Verfügung gestellt hatte. In diesem Haus schrieb er „Immensee“ und das berühmte Gedicht über die graue Stadt am Meer. Heute weist eine Gedenktafel an der Fassade Neustadt 56 auf den einstigen Bewohner hin.
Storm hat sich, was die Prosa angeht, entschieden als Novellendichter verstanden und diese Form ein Leben lang bevorzugt. In der Novelle, die sich auf eine Begebenheit konzentriert, sah er die Möglichkeit, sich wie in der Lyrik auf Wesentliches zu beschränken. Entsprechend sorgfältig hat Storm an den Sätzen der Texte gefeilt. In der Form der Novelle setzte sich der Schriftsteller mit vielen verschiedenen Themen auseinander. Manche Novelle ging aus persönlichen und beruflichen Erfahrungen hervor, andere griffen aktuelle Themen der Zeit auf; seine Novellen behandeln die Sehnsucht und Suche nach Liebesglück, die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft oder nehmen historische Stoffe und Legenden auf.
Ein Thema seines Werks sind auch Kinderfiguren. In die Erlebniswelt von Kindern vermochte sich der achtfache Vater offenbar besonders gut hineinzuversetzen. Eine seiner berühmtesten Erzählungen, „Pole Poppenspäler“, ist sogar eigens für Kinder und Jugendliche verfasst. Sie wird noch heute gern im Deutschunterricht gelesen. Entstanden ist die Novelle übrigens im Haus in der Wasserreihe. Auch im Kulturleben der Stadt Husum hat die Erzählung greifbare Spuren hinterlassen. Das heimische Museum für Marionettenfiguren, das eine bunte Vielzahl an Spielfiguren aus aller Welt ausstellt, nennt sich nach Storms Novelle „Poppenspäler Museum“. Jährlich im September lädt der Förderkreis zu einem Pole-Poppenspäler-Festival nach Husum ein.
Eine Holztreppe führt den Museumsbesucher in die zweite Etage des Storm-Hauses. Hier befindet sich ein weiteres ehemaliges Wohnzimmer der Familie Storm, weil der Hausherr zeitweilig die untere Etage vermietet hatte. Zudem kann hier Storms ehemaliges Arbeitszimmer, in dem er viele seiner Werke schrieb, besichtigt werden. Diese beiden Räume entsprechen noch weitgehend dem Zustand, wie ihn die Familie Storm hinterlassen hat, und erhalten eine ganz besondere Atmosphäre durch die originalen Möbel, Bilder und Bücher. Zusätzlich hat die Theodor-Storm-Gesellschaft auf dieser Etage einen eigenen Ausstellungsraum zu Storms berühmtestem Werk eingerichtet: der Erzählung „Der Schimmelreiter.“
Mehrfach verfilmt und ebenfalls immer noch Schulstoff, dürfte diese dramatische Gespenstergeschichte den meisten Besuchern bekannt sein. Sie handelt vom Deichgrafen Hauke Haien, der sich einst angesichts einer Natur- und Familienkatastrophe in die schäumende See stürzte und seitdem, wenn auch undeutlich, immer wieder als untoter Reiter auf dem Deich gesichtet wird. Diesem unheimlichen Höhepunkt voraus geht eine fesselnde Geschichte von sozialem Aufstieg, Außenseitertum, Versagen vor dem eigenen Gewissen, vom Kampf gegen die grausame Gewalt des Meeres, der Kraft abergläubischer Sagen und dem Glauben an technischen Fortschritt.
Ein handschriftlicher Entwurf des Dichters gibt Einblick in seinen Arbeitsprozess. Zur Vorbereitung des „Schimmelreiters“ betrieb Storm genaue Studien zur Technik des Deichbaus, um auch in den Einzelheiten auf sicherem Grund zu stehen. Als Quelle seiner Geschichte diente ihm eine Erzählung, die er als Student in einer Zeitschrift gelesen hatte. Gut 40 Jahre später formte er sie zu einer vollendeten Novelle, die Leben und Mentalität der Küstenbewohner atmosphärisch dicht wiedergibt. Die Novelle, die heute zur Weltliteratur gehört, war Storms letztes Werk. Der schwer kranke Schriftsteller, inzwischen auf seinem Alterssitz in Hademarschen, rang sie 1888 dem Tod geradezu ab. Kurz nach ihrer Vollendung starb er. Beigesetzt wurde Storm in der Familiengruft auf dem Husumer St.-Jürgen-Friedhof.
Obwohl es vor allem der „Schimmelreiter“ war, der Storm einen bleibenden Platz in der Literaturgeschichte gesichert hat, wäre es falsch, den Autor auf seine Prosatexte zu reduzieren. Storm selber verstand sich in erster Linie als Lyriker. Thomas Mann schrieb über Storms Gedichtsammlungen, dass dort „Perle fast an Perle“ gereiht sei. Und tatsächlich, Gedichte von anrührender Schönheit finden sich dort:
Meeresstrand
Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmrung bricht herein;
Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein.
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.
Ich höre des gärenden Schlammes
Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen –
So war es immer schon.
Noch einmal schauert leise
Und schweiget dann der Wind;
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.
Auch hier lässt sich die genaue Beobachtungsgabe Storms erkennen, der die Natur der Nordseeküste in ihren Einzelheiten in präzisen und plastischen Bildern lebendig werden lässt. Doch bleibt Storm wie bei seinen Novellen auch in seiner Lyrik nicht bei der Abbildung der Wirklichkeit stehen. Das lyrische Ich und die Betonung des subjektiven Erlebnisses im zitierten Gedicht lenken die Aufmerksamkeit darauf, dass auch in Zukunft, wenn der Betrachter längst verstorben sein wird, künftige Generationen diesen Meeresstrand betrachten werden; und die Stimmen der Toten, die einst dasselbe Bild genossen haben, erheben sich in der Fantasie des Betrachters und erinnern ihn wehmütig daran, dass auch er einmal zu ihnen gehören wird. Die Erfahrung von Vergänglichkeit und Begrenztheit menschlicher Existenz ist Teil dieses Naturerlebnisses. Diese melancholischen und doch der Welt zugewandten Verse mögen nicht zuletzt zu einem ausgedehnten Spaziergang an der Husumer Bucht mit ihren einzigartigen Halligen und Inseln verführen. Dort kann man die nordfriesische Landschaft erleben, die Storm so sehr geprägt und beschäftigt hat.