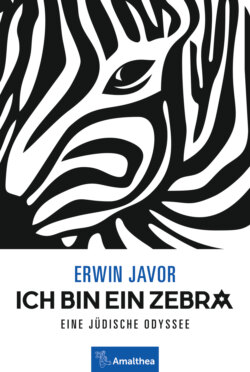Читать книгу Ich bin ein Zebra - Erwin Javor - Страница 10
Der eigentliche Plan
ОглавлениеIn bewegten Zeiten läuft alles anders, als vorgesehen. Aber grundsätzlich folgt die jüdische Lebensart zu allen Zeiten einem Plan, wie man sich findet, eine Familie gründet, Kinder aufzieht, sie ins Leben schickt und den Lebenszyklus beendet. Diese tief verwurzelte Tradition war der Generation meiner Eltern nicht verloren gegangen. Sie konnte sie so nicht leben, hat sie aber auf kreative Weise in ihre schicksalsgebeutelte neue Existenz mitgenommen und weitergegeben.
Wie in anderen Kulturen markieren auch im Judentum bestimmte Meilensteine den Lebenszyklus. Geburt und Beschneidung, Übergang ins Erwachsenenalter, Heirat, Familiengründung, Tod und Begräbnis.
Ein Jude wird geboren
Bei der Geburt fangen die Schwierigkeiten schon an. Wer ist ein Jude? Nach der Halacha, dem rechtlichen Teil jüdischer Überlieferung, ist ein Kind, das eine jüdische Mutter geboren hat, jüdisch. Der Vater zählt von allem Anfang an relativ wenig, und das bleibt auch so. Wer die Mutter ist, lässt sich nicht simulieren. Beim Vater kann man es nie so genau wissen.
Der alte Braunstein heiratet in sehr späten Jahren eine junge hübsche Frau. Kaum ein Jahr später ist sie schwanger. Das ganze Schtetl spricht darüber. »Was meinst du? Ist das sein Kind?« Die Theorien zu dieser Frage überschlagen sich an Vielfalt. Rabbi Rosenberg bringt es schließlich auf den Punkt: »Wenn es von ihm ist, dann ist es ein Wunder! Und wenn es nicht von ihm ist – ist es ein Wunder?«
Die zweite Möglichkeit, Jude zu sein, ist schon aufwendiger. Konvertieren ist zwar möglich, aber ein mit Hürden gepflasterter Weg. Das Judentum ist keine missionierende Religion, das ist sogar verboten. Ergo bringen wir auch niemanden um, der nicht an unseren Gott glaubt. Das hat nichts damit zu tun, dass Juden arrogant darauf beharren, das auserwählte Volk zu sein, und es möglichst elitär halten wollten, sondern damit, dass jedem Interessenten die volle Tragweite eines Übertritts ins Judentum bewusst sein sollte. Rabbiner lassen daher Konvertiten mindestens dreimal und manche sogar bis zu siebenmal vergeblich den Antrag zur Aufnahme ins Judentum stellen, bevor sie überhaupt in Betracht ziehen, ihn ernst zu nehmen.
Ich würde im Übrigen jedem davon abraten, zum Judentum überzutreten, weil es ist schwer, zu sein a Jid. Es ist schon alleine deshalb nicht zu empfehlen, sich darum zu reißen, weil Nicht-Juden es leichter haben, ins Paradies zu kommen – falls sie dran glauben. Ein Nicht-Jude muss nämlich laut der Halacha wesentlich weniger Regeln und Gesetze einhalten.
Wird man als Jude geboren, gehen die Spielregeln im Lebenszyklus so:
Beschneidung – Brith Milah
Etwas mulmig wird vor allem männlichen Konvertiten unter Umständen beim Gedanken an den Brauch der Beschneidung im Judentum. Im religiösen Verständnis besiegelt die Beschneidung den Bund mit Gott und gilt als zentral in der Identität eines jüdischen Mannes. Ein wahrlich einschneidender Brauch. Normalerweise wird das am achten Lebenstag eines neu geborenen jüdischen Buben gemacht. In dem Alter weiß man noch nicht, wie einem geschieht, und es ist erledigt, bevor man sich fürchten kann.
Den einschlägigen Profi, der diese heikle Operation durchführen darf, nennt man Mohel, der aus gutem Grunde eine gründliche Ausbildung durchläuft, bevor man ihn an das beste Stück eines neu geborenen Sohnes heranlässt. Ist er einmal so weit, genießt der Mohel auch höchsten Respekt.
Ein Jude reist in eine andere Stadt und besucht dort das jüdische Viertel. Er geht an der Synagoge vorbei, beim jüdischen Bäcker, beim koscheren Metzger, zwei koscheren Restaurants und stutzt plötzlich vor einer Auslage, in der eine Kuckucksuhr hängt. Etwas irritiert fühlt er sich aus der bislang so heimelig jüdischen Stimmung herausgerissen und fragt den Besitzer des Geschäftes: »Sind Sie Uhrmacher?« – »Nein, ich bin ein Mohel.« Der Reisende ist verblüfft. »Warum hängen Sie dann eine Kuckucksuhr in Ihr Schaufenster?« Der Mohel verdreht ungeduldig die Augen: »Was soll ich denn sonst heraushängen?!«
Erwachsen werden – Bar Mitzwa
Was die Firmung bei Katholiken ist, ist die Bar Mitzwa für junge Juden, wenn sie dreizehn werden. In moderneren Zeiten wurde dann auch das Äquivalent für zwölfjährige Mädchen üblich, die Bat Mitzwa. Aber schon seit vielen Jahrhunderten vergisst ein jüdischer Mann seine Bar Mitzwa nicht, selbst wenn er, wie es sich gehört, 120 Jahre alt wird. Er muss sich ein ganzes Jahr lang darauf vorbereiten, einen ziemlich langen hebräischen Text lernen und ihn dann vor der ganzen Gemeinde nach einer uralten Melodie vortragen. Jede Note entspricht einem Wort, dadurch entsteht die Melodie. Welcher Abschnitt der Torah das sein wird, entscheidet sich durch das Geburtsdatum.
Nach dem nervenzerfetzenden Auftritt in der Synagoge, den ein junger Jude auf dem Weg ins Erwachsenenalter zu absolvieren hat, folgt am Abend ein rauschendes Fest. Dort muss das Jingele allerdings noch einmal auftreten und – frei sprechend – eine Rede halten. Die hat natürlich auch möglichst komplexe religiöse Elemente zu thematisieren. Je weniger man sich als Zuhörer dabei auskennt, desto größer fällt der Applaus für den nun erwachsenen Juden aus.
Auch für die Eltern ist eine Bar oder Bat Mitzwa inzwischen zu einer Herausforderung geworden, bei der es um nichts Geringeres als das Prestige der ganzen Familie geht. Jede Bar oder Bat Mitzwa übertrifft die vorhergehende an Aufwand. Man will sich ja nichts nachsagen lassen und vor der ganzen Gemeinde auf unvergessliche Weise glänzen:
Trifft der Grün den Blau. »Warst du nicht auf der Bar Mitzwa von dem jungen Levy? Ich hab’ gehört, die Location für die Feier war wirklich etwas ganz Besonderes, angeblich am Mond!« – »Ja, stimmt.« – »Und?« – »Was soll ich sagen. Das Essen war hervorragend. Koscheres Essen vom Ritz in Paris, eine Musikkapelle, zwanzig Mann hoch. Die besten Künstler sind aufgetreten. Alles, was Rang und Namen hat, war da.« – »Aha. Und wie war die Stimmung?« – »Was soll ich dir sagen? Keine Atmosphäre.«
Und das ist von der Wirklichkeit der konkurrierenden Eltern nicht allzu weit entfernt, auch wenn sich nicht alle so aufführen:
Als der Sohn eines Bekannten, eines besonders reichen Juden, langsam auf seine Bar Mitzwa zusteuerte, fragte ich ihn provokant, aber durchaus ehrlich interessiert: »Auf der Bar Mitzwa von deinem David lastet ja ein besonderer Druck. Du musst ja etwas Besonderes, am besten etwas noch nie Dagewesenes machen. Wie wirst du das anstellen?« Er zuckte entspannt mit den Schultern: »Darüber habe ich schon nachgedacht. Ich werde eine Trompete mehr engagieren.«
Ich selbst hatte meine Bar Mitzwa 1960 und wurde wie alle anderen auch ein ganzes Jahr lang darauf vorbereitet. Meine Familie hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Geld. Die Feier fand in einem koscheren Restaurant statt, ohne Musik und sonstigen Pomp, und die Geschenke waren hauptsächlich religiöse Bücher, die mich schon damals nicht wirklich interessiert haben. Deshalb erinnere ich mich bis heute nur an das eine Geschenk, das mir diesen Anlass wirklich unvergesslich und mich nebenbei auch noch in der Schule zum Star machte: richtige Fußballschuhe!
Heiraten – Chassene
Im passenden Alter wurde man zu Schtetl-Zeiten für den Schadchen, den Heiratsvermittler, interessant. Der Schadchen war ein wichtiger Mann, um dessen Mühen und Wirken sich schon viele Geschichten rankten, lange bevor die Zunft zu den Musicals »Anatevka« und »Hello, Dolly« oder zu Internetplattformen mutierte. So wichtig war er, dass Schadchen auch ein besonders begehrter Beruf war. Junge Anwärter rissen sich geradezu darum, als Lehrling bei einem bekannten Schadchen aufgenommen zu werden:
Benjumin wollte unbedingt Schadchen werden. Davon hatte er schon immer geträumt. Kaum war er alt genug, bekniete er den alteingesessenen Schadchen Jakov Schmiel, ihn als Lehrling zu nehmen. Der freute sich und brachte ihm die ersten Grundzüge des Kupplerhandwerks bei. »Also, mein Sohn, merk dir: Du musst loben, loben, loben. Und lügen, lügen, lügen. Wir gehen jetzt zu den Eltern vom Moische und reden ihm die Rebecca aus Krakau ein. Wann immer ich etwas über sie sage, wirst du noch einen draufsetzen. Das ist deine heutige Übung.«
Die beiden zogen los zu Moisches Eltern. »Oj, hab’ ich ein Mädl für deinen Moische«, begann Jakov die Verhandlungen. »So was von einem anständigen Mädl …« Benjumin fiel ihm eifrig ins Wort und steigerte das Lob, wie ihm geheißen wurde: »Was heißt ›anständig‹?! A Bsile, eine Jungfrau, ist sie, fromm und bescheiden. Und schweigsam!« Jakov ließ seinem Lehrling einen zufriedenen Seitenblick zukommen.
Die Eltern des potenziellen Bräutigams warfen gleich eine kritische Frage ein: »Wie schaut sie denn aus?« Jakov fuhr fort: »Was soll ich dir sagen? Schön ist sie, so eine Schönheit hast du noch nicht gesehen!« Benjumin beobachtete seinen Lehrmeister aufmerksam und setzte umgehend fort: »Was heißt ›schön‹?! Schöner als Ester Malke, die Königin aus der Purim-Geschichte!« Jakov lächelte noch ein bisschen mehr. Mit diesem Lehrling hatte er einen guten Griff getan, der hatte wirklich schnell verstanden, worum es in dem Geschäft ging.
Als Nächstes kam eine etwas heiklere Frage von dem potenziellen Schwiegervater: »Und aus was für einer Familie kommt sie?« Jakov schüttelte den Kopf: »Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Die Familie stammt aus einem Rabbinergeschlecht und hat Jieches und daher hohes Ansehen in der ganzen Stadt!« Benjumin fiel in den Lobgesang ein wie auf Stichwort, jetzt wusste er ja schon, wie es ging: »Was heißt ›Jieches‹?! Der Vater ist ein direkter Nachkomme von Baal Schem Tov, dem berühmten Rabbiner und Gründer des Chassidismus!«
Der kritische zukünftige Schwiegervater legte weiter nach: »Und wie steht es mit dem Mesimmen, haben sie denn Geld?« Jakov war natürlich auch darauf vorbereitet. »Wir reden hier von der reichsten Familie in ganz Stanislau.« Geschmeidig wie ein alter Profi redete Benjumin gleich weiter: »Was heißt ›reich‹?! Rothschild möchte verblassen vor Neid!«
Langsam wurde das Moische und seiner Familie schon verdächtig. Das klang fast ein wenig zu gut, um wahr zu sein, also fragte schließlich Moisches Mutter, der man so leicht nichts vormachen konnte: »Und? Gar keinen Fehler hat sie?«
Jakov wusste, nun war es Zeit für die dramaturgische Wendung. »Nu, was soll ich dir sagen, nicht wirklich. Aber wenn man genau hinschaut, aber nur dann, wird man merken, dass sie ein ganz klein wenig schief steht.« Benjumin war jetzt schon so richtig in Fahrt und nicht mehr zu bremsen: »Was heißt ›schief‹?! Einen Riesenbuckel hat sie!«
Fairerweise muss gesagt werden, Benjumin war noch im ersten Lehrjahr und erlernte die Nuancen der Verstärkung erst später. Herausfordernde Fälle an den Mann oder die Frau zu bringen, konnte man ihm also wirklich noch nicht zutrauen.
In einem Schtetl in Polen, es kann auch in Rumänien gewesen sein, fand ein anderer heiratswilliger junger Mann trotz heißen Bemühens keine Braut. Er war intelligent und kam aus einem wohlhabenden Haus, wurde aber dennoch von der Damenwelt kategorisch abgelehnt. Er hatte nämlich einen entscheidenden Fehler. Er wollte ständig im Mittelpunkt stehen und nahm es auch mit der Wahrheit nicht immer ganz genau. Man konnte zwar nicht behaupten, dass er Lügengeschichten erzählte, aber seine ständigen Übertreibungen waren einfach nervtötend. So kam es, dass er einen Schadchen engagieren musste, um sein Ziel, eine Familie zu gründen, endlich zu erreichen. Der Spezialist für hoffnungslose Fälle musste ran. Schadchen Ruven. Die beiden hatten einige Vorgespräche und schlussendlich musste der Bräutigam in spe dem Vermittler hoch und heilig versprechen, sich während des Erstgesprächs mit einer verheißungsvollen Kandidatin ordentlich und vor allem bescheiden zu verhalten.
Doch es kam, wie es kommen musste. Nach einigen Minuten netter Unterhaltung vergaß der Unbelehrbare seine anfängliche Zurückhaltung und fing an, sein Haus zu beschreiben: »Also mein Wohnzimmer ist über hundert Meter lang und …« Der junge Mann machte eine bedeutungsvolle Pause. Diese Unterbrechung nutzte Ruven, um seinem Kunden einen kräftigen Tritt unter dem Tisch zu verpassen. Da fiel dem wieder ein, dass er bescheiden sein sollte. Also beendete er schuldbewusst und kleinlaut den begonnenen Satz in der geplanten Bescheidenheit: »… und einen Meter breit.«
Die Königsdisziplin für einen Schadchen ist es jedoch, einen Balegule, einen Kutscher, zu vermitteln. Und das hat seine Gründe:
In Nadwurne, einem Schtetl in den Karpaten, wohnte ein bei allen sehr beliebter und herzensguter Balegule. Ein gut aussehender Mann im besten heiratsfähigen Alter, auf den die Frauen nur so flogen, war Schloime außerdem. Doch leider: Wann immer er den Mund aufmachte, fluchte er auch wie ein Kutscher. Aber so, dass sogar der hartgesottensten Männerrunde die Schamesröte ins Gesicht stieg. Darum scheiterte auch ein Schadchen nach dem anderen daran, ihn zu verkuppeln, denn auch wenn er die Frauen verzückte, sämtliche infrage kommenden Schwiegereltern waren entsetzt, sobald er – was sich nicht vermeiden ließ – auch nur einen Satz sagte. Schloime sehnte sich schon sehr nach einer eigenen Frau und wurde immer trauriger. Kaum noch ein Schadchen fand sich, der es mit Schloime auch nur versuchen wollte, denn sein Ruf eilte ihm voraus.
Nur Ruven, der bekannte Spezialist für völlig ausweglose Fälle, sah in ihm eine Herausforderung, der er sich stellen wollte. »Hast du noch Eltern?«, fragte er Schloime. – »Nein, was fragst du mich, du Behejme, du Rindvieh! Du weißt doch, dass sie längst gestorben sind.« – Ruven lächelte gelassen. »Nimm deinen Talles. Wir gehen jetzt zum Bejs Ojlem.« Schloime seufzte tief, nahm seinen Gebetsschal mit vielen Flüchen auf den Lippen und wenig Hoffnung im Herzen, und sie gingen zum Friedhof. Am Grab seiner Eltern ließ ihn Ruven schwören: »Ich schwöre beim Seelenheil meiner Eltern, dass ich nur reden werde, wenn der Schadchen Ruven, der miese Ganeff, es mir erlaubt.« Ruven nahm die Beleidigung ungerührt zur Kenntnis, war zufrieden und verschaffte Schloime flugs am Tag darauf eine Einladung bei den Eltern der schönen Rachel aus dem Nachbardorf.
Ihr Vater, im besten Schabbes-Gewand, strahlte Ruven und Schloime unvoreingenommen an und hieß sie herzlich willkommen. Die Mutter von Rachel, der möglichen Kalle, hatte aufgekocht, nur das Beste vom Besten, und immer wieder fragte sie Schloime: »Willst du noch Latkes?« Schloime nickte freundlich, nahm von den Kartoffelpuffern und schwieg, wie vereinbart. »Willst du noch Lokschn mit Joach?« Schloime zeigte pantomimisch Begeisterung für die angebotene Nudelsuppe. »Schmeckt es dir?« Schloime nickte so enthusiastisch, dass keine Zweifel entstehen konnten. Der anscheinend so liebenswerte, nur leider schüchterne Schloime gefiel nicht nur der Mutter, auch Rachel war hingerissen und machte ihm so deutlich, wie es die guten Sitten nur erlaubten, schöne Augen, was bei Schloime auf mehr als fruchtbaren Boden fiel. Er warf dem Schadchen einen hochzufriedenen Blick zu.
Die Schwiegermutter in spe kam mit Tee. Schloime leerte Zucker in seine Tasse, rührte den Tee aber nicht um. »Was ist denn?«, fragte sie besorgt. »Ist er zu heiß?« Schloime schüttelte den Kopf. »Willst du mehr Zucker?« Schloime schüttelte den Kopf. »Schmeckt er dir vielleicht nicht«, fragte sie mittlerweile schon leicht gekränkt. Schloime begann verzweifelt dreinzuschauen, lief rot an in seiner offensichtlichen Bedrängnis, aber schwieg eisern weiter. Langsam wurde die Situation unbehaglich, und das gerade noch so liebenswert schüchterne Schweigen steckte die ganze Runde an, und die Stimmung schien einzufrieren. Einmal noch wollte Rachels Mutter es versuchen: »Schloime! Nu sag doch, warum trinkst du dann den Tee nicht?!«
Endlich, endlich gab ihm der Schadchen wohl oder übel das vereinbarte Zeichen, dass er sprechen durfte. Mit einem befreiten Ruck sprang Schloime auf, warf in seiner Erleichterung fast den Tisch um, machte in Höhe seines Hosenschlitzes eine kreisrunde Rührbewegung und rief verzweifelt aus: »Und mit wus soll ich mischen? Mitn Schmock??!«
Wer jetzt stutzt: Ursprünglich bedeutet Schmock, wie soll ich das jetzt ausdrücken, das männliche Fortpflanzungsinstrument.
Für Religiöse ist das Verhör bei den potenziellen Schwiegereltern auch nicht leichter:
Ein armer Jeschiwebocher, der um die Hand eines reichen Mädchens anhielt, saß in seinem besten Kaftan vor ihrem Vater und stand ihm Rede und Antwort. Der begann die Feindseligkeiten: »Was machst du beruflich?« – »Ich studiere den Talmud, mit Gottes Hilfe«, antwortete der Jeschiwebocher wahrheitsgemäß. Der Vater runzelte die Stirn: »Und wie willst du dann meine Tochter erhalten, die ein gutes Leben gewohnt ist?« Weiterhin bescheiden gab der Student zu Protokoll: »Gott wird schon helfen.« – »Und wie willst du deine Kinder ernähren?«, verhörte der Vater den Schwiegersohn-Kandidaten weiter. – »Ich werde so schnell wie möglich fertig studieren. Und Gott wird schon helfen«, bekam er zu Antwort. Der Vater bohrte weiter: »So, so. Und wo willst du mit deiner Familie wohnen?« Der Jeschiwebocher blieb unverändert höflich und bescheiden: »Ich werde mich sehr anstrengen, ein schönes Zuhause zu finden. Und Gott wird schon helfen«.
An diesem Punkt kam die Mutter der Zukünftigen dazu und tuschelte ihrem Mann ins Ohr: »Was hältst du von dem?« Mit einem vielsagenden Seitenblick auf den Kandidaten tuschelte er zurück: »Er ist mittellos und viel zu jung, ahnungslos, aber immerhin: Er hält mich für Gott.«
Wenn alles geklärt war, fanden dann zwei zusammen. Das ist im Tierreich auch nicht anders. Achtung: Herrenwitz!
In einem kleinen Schtetl beobachteten zwei Männer eine Kuh und einen Stier, die von den Besitzern der Tiere zu einem Paarungsversuch überredet werden sollten. Es waren immerhin der potenteste Stier und die Milchkuh mit dem vollsten Euter der ganzen Region.
Der Stier schnaubte und sprang in vollem Saft auf die Kuh, aber die schüttelte ihn ab wie eine Fliege. Der Stier setzte abermals zum Sprung an, brachte seine pralle Kraft in geradezu perfekte Position, einen Vorderhuf links, einen rechts, Becken nach vor, aber die Kuh – wollte nicht. Sie wackelte nur einmal, gewusst wie, mit ihren begehrten Körperteilen und der Stier rutschte unverrichteter Dinge wieder von ihr ab. Der Stier sprang, und sprang, und die Kuh reagierte immer gleich mit immer unmutiger werdenden Abwehrbewegungen. Man versuchte, die beiden mit allen möglichen Hilfsmitteln und gutem Zureden zur erwünschten Intimität zu inspirieren, aber nichts half.
Die beiden Zuschauer waren fasziniert. »Die Kuh ist aus Minsk«, stellte schließlich einer der beiden fest. – »Woher weißt du das?«, frage der andere erstaunt. – »Meine Frau kommt auch aus Minsk.«
Familie – Mischpoche
Nehmen wir mal an, der Schadchen war erfolgreich, ein passendes Paar hatte sich durch ihn gefunden und geheiratet, dann kam im Schtetl-Leben ganz geordnet die vorgesehene nächste Lebensphase: die Familie. Die jüdische Familie besteht aus ihrem Zentrum, der Mamme, dem – wie man ja auch an mir sieht – eher unauffälligen Ehemann des Zentrums und deren Kindern, welche ausnahmslos Genies sind.
Auftritt: Die Mamme! Die jüdische Mutter hatte immer schon alle Eigenschaften einer ganz normalen Mutter, aber mehr davon, viel mehr davon. Sie ist per Definition eifersüchtig, bestimmend, besitzergreifend, weiß alles besser, klammert, macht sich immer Sorgen, stopft ihre Kinder ständig mit Lebensmitteln voll und opfert sich auf. Außerdem kann sie besonders gut nachhaltige Schuldgefühle vor allem in ihren Söhnen erzeugen. Bekanntlich gehen die meisten erwachsenen männlichen Juden deshalb früher oder später zum Psychiater oder werden welche.
| … alle Fejgl fun dejm Bojm sennen sich zerflojgn … sug ech zu der Mammen, her, sollst mir nor nisch schterrn, will ech, Mamme, ejns und zwej, bald a Fojgl werrn … Itzik krojn, nemm um Gottes Wiln, nemm chotzsch mit a Schalilkl, sollst sich nischt farkiln. Di Galaoschn nemm dir mit, s’gejt a scharfer Winter un die Kutschme tu dir on, wej is mir un Wind, und doss Winterlejbl nemm, tu es on du Schojte, … Ech hojb di Fliegl, s’is mir schwer, ziviel, ziiel Sachn hot die Mamme ongeton, ihr Fejgele de schwachn kuk’ch trojrig mir arajn in der Mammes Ojgn. S’hot in Liebschaft nischt gelosst werrn mir a Foigl. | … alle Vögel in dem Baum sind davongeflogen … ich sag’ zur Mutter, lass mich ziehen. Bald, ganz bald, will auch ich ein Vogel sein. … Mein geliebtes Kind, um Gottes Willen, nimm doch deinen Mantel und den Schal, du sollst dich nicht verkühlen. Die warmen Schuhe nimm dir auch, so harsch ist doch der Winter, und die Mütze zieh dir an, weil es geht der Wind, und das warme Unterhemd. … Ich heb’ die Flügel, und sie sind mir viel zu schwer, zu viele Sachen hat die Mutter auf ihr Vögelchen geladen. Traurig seh’ ich in der Mutter Augen. Ihre Liebe ließ mich nicht zum Vogel werden. |
(Volkslied, Text Itzik Manger, deutsche Übersetzung vom Autor)
Zum Job der archetypischen Mamme gehört es, sich aufzuopfern und manchmal – nur ganz selten und auch sehr subtil – anklingen zu lassen, dass sie es tut:
Goldstein jr. ruft bei seiner Mutter an: »Wie geht’s dir, Mamme, Siße?« Ganz schwach haucht sie mit letzter Kraft und kaum vernehmbarer Stimme: »Gut geht’s mir, mein Jingele, gut. Nur ein bissele schwach.« – »Um Gottes Willen, Mamme. Wieso denn?« – »Ich hab’ doch seit zwanzig Tagen nichts mehr gegessen.« Der Junior ist alarmiert. »Was ist passiert? Warum denn das?« – »Ach, mein Jingele, ich hab’ doch auf deinen Anruf gewartet und wollte nicht mit vollem Mund mit dir telefonieren.«
In Wirklichkeit sind jüdische Mütter natürlich starke Frauen, die nicht nur als Mütter alles im Griff haben und nichts übersehen:
Eine jüdische Mutter geht mit ihrem Kind am Strand spazieren. Plötzlich kommt eine Riesenwelle und schwemmt das Kind in die unendlichen Weiten des Ozeans. Die Mutter schreit voll Entsetzen und Verzweiflung: »Oh mein Gott, gib mir mein Kind zurück, gib mir mein Kind wieder, ich gebe alles, alles, wenn ich nur mein Kind wieder in den Armen halten darf! Gib mir mein Kind zurück!«
Blitz und Donner zucken durch den Nachmittagshimmel, und eine weitere Riesenwelle schwemmt das Kind wieder vor die Füße der verzweifelten Mutter. Überglücklich schließt sie es in die Arme, überzeugt sich von seinem Zustand und freut sich, dass es unverletzt ist.
Doch plötzlich hält sie inne, erstarrt, schaut mit vorwurfsvoller Miene zum Himmel und schüttelt die Faust nach oben: »Und wo ist seine Mütze?«
Jüdische Mütter sind nicht zuletzt auch für ihre ganz außerordentliche Zähigkeit bekannt, die sie geradezu zu übermenschlicher Kraft auflaufen lässt:
Sara Morgenstern ging ins Reisebüro. »Ich möchte einmal Indien buchen«, gab sie ihre Wünsche bekannt. Die Reisebüroangestellte warf einen überraschten Blick auf ihr geschätzt 85- bis 90-jähriges Gegenüber: »Nach Indien? Fahren Sie in Begleitung?« – »Nein, ich fahre allein. Einmal Indien und retour bitte«, antwortete Frau Morgenstern ohne Zögern. – »Aha. Und wohin in Indien möchten Sie fahren?« – »Nach Goa.« Kein Zweifel, die Frau wusste, was sie wollte, aber die Reisebüroangestellte wollte auch Verantwortung zeigen und klärte auf: »Sie wissen schon, dass es in der Gegend für eine reife Frau wie Sie, ganz allein, nicht so einfach ist? Der lange Flug, die Infektionen, die Bettler, die Sprache …« – Frau Morgenstern ließ sich nicht beirren: »Einmal Indien und retour bitte.«
Die verantwortungsvolle Angestellte gab auf, buchte, was die Kundin wollte, und Frau Morgenstern flog nach Delhi, reiste ebenso beschwerlich wie unbeirrt weiter nach Goa und fragte an der Rezeption ihres Ein-Sterne-Hotels: »Ich will zum berühmtesten Guru von Goa.« – »Ha!«, lachte der leidgeprüfte Concierge. »Das wollen viele, aber so einfach ist das nicht. Da gibt es Wartezeiten, lange, sehr lange Wartezeiten!«– Frau Morgenstern meinte gelassen: »Das macht gar nichts. Ich warte.« – »Das kann aber gute drei Tage dauern, bis sie eine Audienz bekommen.« Frau Morgenstern verzog keine Miene, drei Tage lang nicht. Ohne zu klagen.
Am vierten Tag, die Kunde von der entschlossenen Frau hatte sich herumgesprochen, kam ein Abgesandter des Gurus ins Hotel und ließ Frau Morgenstern ausrichten: »Sie kann mitkommen. Aber sie muss sich anstellen.« So zogen sie gemeinsam Richtung Guru und Frau Morgenstern sah schon von Weitem eine lange, sehr lange Warteschlange. Geduldig stellte sie sich hinten an, rückte im Zeitlupentempo nach und nach vor und kam näher und näher Richtung Guru.
Zwölf Stunden später, als die Schlange immer kürzer wurde und der Guru schon sichtbar war, kam wieder ein Adlatus und wies Frau Morgenstern streng an: »Sie dürfen nur drei Worte zu ihm sagen. Haben Sie das verstanden? Nur drei Worte!« Die alte Frau nickte.
Endlich war sie dran. Der Guru saß mit geschlossenen Augen direkt vor ihr, vertieft in wichtige Gedanken, und schwieg. Frau Morgenstern wartete geduldig. Nach nur drei Minuten kehrte der Guru aus seiner Trance zurück, riss die Augen erstaunt weit auf und erstarrte. Frau Morgenstern sagte ihre drei Worte: »Moischele, komm heim!«
Wenn ein jüdisches Kind vorhat, erwachsen zu werden, und an ein eigenes Leben oder gar eigene Familiengründung denkt – oj!
Mordechai Blumenfeld hatte seiner Mutter schon so viele Freundinnen vorgestellt, keine war ihr recht. Keine. Friedliebend, wie er war, ersann er schließlich eine List, um dieses Problem endlich in den Griff zu bekommen. Er lud gleich zehn gut aussehende, nette, kluge, junge Frauen ein, um sie seiner Mutter vorzustellen. Um seine wahre Vorliebe zu verschleiern, schäkerte er, bedacht auf gerechte Verteilung, mit jeder von ihnen. Der Abend verlief plangemäß. Mordechai rieb sich schon die Hände.
Am nächsten Tag fragte er verschmitzt seine Mutter: »Nu? Welche werde ich heiraten?« – »Natürlich die Rothaarige!!« Mordechai war sprachlos. »Woher hast du das gewusst??!« Die Mutter wirft ihrem Spross einen mitleidigen Blick zu. »Ich kann sie nicht leiden!«
Und das beweist einmal mehr, dass Jesus Christus Jude war. Er fand kein nettes jüdisches Mädchen zum Heiraten, das seiner Mutter recht gewesen wäre, er lebte viel zu lange zu Hause, und die Mamme war fest davon überzeugt, dass ihr Sohn Gott sei.
Auftritt: Der Tatte!
Im Vergleich zur prototypischen Mamme verblasst der Tatte, der jüdische Vater, zum Nebendarsteller. In wichtigen Dingen sind die Mamme und der Tatte aber oft überraschend im Widerstand vereint:
Schmuel ging zum Rabbiner und fragte ihn um Rat. »Reb Schloime, was soll ich tun? Wie komme ich zu einer Frau, die mir die Mamme nicht ablehnt?« – »Hm. Hmm!!« Reb Schloime war sich der Herausforderung bewusst. Nach langer, reiflicher Überlegung blitzte es schließlich in seinen Augen auf, er hatte die Lösung: »Such dir ein Mädchen, das deiner Mutter ähnlich ist, gegen so eine kann sie nichts sagen.«
Schmuel gefiel der Gedanke, und er machte sich auf die Suche. Reb Schloime war gespannt. Wochen und Wochen hörte er kein Wort mehr von Schmuel, also bestellte er ihn schließlich zu sich: »Nu? Was is?!«
Schmuel seufzte tief. Sehr tief. Und erzählte. »Ich habe genau das gemacht, was der Rebbe geraten hat. Ich habe mir eine Frau gesucht, die fast genauso wie meine Mutter aussieht. Die redet wie sie. Die sich anzieht wie sie. Die sich bewegt wie sie. Die sogar kocht wie sie. Die mich herumkommandiert wie sie!« – »Nu? Nu? Was ist geschehen? Hat sie der Mamme denn nicht gefallen?!« – »Oh, doch«, seufzte Schmuel, »aber der Tatte mag sie nicht.«
Es gibt, was die Schwiegertochterwahl angeht, weitere Komplikationen, vor allem dann, wenn es um nicht-jüdische Frauen, also um Schicksen, geht:
Abrahams Eltern machten sich Sorgen. Er wollte und wollte nicht heiraten. Sie drängten ihn wieder und wieder, doch endlich zur Vernunft zu kommen. Sie schämten sich schon vor all ihren Freunden, deren Söhne da schon weit voraus waren und sogar schon die ersten Enkel geliefert hatten. Sollte ausgerechnet ihr Sohn ein ewiger Junggeselle bleiben?
Dann schienen die Zores vorbei zu sein. Abraham kam mit der Nachricht, dass er sich in ein sehr nettes und hübsches Mädchen verliebt hatte und auch heiraten wollte! Die Auserwählte hatte nur einen kleinen Schönheitsfehler. Helga war keine Jüdin. Abrahams Eltern gefror das Blut in den Adern. Verzweifelt schlugen sie die Hände über dem Kopf zusammen: »Um Gottes Willen! Du willst doch nicht, dass unsere Enkel keine Juden sind!«
Um ihren Liebsten glücklich zu machen, entschloss sich Helga schweren Herzens zu konvertieren und nahm alles auf sich, was dazu erforderlich war. Sie studierte Hunderte und Aberhunderte Seiten der heiligen Schriften, lernte einen koscheren Haushalt zu führen, zu Jom Kippur zu fasten, wirklich köstliche Gefilte Fisch herzustellen und ließ sich, der Vorschrift entsprechend, siebenmal vom Rabbiner abweisen. Helga erschütterte das aber nicht, im Gegenteil, sie wurde immer emsiger. Sie bestand alle Prüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg, konnte den Rabbiner schlussendlich überzeugen und wurde Jüdin. Endlich konnten sie und Abraham heiraten und lebten fortan ein ordentliches jüdisches Leben.
Eines Tages läutete das Telefon. »Abraham, wo bist du?«, fragte der Vater ganz aufgeregt. »Wieso bist du nicht im Geschäft? Wir machen Inventur!« Abraham war sich keiner Schuld bewusst und entgegnete wahrheitsgemäß: »Aber, Papa, heute ist doch Schabbes!« – »Bist du meschigge? Schabbes hin, Schabbes her, ich brauch’ dich im Geschäft! Ich kann ohne dich keine Inventur machen!« – »Was soll ich denn tun?«, fragte Abraham verzweifelt. »Helga lässt mich doch am Schabbes nicht ins Geschäft gehen!« Der Vater war sprachlos und seufzte nur noch aus der Tiefe seiner Seele: »Ich hab’ dir immer schon gesagt, du sollst keine Schickse heiraten!«
Zwar war es im Schtetl und auch noch lange nachher völlig undenkbar, eine Schickse zur Frau zu nehmen. Aber mit dem Gedanken hat so manch einer schon gespielt.
Für Philip Roth schaute beim Schielen zu den Schicksen und bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage sogar eine literarische Karriere heraus. Von Portnoys Beschwerden bis zu seinem Spätwerk ließ ihn das Thema nie los.
Gerhard Bronner, die Wiener Kabarett-Legende, über Jahrzehnte an der Seite hochgewachsener blonder Weiblichkeit zu sehen, erklärte seinen Widerstand gegen jüdische Frauen in Kurzform: »Die durchschauen einen viel zu schnell«, wähnte er sich an der Seite nicht-jüdischer Weiblichkeit auf der sicheren Seite. Durchaus zu Unrecht.
Als ob es das Schlimmste für einen jüdischen Vater wäre, wenn die Schwiegertochter keine Jüdin ist:
Ein verzweifelter jüdischer Vater beschwerte sich bitter bei Gott: »Wie konntest du das zulassen? Mein Sohn hat sich taufen lassen und ist Christ geworden.« Gottes Stimme hallte tröstend aus den Wolken: »Mir ist es genauso ergangen.« Ein Funken Hoffnung regte sich in dem unglücklichen Vater: »Und was hast du dann gemacht?« – »Was werde ich schon gemacht haben?«, tönte die Stimme aus dem Off. »Ein neues Testament.«
Was jüdische Eltern, nicht nur die Mütter, vor allem auszeichnet, ist ihre unerschütterliche Überzeugung, dass ihre Kinder Genies sowie schön sind und nichts und niemand gut genug für sie ist. Alle jüdischen Kinder sind Genies. Wieso? Die Mamme hat es gesagt, aber der Tatte weiß das natürlich auch.
Was das mit den kleinen Genies macht, ist unterschiedlich. Manche Kinder glauben es einfach, auch wenn dieser Glaube trotz aller Bemühungen auf Mamme, Tatte und Kind beschränkt bleibt. Manche der so gestärkten jüdischen Kinder schöpfen daraus allerdings nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch das Vertrauen und den Mut, aus eigener Kraft Großes zu schaffen.
Aber alles beginnt mit der Mamme und ihrer Theorie und Praxis der angewandten Geniekunde:
Frau Rosenberg geht mit ihren zwei kleinen Söhnen im Park spazieren und läuft Frau Goldstein über den Weg, die gar nicht genug Begeisterung über die kleinen Rosenbergs zeigen kann: »Das sind ja so süße Kinder! Wie alt sind sie denn?« – Frau Rosenberg kwellt fin Naches, quillt über vor Freude, und stellt die beiden näher vor: »Hier, der Anwalt ist vier und der Neurochirurg ist zwei.«
Je mehr jüdische Mütter zur selben Zeit im selben Raum zusammentreffen, desto intensiver wird die Mütterolympiade:
Treffen sich gleich drei jüdische Mammes im Kaffeehaus und schwärmen von ihren Söhnen. »Mein Isaac ruft mich täglich zweimal an und fragt, wie es mir geht!« – »Das ist nichts!«, fuhr die zweite dazwischen. »Mein Moischele schickt mir jeden Tag Blumen!« – Die dritte zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Tss. Das ist doch gar nichts! Mein Simon, mein Sießer, geht jeden Tag zum Psychiater.« – »Und was macht er dort?« – Triumphierend antwortet die stolze Mamme nach einer bedeutsamen Pause: »Er redet nur von mir!«
Auch Frau Grün und Frau Blau treffen sich zum mütterlichen Erfahrungsaustausch. Sie haben Wichtiges zu besprechen:
»Mein Sohn, ich sag’s Ihnen«, berichtet Frau Grün, »der verdient so viel Geld und hört nicht auf Geld zu verdienen, es wird schon langsam unheimlich. Die Banken rollen schon den roten Teppich aus, wenn er nur in der Nähe ist. Ganz Warschau könnte er kaufen, wenn er wollte!« – »Ganz Warschau? Sehr beeindruckend«, gibt Frau Blau zu. »Aber wissen Sie, es tät ihm nichts helfen: Mein Sohn verkauft nämlich nicht!«
Der Fairness halber sei erwähnt, die jüdischen Väter stehen den Müttern in ihrem Stolz auf die Kinder um nichts nach:
Ein Tatte erzählt im Freundeskreis von seinen Kindern. »Hab’ ich euch schon erzählt, dass mein Ältester jetzt Professor an der Warschauer Uni geworden ist? Er hat den höchsten Wissenschaftspreis für die Erforschung der südpazifischen Ureinwohner bekommen. Und meine Judith? Nicht nur, dass sie mir die schönsten aller Enkelkinder geschenkt hat, sie ist auch noch als Konzertpianistin in der ganzen Welt gefragt und gibt gerade ein Konzert in der ausverkauften Carnegie Hall. In Amerika!« – »Und was ist mit deinem Jüngsten«, wagt ein aufmüpfiger Zuhörer nachzuhaken. Gedämpft und verschämt antwortet der Tatte: »Ach der, der hat ein Textilgeschäft in Lemberg.« Und kaum hörbar fügt er hinzu: »Unter uns, ohne ihn wären wir schon alle verhungert.«
Es stimmt also, dass alle jüdischen Kinder Genies sind, überhaupt meine, aber wenn man die rosarote Brille der jüdischen Mamme, in Ausnahmefällen auch die des Tatto, absetzt, …
Sitzen drei Juden im Schwitzbad. Krächzt der Erste: »Oj!« – Nach einer Weile krächzt der Zweite womöglich noch herzerweichender: »Oj!« – Darauf unwirsch der Dritte: »Schluss jetzt! Wir haben doch vereinbart, nicht über die Kinder zu reden!«
Sterben – Chewra Kadischa
Irgendwann sind die Kinder erwachsen, die Enkelkinder produziert, und das Ende des Lebenszyklus naht. Hier spielt dann die berühmteste aller jüdischen Untergrundbewegungen eine tragende Rolle: die Chewra Kadischa, der religiöse Bestattungsverein.
An dieser Stelle fällt zunächst der Ordnung halber der unvermeidliche Klassiker an, den wohl jeder kennt, der schon einmal mit einem jüdischen Witz in Berührung gekommen ist:
Es dauerte nicht mehr lange, und Feiwisch war so weit, seinen letzten Atemzug zu tun. Die Familie versammelte sich traurig um sein Sterbebett, um seine letzten Stunden zu begleiten. Mit immer leiser werdender Stimme fragte er: »Rifka, meine geliebte Frau, bist du da?« – »Ja, mein geliebter Mann, ich bin da!« – »Sara, meine geliebte Tochter, bist du da?« – »Ja, Tatte, ich bin da!« – »Judah, mein geliebter Sohn, bist du da?« – »Ja, Tatte, ich bin da!«
Mit einem Ruck, den man dem kraftlosen, sterbenden Feiwisch nicht mehr zugetraut hätte, richtete er sich verzweifelt auf und rief: »Und wer ist dann im Geschäft???!«
Gut. Hätten wir das auch erledigt.
Marcus Rubinstein saß zu Hause und rief die Chewra Kadischa an. Seine Frau war gestorben. »Hier Marcus Rubinstein. Wer spricht dort?« – »Joel Weinstein. Bist du’s Marcus? Marcus Rubinstein aus Kolomayja? Ich glaub’ es nicht! Schon lange nichts von dir gehört. Seit mindestens zehn Jahren. Was ist los?« – »Joel. Gut, dass du es bist. Meine Frau Sara ist gestorben.« – »Ich wusste ja gar nicht, dass du geheiratet hast.« – »Ja, vor fünf Jahren habe ich meine wunderbare Sara kennen- und lieben gelernt und sie geheiratet.« Darauf Weinstein: »Also zuerst einmal: Mazl tov!«
Es ist bei Juden Vorschrift, die Verstorbenen vor der Schiwe, der siebentägigen Trauerversammlung, möglichst schnell, normalerweise innerhalb von 24 Stunden, zu begraben. Außerdem ist es üblich, dass man einen Verstorbenen erst dann begraben darf, nachdem ein Rabbiner oder zumindest irgendein Redner bei der Hesped, der Totenrede, irgendetwas Gutes über ihn gesagt hat.
Diese Anforderungen, gemeinsam mit dem Zeitdruck, können sich manchmal als schwierig gestalten:
In Galizien starb ein richtig brutaler, geiziger, egoistischer Mann. Sein ganzes Leben lang hatte er die Leute belogen und betrogen, hatte nie Bedürftige unterstützt, und es fand sich beim besten Willen niemand, der fähig oder bereit war, etwas Gutes über ihn zu sagen, nicht einmal der Rabbiner. Nach einigen Tagen verbreitete sich schon der Duft des Verblichenen. Und immer noch fiel absolut niemandem irgendetwas Gutes ein, das sie über den Toten sagen hätten können.
Schließlich griff der Rabbiner, um das Wohl der noch Lebenden besorgt, durch und quälte sich das Beste, das er dem Toten nachsagen konnte, ab: »Er hat lieb gehabt Mohnniddelach«. Das inspirierte. »Und«, rief der Nächste, »er war besser als sein Bruder!«
Juden wünschen einander »ad mea esrim«, sprich 120 Jahre alt sollst du werden, um zu bezeugen, wie herzlich ihre Wünsche sind und wie lebensbejahend sie an die Härten ihres Alltags herangehen.
Und dann geschah es, dass Jankele mit 119 Jahren starb. Am Grabstein war zu lesen: »Jakob ben Nathan. Viel zu früh und völlig unerwartet ward er aus dem Leben gerissen.«
Am Ende des Tages:
Wozu braucht ein Jude eigentlich Füße? Er wird geboren und liegt – in den Armen der Mamme. Zur Brith Milah, der Beschneidung, wird er getragen. Zur Bar Mitzwa wird er geführt. Zur Chassene, der Hochzeit, wird er geschleppt. Zu Grabe wird er wieder getragen. Also wozu braucht er dann Füße? – Weil: In den Konkurs geht er!