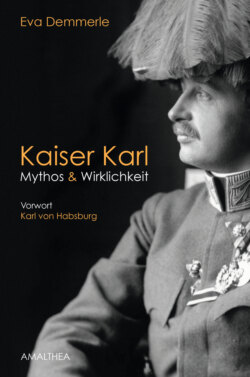Читать книгу Kaiser Karl - Eva Demmerle - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf dem Weg in den Krieg
ОглавлениеDie politische Landkarte Europas
Österreich-Ungarn war ein kompliziertes Gebilde. 17 Nationalitäten lebten in unterschiedlich ausgeprägter Staatlichkeit unter dem Dach der habsburgischen Dynastie. Die vielen Volksgruppen und Nationalitäten zu regieren, war schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist richtig, dass viel, auch innerhalb der Monarchie in den letzten Jahren vor dem Krieg, von einem drohenden Untergang gesprochen wurde, aber faktisch wies nichts darauf hin. Vor 1914 hatte es keinerlei revolutionäre Stimmung gegeben.10 Der ökonomische Aufschwung, der ganz Europa durch die Industrialisierung erfasst hatte, hatte auch Österreich einen neuen Wohlstand beschert. Die wirtschaftliche Kraft des Österreich vor 1914 wurde erst in den 1950er-Jahren wieder erreicht. Gleichzeitig förderten die Vielfalt und das Nebeneinander der Nationalitäten eine außerordentliche kulturelle Blüte. Die Klammer dieses Vielvölkergemischs war die Dynastie. Wenn Kaiser Franz Joseph sagte: »Ich habe dann gut regiert, wenn alle meine Völker gleichermaßen unzufrieden sind«, so bedeutete dies, dass zu einer guten Regierung dieses multinationalen Staates viel Fingerspitzengefühl, Takt und Rücksichtnahme notwendig waren. Streitigkeiten konnten immer wieder beigelegt werden, und der Mährische Ausgleich von 1905 zeigte in Bezug auf die Nationalitätenvertretung in die richtige Richtung. Generell war das »alte« Österreich ein liberaler Staat,11 der dem Einzelnen und den Volksgruppen viele Freiräume geboten hat. Die »checks and balances« mussten zwar immer wieder neu gefunden werden, aber in seiner ganzen Sensibilität war das System bemerkenswert stabil.
Notwendige Reformschritte wurden von den Eliten intensiv diskutiert. Vor allem die Staatsstruktur infolge des Ausgleichs mit Ungarn war Gegenstand permanenter Überlegungen. Der Ausgleich aus dem Jahr 1867 hatte das Verhältnis zu den Ungarn geklärt, aber eben nur zu den Ungarn. Teilweise widersprachen sich sogar die Verfassungen der beiden Reichshälften, Cisleithanien (Österreich) und Transleithanien (Ungarn). Zudem wachten die ungarischen Magnaten, die einen Großteil der Macht in ihren Händen hielten, eifersüchtig über den Erhalt ihrer Privilegien. Das ungarische System trug noch immer feudalistische Züge, der slawische Bevölkerungsanteil war im ungarischen Parlament stark unterrepräsentiert. Dieses System des Dualismus beförderte die Frustration der slawischen Völker. Vergeblich hatten die Tschechen gehofft, dass die Länder der Wenzelskrone im Staatskonstrukt adäquat berücksichtigt würden. Der Nationalismus, die große Welle des 19. Jahrhunderts, machte auch vor Österreich nicht halt. Panslawistische Bewegungen konnten unter diesen Bedingungen rasch zu einer politisch relevanten Größe heranwachsen, dies vor allem im Süden des Reiches. Und damit wurde die Innenpolitik auch relevant für die Außenpolitik.
Mit dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bund 1866 und dem vorherigen Ausschluss aus Italien hatte sich der Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik auf den Balkan verschoben. Da das Osmanische Großreich zunehmend Schwäche zeigte, jonglierten vor allem Russland und Österreich-Ungarn um ihre Einflusssphären. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatten beide Großmächte verschiedenste Vereinbarungen getroffen, ihre jeweiligen Interessen auf dem Balkan zu berücksichtigen. Der Schlüsselpunkt für Österreich war Serbien, welches sich aber nach dem Königsmord an den habsburgfreundlichen Obrenovic im Jahr 1903 mit der neuen Dynastie der Karadordevic zunehmend mehr an Russland anlehnte. Der Panslawismus entwickelte sich als bestimmende Kraft. Serbien sah sich als Keimzelle eines mächtigen südslawischen Reiches gegen die als moribund empfundenen Großmächte Osmanisches Reich und Österreich-Ungarn. Der serbische Nationalismus war eine Idee, die auch außerhalb der engen Grenzen des kleinen Königreichs zündete. Ganz Serbien war voll von kleinen und kleinsten Agitationsgruppen, die zum Teil mit Wissen der Regierung ihre Zündelei betrieben, sogar oftmals unter der Hand personell und materiell unterstützt.
Die dauernden Balkankrisen spielten sich vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konfrontationspolitik der europäischen Staaten ab. Das Deutsche Reich, das seit der Reichsgründung 1871 eine kraftvolle wirtschaftliche Entwicklung genommen hatte, strotzte vor Energie und forderte mit seiner Flottenrüstung und dem kolonialen Streben nach einem »Platz an der Sonne« die traditionelle Seemacht Großbritannien heraus. Dazu kamen die Taktlosigkeiten und diplomatischen Ungeschicklichkeiten Kaiser Wilhelms, der sich zwar in martialischen Reden gefiel, aber in Wirklichkeit den Krieg fürchtete. Großbritannien war entschlossen, seine Seemacht gegenüber Deutschland um jeden Preis zu verteidigen, und der 1904 gelungene Ausgleich mit Frankreich (»Entente Cordiale«) machte nicht nur die Abkehr von der klassischen Linie der »splendid isolation« deutlich, sondern galt auch als ein beträchtlicher diplomatischer Triumph über Berlin. Seit etwa 1910 war überdies klar, dass die deutsche Flottenrüstung die Vormacht der Grand Fleet nicht brechen konnte. Frankreich sann unerbittlich auf Revanche, um vom Deutschen Reich die 1870/71 verlorenen Provinzen Elsass und Lothringen zurückzugewinnen. Das Gleichgewicht der Kräfte, das einst von Metternich kunstvoll gesponnen worden war, war nicht mehr vorhanden. Bismarck hatte, natürlich aus einer sehr deutschen Sicht heraus, die immer den eigenen Vorteil im Blick hatte, eine geschickte Bündnispolitik geführt. Das System, welches er installierte, war zwar der Struktur nach ein konfrontatives, doch blieb es dank seiner Genialität immer noch elastisch – auch durch den Rückversicherungsvertrag, den das Deutsche Reich mit Russland geschlossen hatte. Nach Bismarcks Entlassung war in Berlin niemand mehr, der, wie der neue Kanzler General Leo von Caprivi zugab, mit acht Bällen gleichzeitig jonglieren konnte.
Spätestens seit Russland den Krieg 1905 in Ostasien gegen das aufstrebende japanische Kaiserreich verloren hatte, gewannen in St. Petersburg die Panslawisten so stark an Boden, dass man von einer mächtigen Kriegspartei sprechen konnte. Nirgendwo war das politisch rückständige Russland so populär wie auf dem Balkan, von dem sich das Osmanische Reich trotz zähen Widerstandes immer weiter zurückziehen musste. Während der Zarenthron innenpolitisch mit dem Rücken an der Wand stand und schwere Unruhen wie im Jahr 1905 fürchten musste, gelang außenpolitisch eine bisher kaum für möglich gehaltene Annäherung an Frankreich. Die Entente Cordiale von 1891, in der man sich gegenseitige diplomatische Unterstützung versprach, die im Jahr darauf folgende Militärkonvention und die gemeinsame Flottenkonvention von 1912 sind wesentliche Meilensteine dieser Entwicklung, die letztlich durch die Furcht vor dem mächtigen Deutschen Reich möglich gemacht wurde. Henry Kissinger bezeichnet diesen Koalitionsalbtraum Bismarcks als die Wasserscheide Europas auf dem Weg in den Krieg und den Anfang vom Ende der Balance of Power.12
Unterhalb der Schwelle einer Großmacht, aber als Zünglein an der Waage von beiden Seiten begehrt, betrieb das 1870/71 im Schatten des deutsch-französischen Krieges geformte Königreich Italien eine ehrgeizige Politik. Obwohl mit Österreich-Ungarn im Dreibund zusammengeschlossen, hatte das Königreich des Hauses Savoyen die Hoffnung auf den Anschluss der italienisch sprechenden Gebiete Österreich-Ungarns, vor allem Trient und Triest mit dem Hinterland, nie wirklich aufgegeben. Auf dem Balkan widersetzte sich Rom dem serbischen Streben zur Adriaküste und erhob Ansprüche auf Albanien. Der deutsche Partner im Dreibund war zugleich Vorbild beim Streben nach einem »angemessenen« Kolonialreich. Die italienischen Augen richteten sich auf die Ägäis und vor allem nach Afrika.
Die Bündnisse, die Otto von Bismarck eingefädelt hatte, vor allem der Rückversicherungsvertrag mit Russland aus dem Jahre 1887 und die Einbindung Italiens im Dreibund 1882, sollten vor allem defensiven Charakter haben. Der Berliner Kongress 1878 vermochte die politische Landschaft Europas auf Jahrzehnte zu stabilisieren. Das Deutsche Reich und Österreich näherten sich wieder an, und mühsam konnten Österreich und Russland sich über einen Interessenausgleich auf dem Balkan einigen. Kaiser Wilhelms Politik der freien Hand und der militärischen Stärke untergrub hingegen schrittweise die Fundamente der Bismarck’schen Friedensstrategie. Die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrages mit Russland in 1890 war ein böses Omen für die Zukunft. Das diffuse Gefühl, ein großer Krieg sei nicht mehr zu vermeiden, sondern nur noch eine Frage der Zeit, gewann eine fatale Eigendynamik. Vielfach herrschte das Gefühl, die Zeit arbeite gegen einen und man würde den günstigsten Kriegstermin verpassen. Dies trifft sowohl für den deutschen als auch den russischen Generalstab zu. Die deutschen und französischen Heeresvorlagen des Jahres 1913 belegen den sich zuspitzenden Rüstungswettlauf der europäischen Mächte. Fatal war auch die Einschätzung über die Natur des Krieges, vielfach herrschte dennoch die »Mann-gegen-Mann-Mentalität« vor, die man aus dem Krieg von 1870/71 kannte. Niemand rechnete mit den Technologien, die die Kriegsherren nun in den Händen hielten.
Henry Kissinger analysierte: »Um 1910 waren anstelle des Gleichgewichts der Kräfte zwei feindliche Bündnisse getreten, deren Unbeweglichkeit der Leichtfertigkeit, die diese überhaupt erst hatte entstehen lassen, in nichts nachstand. Russland war an Serbien gebunden, in dem es von nationalistischen oder sogar terroristischen Splittergruppen nur so wimmelte und das sich keinerlei Sorgen um die Risiken eines Krieges machte: Es hatte nichts zu verlieren. Frankreich hatte Russland, das nach dem russisch-japanischen Krieg um die Wiederherstellung seiner Selbstachtung rang, eine Art Freibrief ausgestellt. Ähnlich verhielt sich Deutschland gegenüber Österreich, das seine slawischen Provinzen verzweifelt gegen serbische Agitation zu schützen suchte, die wiederum durch Russland unterstützt wurde. Die europäischen Staaten hatten sich in die Abhängigkeit von den Wirren des Balkan begeben.«13
Die Rolle der beiden Thronfolger
Die politische Konstellation war auch dem Thronfolger Franz Ferdinand bewusst. Innerhalb wie außerhalb der kaiserlichen Familie war er eine polarisierende Person. Kaiser Franz Joseph hielt ihn auf Distanz, hatte er doch seine Schwierigkeiten mit dem als aufbrausend und stur geltenden Neffen. Beharrlich hatte dieser, ohne Rücksicht auf das Familienstatut und dynastische Notwendigkeiten, an der Wahl seines Herzens festgehalten und die Eheschließung mit Gräfin Sophie Chotek durchgesetzt. Seine Gattin stammte zwar aus altem böhmischen Adel, war aber nach habsburgischem Hausgesetz bei Weitem nicht standesgemäß. Daher hatte Franz Ferdinand am 28. Juni 1900 mit einem feierlichen Renuntiationseid in der Geheimen Ratsstube der Wiener Hofburg auf die Thronfolge für seine Kinder und Kindeskinder verzichten müssen. Durch diesen Verzicht wurde der zu diesem Zeitpunkt 13-jährige Erzherzog Karl der Nächste in der Thronfolge.
Mit Sophie, die am Tag der Hochzeit, dem 1. Juli 1900, zur Fürstin von Hohenberg, später zur Herzogin von Hohenberg erhoben wurde, führte Franz Ferdinand eine überaus glückliche Ehe. Das Paar bekam drei Kinder: Max, Ernst und Sophie. Bei Hofe jedoch, wo das strenge spanische Hofzeremoniell galt und so viele in ihren eigenen Stand verliebt waren, erfuhr die Herzogin von Hohenberg so manche Demütigung. Besonders Obersthofmeister Fürst Montenuovo bestand immer wieder darauf, die Herzogin protokollarisch weit hinter ihrem Mann zu platzieren. Repräsentative Auslandsreisen waren ebenso schwierig, da auch die anderen Höfe Europas die Ehe des Erzherzog-Thronfolgers als Mesalliance betrachteten. Später übernahm Erzherzog Karl wichtige Repräsentationspflichten, beispielsweise die Reise nach London zur Krönung König Georg V im Juni 1911.
Franz Ferdinand war ein zutiefst politischer Mensch, allerdings wurde ihm der Zugang zu den politischen Entscheidungen des Reiches durch seinen kaiserlichen Onkel zunächst verwehrt. Dafür aber widmete er sich intensiv dem Militär und eignete sich intensive und vertiefte Kenntnisse an. 1906 wurde er zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht ernannt. Auf diesem Gebiet schätzte Kaiser Franz Joseph durchaus die Meinung und die Fähigkeit seines Neffen.
Unablässig machte Franz Ferdinand sich Gedanken über die notwendige Reform des Reiches und diskutierte diese mit den Mitgliedern der Militärkanzlei, die eine Art Gegenregierung war, im Schloss Belvedere. Im Gegensatz zum liberalen Kaiser Franz Joseph war er ein echter Konservativer. Im Falle seiner Regierungsübernahme hätte er eher eine konservative Wende herbeigeführt als eine wirkliche Liberalisierung des Reiches.14 Den Ausgleich von 1867 mit den Ungarn sah er durchaus kritisch und diskutierte darüber immer wieder mit dem Kaiser. Das Wort von Franz Ferdinand als »Seiner Majestät getreueste Opposition«15 machte die Runde. Vielfach wurde behauptet, dass Franz Ferdinand den Dualismus zugunsten eines Trialismus brechen wollte, doch viel mehr lag ihm daran, die ungarischen Privilegien, die einer gemeinsamen gedeihlichen Entwicklung des gesamten Staatswesens entgegenstanden, zurückzuschrauben und den anderen Nationalitäten, insbesondere den Slawen, mehr Eigenständigkeit zu geben. Die oft zitierte Abneigung gegen die Ungarn richtete sich nicht gegen das ungarische Volk, sondern gegen die ungarischen Politiker, die die ungarischen Privilegien eisern verteidigten.
Wesentlich ist aber vor allem, dass Franz Ferdinand im außenpolitischen Bereich zu den »Tauben« gehörte. Zum »Falken« Conrad von Hötzendorf hatte er ein durchaus gespaltenes Verhältnis und lehnte dessen Befürwortung eines Präventivkrieges gegen Serbien und Italien ab. Zu diesem Zeitpunkt hielt Franz Ferdinand einen Krieg nicht für richtig, da für ihn die innenpolitischen Reformen Priorität16 besaßen.
Im Laufe der Jahre konnte sich Franz Ferdinand bedeutenden Einfluss auf die Politik erarbeiten. Die Rolle des Thronfolgers war nicht genau definiert, aber mit viel Geschick und guten Mitarbeitern gelang es ihm, mit seiner Militärkanzlei im Unteren Belvedere ein eigenes Machtzentrum zu installieren. In den letzten Jahren ging nahezu jede Personalentscheidung über seinen Tisch, und über diese verfügte Franz Ferdinand gerade im außenpolitischen Bereich erheblichen Einfluss.17
Mit seinem Neffen Karl verband ihn ein freundschaftlichväterliches Verhältnis, und er zeigte reges Interesse an dessen Ausbildung. Auch Karl brachte Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie große Zuneigung und Respekt entgegen. An der Seite seines Onkels nahm er an verschiedenen Kaisermanövern teil und gewann dadurch Einblick in die Aufgaben eines höheren Kommandos. Zwischenzeitlich hatte er seine staatswissenschaftlichen Studien in Prag erfolgreich und mit Auszeichnung beendet. Im Frühjahr 1908 kehrte er wieder zurück zur 5. Eskadron der 7er Dragoner in Altbunzlau, die im März 1912 nach Kolomea in Ostgalizien verlegt wurde. Am 1. November 1912 wurde er zum Major im Infanterieregiment Nr. 39 ernannt und übernahm das Kommando des 1. Bataillons in der Stiftskaserne zu Wien. Seine Interessenschwerpunkte im militärischen Bereich lagen vor allem in der Weiterentwicklung eines gut funktionierenden Fernmeldesystems sowie der Artillerie. Intensiv aber kümmerte er sich um die Luftfahrt, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich, im Gegensatz zu Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand, der vor allem der Waffengattung der Marine verbunden war.
An die Öffentlichkeit trat der junge Erzherzog kaum. Hin und wieder übernahm er Repräsentationspflichten. Seine Funktionen in der Armee waren eher unspektakulär, und er vermisste die geistige Herausforderung nach den intensiven Jahren seines Studiums. Am 21. Oktober 1911 heiratete er Prinzessin Zita von Bourbon-Parma. Für beide eine Liebesehe – aber durchaus auch sehr begrüßt von Kaiser Franz Joseph, angesichts der zahlreichen Mesalliancen innerhalb der Familie. Das Paar nahm zunächst Wohnung in Brandeis an der Elbe, nach der Versetzung begleitete Zita ihren Mann nach Ostgalizien, und wieder zurück in Wien wurde ihnen vom Kaiser Schloss Hetzendorf unweit von Schönbrunn als Wohnung zugewiesen. Im November 1912 hatte Zita ihr erstes Kind geboren. Die Nachricht von der Geburt des kleinen Otto brachte Karl als künftigen Thronfolger wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Dennoch konnte die kleine Familie ihr Privatleben weitestgehend ungestört genießen.
Karl war klug genug, um in politischen Dingen offiziell Abstinenz zu üben. Zum einen spielte sicherlich die Überlegung eine Rolle, dass er angesichts des noch lebenden Kaisers Franz Joseph und des sich in seinen Vierzigern befindenden Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand noch einige Jahrzehnte Zeit haben würde, bis ihm die politische Verantwortung des Thrones zufallen würde. Davor aber würde er lange Jahre als Thronfolger unter den aufmerksamen Augen eines Kaisers Franz Ferdinand verbringen. Zum anderen beobachtete er natürlich die Konkurrenzsituation und die damit verbundene Intrigenwirtschaft zwischen der Hofburg und der »Gegenregierung« der Militärkanzlei in Schloss Belvedere. Ein drittes Machtzentrum in Schloss Hetzendorf war für ihn nicht denkbar. Er fühlte Loyalität sowohl zum Kaiser als auch zu Franz Ferdinand. Politische Abstinenz hieß aber nicht, dass Karl sich nicht seine eigenen Gedanken zur Situation des Reiches machte. Die Notwendigkeit von Reformen war damals allgemeiner Diskussionsgegenstand. Die ganze Gesellschaft diskutierte das Für und Wider von Dualismus, Trialismus, Verwaltungsgrenzen, Zentralisierung oder Dezentralisierung.
Seine Frau Zita erinnerte sich: »Zum ersten Mal hörte ich von ihm seine Ideen über die Monarchie im April 1911, als wir uns eben verlobt hatten und der Thron noch in weiter Ferne schien. […] Er sagte mir: ›Der Dualismus ist nicht zu retten. Trialismus aber ist nicht gerecht und geht überhaupt nicht weit genug. Die einzige Lösung ist eine echt föderative, um allen Völkern gleiche Möglichkeiten zu geben.‹ Das umriss genau seine Haltung, und er ging nie von ihr ab. […] Bei einer anderen Gelegenheit hörte ich ihn sagen, als er über die Pflichten eines Kaisers sprach: ›Ein Vater macht zwischen seinen Kindern keinen Unterschied.‹ […] Wir hatten nicht weniger als 17 Nationalitäten, wenn man die kleinen ebenso mitzählt wie die elf Hauptgruppen. Er war entschlossen, allen 17 die individuelle Freiheit zu geben, falls sie dies wünschten, zum Beispiel Bosnien und die Herzegowina ebenso unabhängig von Kroatien zu machen wie dieses natürlich von Ungarn. Und er ging noch weiter. Kaiser Karl betonte mir gegenüber stets, es würde auch nichts ausmachen, wenn die eine oder andere Nation im Laufe der Entwicklung sich als Republik erklären wolle. Er meinte, dass die drei Hansestädte ja schließlich Republiken innerhalb des Deutschen Reiches seien. Die wesentliche Sache war für ihn, dass die Völker, was immer auch sie für eine konstitutionelle Form wählen würden, ihre Bindung mit der Monarchie und ihre Zugehörigkeit zum Staat als Ganzes beibehalten sollten.«18
Insgesamt herrschte zwischen Karl und Franz Ferdinand ein gutes Einvernehmen, und Karl gewann rasch eine Vertrauensstellung bei seinem Onkel. Gemeinsam diskutierte man über Reformpläne und über den Umbau der Monarchie. Oft waren Karl und Zita bei Franz Ferdinand und der Herzogin von Hohenberg zu Gast. Im Mai 1914 kam es dabei zu einem seltsamen Gespräch, von dem Zita berichtete:
»Ein erschreckend düsteres, tödlich ernstes Bild entstand eines Abends im Verlaufe einer Einladung ins Obere Belvedere. Schon während des Essens im kleinsten Kreis – außer uns beiden waren nur die Kinder Franz Ferdinands zugegen gewesen – fiel uns die seltsame Stimmung des Thronfolgers auf, sie schien auf etwas Bestimmtes konzentriert zu sein. Als die Herzogin von Hohenberg die Kinder fortführte, um sie schlafen zu legen, sagte Franz Ferdinand nach kurzem Schweigen: ›Ich muss euch von einer Sache Mitteilung machen. Ich werde demnächst ermordet werden!‹ Der Erzherzog-Thronfolger hatte leise, aber vollkommen klar gesprochen. Ein Missverständnis war ausgeschlossen. Wir beide blickten Franz Ferdinand entsetzt, ja verstört an. Endlich sagte Erzherzog Karl, so, als wolle er den Bann des eben Gehörten brechen, als wolle er durch eine absurde Widerlegung das Absurde des eben Gehörten aufheben: ›Aber Onkel, das ist doch nicht möglich! Und überhaupt: Wer würde denn ein solches Verbrechen begehen!‹ Obwohl nur Karl gesprochen hatte, richtete der Thronfolger die Antwort, seltsam autoritär, an uns beide: ›Widerspricht mir nicht! Ich weiß es ganz sicher. In wenigen Monaten bereits werde ich ermordet werden!‹ In die Sekunden des Schweigens hinein, die nun folgten, sagte der Thronfolger mit klarer, sachlicher Stimme: ›Karl, für dich liegen in einem verschlossenen Kasten bestimmte Papiere. Sie gehören nur für dich, nimm sie nach meinem Tod an dich. Es sind Pläne, Gedanken, Vorstellungen. Vielleicht sind sie dir von Nutzen. Wie ihr wisst, ist in Artstetten alles vorbereitet, die Gruft wartet. Demnächst werde ich dorthin gebracht werden.‹«19
Der 28. Juni 1914
Die Reise nach Sarajevo war der erste gemeinsame offizielle Auftritt von Franz Ferdinand und Sophie innerhalb der Monarchie. Franz Ferdinand selbst hatte kein gutes Gefühl vor dieser Reise. Er scheint dies auch mit Kaiser Franz Joseph besprochen zu haben, der allerdings seinem Neffen selbst die Entscheidung überlassen hatte, ob er fahren wolle oder nicht.20 Die ersten Tage des Aufenthalts in Bosnien ab dem 25. Juni verliefen ohne Probleme. Der 28. Juni war der letzte Tag des Besuches. Sarajevo war voller Menschen. Über Bedenken bezüglich der Sicherheitslage setzte man sich hinweg, Landeschef Potiorek verzichtete auf den Einsatz von Militär für den geplanten Autokorso durch die Innenstadt.
Bereits auf der Hinfahrt zum Rathaus wurde eine Bombe auf das Auto des Thronfolgers geworfen, verfehlte aber ihr Ziel und landete unter dem nächsten Fahrzeug. Es gab einige Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach kurzer Unterbrechung fuhr der Konvoi weiter zum Rathaus. Letztlich kann man die folgenden Entscheidungen als waghalsig bezeichnen. Anstatt das Programm abzuändern, entschied man sich für die Fortsetzung der Fahrt, Franz Ferdinand lehnte sogar die Räumung der Straßen ab. Lediglich die Route sollte etwas abgeändert werden, allerdings wurde diese Veränderung nicht an den Fahrer weitergegeben. Gerade als bemerkt wurde, dass die Route falsch war und der Konvoi an der Lateinerbrücke zum Stehen kam, sah der Attentäter Gavrilo Princip seine Chance und schoss. Zuerst traf er die Herzogin, mit dem zweiten Schuss den Thronfolger. Eiligst wurden die Verletzten in den Konak gefahren, doch man konnte nichts mehr für sie tun.21 Sie starben kurz hintereinander.
Die Nachricht von der Ermordung des Thronfolgers und seiner Frau erreichte Karl und Zita eben, als sie im Garten der Villa Wartholz in Reichenau beim Mittagessen saßen. Per Telegramm teilte Baron Rumerskirch, der Adjutant von Erzherzog Franz Ferdinand, mit: »Bedaure zutiefst, melden zu müssen, Erzherzog Franz Ferdinand und Gemahlin sind hier ermordet worden.« Karl ließ sich sofort mit Kaiser Franz Joseph, der wie jedes Jahr die Sommerzeit in Bad Ischl verbrachte, telefonisch verbinden, um sich über die schrecklichen Nachrichten Sicherheit zu verschaffen. Der Kaiser bat, ihn am Bahnhof in Wien zu erwarten, und wenige Stunden später fuhren beide gemeinsam nach Schönbrunn. Im Auto sagte der Kaiser zu seinem Großneffen: »Auf dich kann ich mich auf jeden Fall verlassen.«
Europa war erschüttert über die Nachricht vom Attentat. Aus London und Berlin kamen entsetzte und anteilnehmende Telegramme. Das Entsetzen war auch in Österreich groß, wenn sich auch die gesellschaftliche Trauer in Grenzen hielt; Franz Ferdinand war nicht sehr beliebt gewesen. Auch ungarische Regierungskreise waren nicht unglücklich, aber alle teilten den Eindruck, dass der Fürstenmord ein tief einschneidendes Ereignis war. Eine wichtige Perspektive der Monarchie schien verloren, der Träger von Ideen und Erwartungen war nun nicht mehr.
Die darauffolgenden Tage waren für Karl von den Trauerfeierlichkeiten für seinen toten Onkel und dessen Gattin geprägt. Am 2. Juli erwarteten Karl und Obersthofmeister Fürst Montenuovo die beiden Särge am Südbahnhof und geleiteten sie zur Hofburg. Dem Kondukt schlossen sich spontan zahlreiche Offiziere und Adelsvertreter an. Kritiker monierten das angeblich minderwertige Zeremoniell für die Fürstin, doch Kaiser Franz Joseph hatte für sie das gleiche Zeremoniell angeordnet wie für seine 1898 ermordete Gattin Elisabeth. Am 4. Juli erfolgte die Beisetzung in der Gruft von Schloss Artstetten, auch hier nahmen Karl und Zita teil.
Schwerer als ein angeblich zu niedriges Zeremoniell wog allerdings die Entscheidung, die Beerdigung sozusagen im »Familienkreis« zu organisieren. Kaiser Wilhelm hatte geplant, zur Beerdigung anzureisen, aber Wien hatte abschlägig entschieden. Kein einziges Staatsoberhaupt, kein einziger Regierungschef nahm teil. So wurde eine Chance vergeben. Am Rande der Feierlichkeiten wäre es zu politischen Gesprächen gekommen, die den Verlauf der kommenden Wochen sicherlich bestimmt hätten.
Der Juli 1914 war geprägt von einer unheilvollen Dynamik, die sich zwischen dem Dreibund einerseits und der Entente Cordiale andererseits aufschaukelte. Deutschland gab Österreich einen »Freibrief« für eine Strafmaßnahme gegen Serbien. Am 19. Juli richtete Wien ein Ultimatum an Belgrad – und ging immer noch von einem lokalen Konflikt aus. Die Serben wiederum hielten sich an Russland und lehnten das Ultimatum ab. Die österreichische Kriegserklärung an Serbien vom 28. Juli löste eine Kettenreaktion aus. Binnen weniger Tage befand sich Europa im Krieg.
Verwendung Karls im Krieg
Erzherzog Karl fand sich nun in der Rolle des Thronfolgers wieder, womit er eigentlich erst in einigen Jahrzehnten gerechnet hatte. Er versuchte noch rasch, die für ihn vorgesehenen Akten von Franz Ferdinand zu bekommen. Allerdings wurden diese von der Umgebung Franz Ferdinands rasch verschlossen und die Militärkanzlei aufgelöst. Man dachte nicht einmal daran, die Kanzlei dem neuen Thronfolger zur Verfügung zu stellen. In die politischen und militärischen Beratungen vor Kriegsbeginn wurde er in keiner Weise eingebunden. Für Conrad von Hötzendorf und Erzherzog Friedrich war er einfach keine Größe. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass Kaiser Franz Joseph ihn von allem unbelastet wissen wollte, wohl ahnend, dass er selbst das Ende des Krieges nicht erleben würde und es seinem Nachfolger bestimmt sei, den Krieg zu beenden.
Es stellte sich nun die Frage der Verwendung Karls. Bei Hofe gab es verschiedenste Gruppen, die den alten Kaiser entsprechend zu beeinflussen versuchten, welches die besten Aufgaben für seine Nachfolger seien. Seinen ersten Fronteinsatz erlebte Karl im Armeeoberkommando in der Festung Przemysl in Galizien für nur wenige Wochen. Zu Conrad, der versuchte, ihn von allen Informationen fernzuhalten, hatte er kein positives Verhältnis. Die Geheimniskrämerei von Conrad war auch nicht nur auf den Thronfolger beschränkt, sondern es gehörte zu seinem persönlichen Stil, Informationen zurückzuhalten, auch gegenüber Wien. Nicht zuletzt konnte Karl in dieser Zeit beobachten, wie eng sich die österreichische Armeeführung an die deutsche anlehnte. Aus dieser Zeit behielt sich Karl sein negatives Bild vom Generalstab zurück, was seine Politik unmittelbar nach seiner Regierungsübernahme erklärt.
Im Herbst 1914 verfügte Kaiser Franz Joseph, dass Karl Verbindungsoffizier zwischen dem Kaiser und den Truppen werden sollte. Auf diese Art und Weise sammelte er in den nächsten Monaten Fronterfahrung und erfuhr die schmutzige Realität des Krieges, ohne einer direkten Gefahr ausgesetzt zu sein. Dem Kaiser war die Situation wohl bewusst: »Ich bin ein Greis und Otto ist ein Kind. Was geschieht, wenn dir etwas passiert?« Während Karls Heimataufenthalte wies Kaiser Franz Josef ihn selbst in die Regierungsangelegenheiten ein. Ebenso mussten die Minister ihre Berichte nicht nur dem Kaiser vortragen, sondern auch dem jungen Erzherzog. Kaiserin Zita:
»Der Kaiser gab täglich, entweder am Abend oder morgens, Erzherzog Karl eine Anzahl Akten, damit er sie erledige. Am nächsten Tag, wenn mein Mann berichtete, welche Entscheidungen er getroffen oder empfohlen hatte, befragte ihn der Kaiser über seine Gründe und besprach mit ihm die Schlussfolgerungen. So eng und so regelmäßig wurde dieser Kontakt, dass eine ziemlich große Gruppe von Leuten am Hofe zu protestieren begann, der Erzherzog bliebe zu lange in Wien, er solle seine Zeit besser an der Front verbringen. Die daran Beteiligten waren hauptsächlich die früheren Berater Franz Ferdinands, obgleich auch Conrad wünschte, dass Erzherzog Karl ›unter Beobachtung‹ ins Armeehauptquartier zurückkehre und sich nicht außerhalb seiner Reichweite in der Hauptstadt aufhalte. All dies bedeutete für den Kaiser ein Dilemma. Er selbst war Soldat, und das war auch sein Großneffe. Trotzdem wünschte er seinen Nachfolger in seiner Nähe zu haben.«22
Im Gegensatz zu seinem Onkel Franz Ferdinand wählte Karl den Weg, sich politisch bedeckt zu halten. Als Thronfolger hatte er keine originären Kompetenzen. Und einen Machtkampf mit dem mächtigen Generalstabschef Conrad von Hötzendorf hätte er in dieser Phase zweifellos verloren.
Bald begann aber der Dreibund zu bröckeln. Italien versuchte, Österreich zu erpressen und verlangte für die Beibehaltung seiner Neutralität die Abtretung der italienischsprachigen Gebiete Österreichs. In Wahrheit aber verhandelte Rom schon längst mit der Entente und wechselte mit dem Londoner Vertrag im April 1915 die Seiten. Die Empörung darüber in Österreich war groß. Nun musste im Süden eine weitere Front eröffnet werden.
Gegen den Widerstand von Conrad erhielt Karl im Frühjahr 1916 ein Kommando. Als Befehlshaber des 20. Armeekorps ging er an die italienische Front und befehligte die Südtiroloffensive.23 Insbesondere machte er sich mit den geografischen Gegebenheiten dieser Frontregion bekannt, was bei der Offensive ein Vorteil werden sollte. In seinen Aufzeichnungen schrieb er: »Bis jetzt habe ich geschwiegen und dem Armeeoberkommando freie Hand gelassen. Nun aber, da ich das Korps übernehme, will ich es auch wirklich führen. […] Ich übernehme mein Korps nur dann, wenn ich es so führen darf, wie es sich für einen gewissenhaften Kommandanten gebührt. […] Es genügt nicht, dass ich das Terrain, in welchem meine Leute kämpfen sollen, nur aus der Karte kenne.«24
Für seinen erfolgreichen Einsatz wurde ihm durchaus Achtung gezollt. Edmund Glaise von Horstenau bemerkt ebenso, dass es Karl aber auch darum ging, die Soldaten nicht unnötig zu verheizen: »Der junge Erzherzog machte sich, dass musste der Feind sagen, als kommandierender General ausgezeichnet, und hatte höchstens einen Fehler, dass ihn Sparsamkeit mit dem Blute der Truppe in einem oder anderen Entschluss lähmte.«25
Im Juni 1916 überrannten die russischen Truppen unter Führung von General Brussilow Galizien und die Bukowina, was einen schweren Rückschlag für Österreich bedeutete. Die Offensive in Italien wurde daraufhin abgebrochen. Karl wurde Anfang Juli an die bedrohte Nordostfront versetzt.
Immer häufiger zog ihn nun der Kaiser bei Entscheidungen zurate, insbesondere auch in der Frage der Weiterverwendung von Conrad, dessen Stellung nach der Niederlage durch die Russen reichlich erschüttert war. Karl riet für den Moment von einer Ablösung Conrads ab.
Wieder nach Wien zurückberufen, wurde Karl mit einer Reise nach Pless, dem deutschen Hauptquartier, beauftragt. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte Karl wenig Illusionen in Bezug auf das Bündnis mit Deutschland. Die Gespräche mit Kaiser Wilhelm und die Treffen mit Hindenburg und Ludendorff verliefen für Karl nicht zufriedenstellend. Zwar wurde über eine gemeinsame Friedensinitiative gesprochen, aber in Bezug auf die Kriegsziele hielten die Deutschen sich bedeckt.
Karl kehrte daraufhin wieder an die Ostfront zurück. Am 11. November 1916 erreichte ihn ein Telegramm, das ihn über den bedenklichen Gesundheitszustand seines 84-jährigen Onkels unterrichtete. Eiligst begab er sich wieder nach Wien. Zusammen mit seiner Frau Zita war er dabei, als Kaiser Franz Joseph am 21. November starb.
Karl war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt.