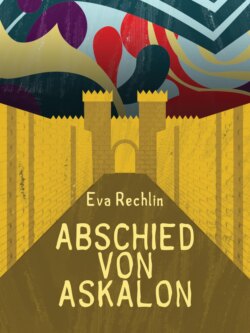Читать книгу Abschied von Askalon - Eva Rechlin - Страница 7
Im Marmorpalast
ОглавлениеTrotz ständig neuer und überwältigender Reiseeindrücke dachte Tobija täglich an seine Schwester im fernen Askalon. Am liebsten hätte er ihr bereits aus der alten Festungsstadt Pelusium an der östlichsten Nilmündung geschrieben, doch Samuel wollte keine Zeit verlieren. Die tagelange Schiffsfahrt schien den erfahrenen Reisenden nicht besänftigt, sondern seine Geduld auf eine harte Probe gestellt zu haben. Nicht einmal den üblichen Besuch bei der örtlichen Christengemeinde, in der er viele Freunde hatte, gönnte er sich. Kaum hatte ihr zyprisches Schiff gegen Mittag im pelusischen Hafen angelegt, kaufte Samuel frischen Proviant für Tobija und sich und verließ die Stadt auf dem kürzesten Wege westwärts. Einzig die lästigen Wasserschläuche brauchten sie nicht mehr zu füllen und mit sich zu schleppen. Der von Süden her seit Juni, Juli schwellende Nil näherte sich nun im September seinem Höchststand. Nach knapp zweitägigem Fußmarsch erreichten Samuel und Tobija die riesige Lagune des Menzalehsees; von dort ging es vorwiegend auf Booten, Flößen und über schwankende Pontons weiter durch das mächtige Nildelta, fast ein Süßwassermeer, aus dem fruchtbare Ansiedlungen als grüne Inseln herausragten. Staunend sah Tobija fette Kuhherden bis zum Bauch im meerwärts ziehenden Wasser des Stromes stehen, er beobachtete riesige helle Schwärme von Vögeln und entdeckte Fische, die er bislang nicht kannte. Samuel fand jetzt keine Ruhe mehr, erlaubte sich und Tobija nur noch stundenweise Schlaf. Dennoch benötigten sie weitere sechzehn Tage, bis sie endlich den westlichsten, den kanopischen Nilarm erreichten, von dem ein gut ausgebautes Kanalnetz nach Alexandria führt.
Erschöpft, überreizt nach solchem Gewaltmarsch nahm Tobija die ersehnte Stadt am Meer in fast schlafwandlerischem Zustand wahr. Im letzten Schein der untergehenden Sonne, die glutrot hinter weißen Mauern und schimmernden Marmorpalästen von unübersehbarer Breite ins Mittelmeer sank, ahnte Tobija die leuchtende Pracht vor seinen Augen. Nur unbewußt erlebte er, wie Samuel ihn an die Hand nahm und ihn das letzte Stück Weg hinter sich herzerrte. Das Haus, in das Tobija durch eine tiefe, abendlich dunkle Toreinfahrt taumelte, sah er erst im Laufe der nächsten Tage wirklich.
Ausgeschlafen und auch sonst gut versorgt, schrieb er endlich einen ersten Brief an seine Schwester.
Ägypten, Herbst, im 1. Jahr des Kaisers Diokletian.
… Alexandria ist hundertmal prachtvoller, als unsere Mutter es beschreiben, als wir es uns vorstellen konnten. Dabei sah ich bis heute nur einige Straßen im Brucheion, dem alten Herrscher- und Tempelviertel beim Großen Hafen, in dem das elegante Eugenios-Haus steht. Es ist ein Palast und nicht der einzige, der unseren Tanten gehört, von denen wir nur noch Agatha, die jüngere, antrafen. Samuels Angst, die ihn vorwärts trieb, war leider begründet, denn die fünfzigjährige Angela war vor Wochen schon gestorben, wohl kurz, nachdem Thomas bei ihr war. Mit Samuel kann ich seitdem kaum reden. Ich wohne im Sklaventrakt, sogar hier haben sie Gästekammern, allerdings winzig und düster. Aber ich muß nicht arbeiten, alle tun, als wäre ich noch ein Kind. Am freundlichsten redet die dunkle Monika, die Tante Angelas Leibsklavin war, mit mir. Wahrscheinlich täusche ich mich, aber mir kommt es vor, als beobachte mich die schöne Nubierin Monika manchmal argwöhnisch, besonders bei den Mahlzeiten in der Gesindeküche. Sie versucht, mich auszufragen. Als ich Askalon erwähnte, horchte sie auf. Darum vermeide ich jetzt Gespräche mit ihr. Samuel will nicht, daß ich mich verrate. Er ist völlig beherrscht von der Trauer um Tante Angela. Noch nie habe ich ihn so konfus erlebt. Übrigens hörte ich von den Haussklaven, daß er künftig ebenfalls im Gesindetrakt einquartiert und verpflegt würde. Es muß also an Tante Angela gelegen haben, daß Samuel mit den Schwestern speisen und auf ihrer Etage wohnen durfte. Ich darf gleich mit dem Hausverwalter Anton auf die Hafenmärkte zum Einkaufen gehen und schreibe Dir später weiter…
Gestern ist es spät geworden. Ich kann Dir nicht schildern, wie schnell hier die Zeit verfliegt! Beim Einkauf auf den Hafenmärkten konnte ich mich kaum sattsehen. Nie im Leben kann ich Dir aufzählen, was es hier alles zu kaufen gibt! Der Hausverwalter Anton, nur wenig jünger als Samuel, mußte sich strikt an Tante Agathas Einkaufsliste halten und jede Ware tausendmal vergleichen, denn sie kauft nur die preiswerteste. Darin sei sie äußerst streng, sagte Anton, und daß man nur auf diese Weise reich werden und vor allem reich bleiben könne. Dabei hatten die Tanten ihren Reichtum von den ebenfalls reichen Eltern und Großeltern geerbt. Tante Agatha sehe ich kaum, seit dem Tod ihrer Schwester sei sie ständig krank, heißt es. Alle drei Tage klage sie über ein neues Leiden, erzählen die Haussklaven. Meistens preßt sie ein Tränentuch vors Gesicht und schluchzt verzweifelt: ›Angela, wie konntest du mich allein lassen!‹ Sie ist ziemlich groß und schlank, trägt dunkle Haarröllchen um ihr noch auffallend frisches Gesicht, an das nur Rosenwasser darf, wie ihre Zofe Kamilla behauptet. Für ihr Alter sieht Tante Agatha recht gut aus, wenn vielleicht auch nicht so vornehm, wie ihre Schwester Angela ausgesehen haben soll. Daß ich seit Tagen in ihrem Palast lebe, hat Tante Agatha offenbar nicht bemerkt. Man hat ihr wohl gesagt, Samuel habe wieder einmal einen jungen Begleiter mitgebracht, der Tobi heißt. Das hatten wir unterwegs so beschlossen. Mir ist es nur recht, daß sich die Tante nicht um mich kümmert. Umso unauffälliger kann ich das riesige Haus erforschen. Ich schicke meine Briefe mit der römischen Staatspost zu Dir nach Askalon. Der Hausverwalter Anton zeigt mir die nötigen Wege, hat mir auch die Schreibsachen besorgt. Auch wenn der Papyrus nur einer von der preiswertesten Sorte ist, hebe ihn gut auf, man kann ihn mehrmals verwenden, wie Du weißt. Unsere weiteren Pläne kenne ich noch nicht. Samuel muß ständig bei Tante Agatha hocken und ihr Gejammer ertragen. Er dagegen versinkt mehr und mehr in Schweigen. Trotzdem bestellte er mir Grüße an Euch alle. Vielleicht schicke ich Dir bereits nächste Woche erneut einen Brief mit der Römischen Post…
Der Hausverwalter Anton zeigte dem Jungen, wie er seine Briefrolle vorschriftsmäßig zu adressieren und zu versiegeln hatte. Offenbar verfügte Anton, trotz Agathas Strenge in finanziellen Dingen, über genug entbehrliche Münzen, aber der Preis für die Postbeförderung schien nicht hoch. Auf dem Rückweg deutete Anton an, daß die wichtigsten Behörden und Beamten dem Hause Eugenios ohnehin verpflichtet seien, nach dem alten Spruch: »Eine Hand wäscht die andere.«
»Ich verstehe«, behauptete Tobija grinsend, obwohl er sich nichts darunter vorstellen konnte, aber er wollte es gerne lernen.
Im Marmorpalast blieb er wie üblich sich selbst überlassen. Die tägliche Mittagsrast war eingekehrt. In der großen Mittelhalle dösten selbst Agathas edle Windhunde mit den fremdartigen Namen Slugi, Syko und Naph. Mit ihnen war Tobija gut Freund geworden, im Umgang mit Hunden war er geübt, und die Tiere witterten seine Zuneigung und Autorität. Ein Weilchen blieb er bei ihnen, tätschelte die jetzt trägen Wächter und horchte. Vom Innenhof her hörte er einen Springbrunnen plätschern und Tauben gurren. Von draußen drangen Straßengeräusche zu ihm, Schritte von Menschen, deren Sandalen auf Steinplatten klatschten, das Trappeln von Pferde- und Eselshufen und das Gesumm vieler Stimmen, darüber das Möwengeschrei vom nahen Hafen her. Aus den oberen Räumen vernahm er den nicht abreißenden Redeschwall einer erstaunlich lauten, hellen Frauenstimme: Tante Agatha! Auf wen redete sie ein? Doch nur auf den von zahllosen Beichten, Seufzern, Klagen geprüften Seelenhirten Samuel.
Tobija horchte nach oben, wohin man von der säulengestützten Halle aus über eine breite Marmortreppe mit flachen Stufen gelangte. Das Erdgeschoß kannte er inzwischen, aber in die oberen Stockwerke war er bis jetzt kaum vorgedrungen.
Er musterte die prächtige Treppe, das kunstvolle Steingeländer mit der spiegelblanken, scheinbar fugenlosen Stützführung, und plötzlich schoß es ihm fast aufsässig durch den Kopf. Warum muß ich mich verstecken, obwohl ich vermutlich rechtmäßige Ansprüche habe?
Zum ersten Mal empfand er einen seltsam herrischen Mut. Warum muß ich beim Gesinde hausen und speisen, ihr Schmatzen, Schlürfen, ihr primitives Gerede ertragen? Warum soll ich verleugnen, was meine kluge Mutter mir an gesellschaftlichem Schliff, an zivilisierten Spielregeln beibrachte? Ihm war, als höbe jeder Gedanke seinen Kopf höher. Hatte er es nötig, sich auf die niederste Stufe zu stellen, wenn ihm in Wirklichkeit die höchste zustand? Es fiel ihm nicht gleich auf, wie er sich unter dem Ansturm solch rebellischer Gefühle und Gedanken Stufe um Stufe die herrliche Treppe hinauf bewegte. Nein, er hatte es nicht nötig, zu buckeln und sich selbst zu verleugnen, bloß weil ein zur Zeit aus dem Gleichgewicht geratener, alter Mann das aus unerklärlichen Gründen für richtiger hielt – als wäre Samuel in seinem derzeitigen Zustand überhaupt fähig, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen. Er merkte ja nicht, daß sein junger Schützling kein Kind mehr war! Ihm war, als riefe ihm jemand zu: »Spring! Und du wirst nicht abstürzen, dein Fuß wird sich an keinem Stein stoßen…« In diesem Augenblick hatte er die oberste Treppenstufe erreicht, stand am Geländer und sah hinab auf die kostbaren Steinintarsien des Hallenbodens.
Ich kann es mir leisten, aufrichtig aufzutreten und damit aufrecht, dachte Tobija entschlossen und näherte sich lautlos der Tür, aus dem die erregte Frauenstimme drang. Seine ausgetretenen Sandalen verursachten bei jedem Schritt ein schlurfendes Geräusch. Kurz entschlossen band er sie auf, hängte sie sich an den Ledergürtel um seine kurze Tunika und tastete sich barfuß weiter auf dem glatten Fußboden. Vom Hauspersonal kannte er Tante Agathas seltsamen Putzzwang; bei ihr müsse man im ganzen Haus jederzeit vom Fußboden essen können! Seine Fußabdrücke hinterließen auf dem makellosen Glanz blinde Schwitzflecken. Er hoffte, daß sie verdunsteten, bevor Tante Agatha sie bemerkte, doch augenblicklich lenkte ihn die hohe Frauenstimme ab, von der er jetzt deutlich jedes Wort verstand.
»Seit meiner Geburt gehörte sie zu meinem Leben, war von Anfang an und jederzeit für mich da! Sie lehrte mich die ersten Schritte, die ersten Worte – Angela! Ich habe nie ohne sie leben müssen. Und ich kann nicht ohne sie leben. Du siehst ja, daß es mich krank und elend macht, mich, die nie krank war! Wie kann sie mich einfach allein lassen? Mit der riesigen Verantwortung für unsere sämtlichen Liegenschaften, für den Besitz, für all die Pächter und Mieter, Diener und Sklaven? Ich halte das nicht aus, Samuel! Das darf selbst meine Angela mir nicht antun!« Samuels leise Stimme klang erschöpft, als müsse er ständig die gleichen Worte wiederholen:
»Hör auf, dich gegen Gottes Willen zu versündigen. Muß erst ihr Tod dich lehren, daß Angela nicht dein Besitz war, dir nicht gehörte wie deine Äffchen, Katzen und Hunde, wie Sklaven, Schmuck und Geld? Deine Trauer hat nichts mit schwesterlicher Liebe zu tun, Agatha. Du schreist wie ein Kind, dem man die Lieblingspuppe nahm. Angela war immer für dich da, ja, aber sie war nicht dein Besitz…«
»Wie kannst du es wagen!« unterbrach ihn wildes Aufschluchzen. »Gerade du, Samuel! Bilde dir bloß nicht ein, daß ich all die Jahre blind war!«
»Nein, genau das haben wir uns nie eingebildet. Es wäre zu allen anderen Lebenslügen ganz sicher die verhängnisvollste gewesen, besonders für Angela.«
»Was willst du damit sagen? Was weißt und verstehst du überhaupt von ihr? Und von mir? Mein Tod wäre es gewesen, wenn sie mich verlassen hätte, mein Tod! Sie hätte nie daran gedacht…«
»Nun, sie hat dich verlassen, so oder so. Und du lebst, Agatha.«
Wieder das Schluchzen, gegen das sie hörbar ihr Tränentüchlein an den Mund preßte.
»Leben nennst du das? Ich bin krank, Samuel, sterbenskrank! Nur die Verantwortung hält mich noch, mein Pflichtgefühl! Wie lange werde ich es aushalten können?« »Schluß mit dem Theater, Agatha! Jeden Tag eine andere Krankheit – du steigerst dich in immer neue Schmerzen und Leiden – und warum? Angela kannst du damit nicht bestrafen, sie ist für dich unerreichbar. Deine lärmende Trauer ist ohne Würde, Agatha. Beachtet werden willst du, bemitleidet, ununterbrochen alle und jeden daran erinnern, daß du lebst! Mit deinem würdelosen Spektakel wirst du von keinem echtes Mitgefühl bekommen. Du nährst nur Schmarotzer, und deine Ärzte lachen sich ins Fäustchen. Mach Angelas Tod nicht zum Gespött!«
Der lauschende Tobija hielt sekundenlang die Luft an. Offenbar erging es seiner Tante hinter der Wand nicht anders, denn ein Weilchen trat atemlose, bedrohliche Stille ein. Insgeheim bewunderte Tobija seinen Vormund, den er für sanftmütig, weise, beherrscht hielt. Was setzte er mit solch scharfen Worten alles aufs Spiel! Vergaß er völlig die regelmäßigen Spenden für arme Gemeinden, die aus diesem Haus flossen? War er einzig solcher Spenden wegen nicht überhaupt in Alexandria? Er hörte die Tante durchatmen, einmal, zweimal, dann wieder ihre hohe Stimme, plötzlich fast normal:
»Was fällt dir ein, Samuel, mit mir in solchem Ton zu reden? Wer bist du, daß du dir das erlaubst?«
Seine Antwort klang, als lächle er:
»Darüber habe ich keine Illusionen, Agatha. Sonst wäre wohl manches anders verlaufen. Was jetzt allein zählt, ist, daß wohl niemand sonst mit dir ehrlicher wäre, und das weißt du im Grunde selbst.«
»Mag sein. Trotzdem warne ich dich: Nimm dir nicht zu viel heraus, auch wenn du Priester bist und dein Leben deinem Glauben unterordnest. Das gibt dir noch lange nicht das Recht…«
»Nein. Aber Pflichten habe ich, auch dir gegenüber. Und für Angela. Sie hat gelitten, Agatha. Du hast es nicht einmal bemerkt. Sie jedenfalls hat daraus nicht auch noch Kapital schlagen wollen.«
»Ach ja?« Die hellere Stimme klang drohend scharf. »Du warst ihr Beichtvater? Ein Wanderprediger? Angela und gelitten – sie, die alles hatte? Mein Hand hätte ich mir abschlagen lassen, wenn es ihr Leben verlängert hätte! Jeden Wunsch habe ich ihr von den Augen abgelesen… Was siehst du mich an? Darf ich vielleicht meine bescheidenen Verdienste nicht erwähnen? Ich habe meiner Schwester bis zur Selbstaufgabe gedient! Sie war der Inhalt meines Lebens.«
»So such dir einen neuen, Agatha. Du hast alle Möglichkeiten, weiterhin Gutes zu tun.«
»Ja ja, keine Sorge, daß ich die üblichen Spenden vergesse. Deswegen bist du nur hergekommen, auffallend schnell.
Wolltest du nicht erst im Winter wiederkommen? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Samuel. ›Wenn es kühl ist und bevor der Chamsin ausbricht!‹, hast du bei deinem letzten Besuch gesagt.«
Samuel wich aus: »Es war wohl so eine Ahnung. Und vielleicht hilft es dir ein wenig.«
»Ach ja, schon gut, ich leugne es ja nicht. Mit wem sonst könnte ich so offen über alles sprechen? Seit über dreißig Jahren kennen wir uns. Zwar hast du uns damals unsere Kora fortge…« Die Tante stockte mitten im Satz, als fiele ein völlig neuer und unerwarteter Gedanke über sie her, und schon wurde ihre etwas monotone Stimme wieder laut: »Kora! Kora hatte doch Kinder! Gütiger Himmel, wie konnte ich das vergessen? Einen Sohn hatte sie und eine Tochter. Stehen sie nicht ganz allein in der Welt? Und du bist ihr Vormund, Samuel! Wie alt mögen sie sein? Warte mal… Kora verließ uns vor sechzehn Jahren, als sie diesem judäischen Hungerleider nachlief, und das erste Kind muß bald danach gekommen sein. Samuel, warum erinnerst du mich nicht an Koras Kinder? Was können sie für die Verfehlungen ihrer Eltern? Sie sind mit deren frühem Tod genug bestraft. Koras Kinder sind meine einzigen Verwandten! Zwei unschuldige Waisen…« Der Lauscher draußen im Gang rutschte langsam an der Wand hinunter auf die Knie. Er versuchte, sich die Ohren zuzuhalten und konnte zugleich nicht genug hören. Endlich besann sie sich auf ihn – holte ihn wie aus dem Nichts in ihr Bewußtsein, ihn und seine Schwester Debora. Er nahm die Hände von den Ohren und hörte seinen Vormund gerade sagen:
»Tobija und Debora sind keine Wilden! Kora und Simon haben sie sorgfältig erzogen, in ganz Askalon gibt es kaum gebildetere und höflichere junge Menschen. Sie sind keine kleinen Kinder mehr, die du dir zurechtbiegen müßtest; es hätte sie ja auch nur verbiegen können. Sie sind alt genug, um selber entscheiden zu können.«
»So laß sie entscheiden, Samuel! Oh, es ist unerträglich, daß ein Provinzler wie du die Vormundschaft über die Kinder hat. Was verstehst du von dem Leben, das ich ihnen bieten kann? Meine Verwandten sind sie, mir stehen sie zu!« »So plötzlich, Agatha? Von heut auf morgen?«
Tobija draußen fuhr zusammen, als träfe ihn ein Blitzschlag. Doch es war nur eine dunkle Hand, die von oben her nach seiner griff und ihn heraufzog. Die nubische Sklavin Monika mußte sich lautlos zu ihm geschlichen haben. Wie lange stand sie wohl schon neben ihm in der schattigen Schlucht des langen Flures? Ihr unvermutetes Auftauchen weckte einzig Scham, so daß er ihrem festen Zugriff verwirrt folgte. Die Stimmen aus Tante Agathas Zimmer blieben zurück und wurden undeutlich. Erst an der großen Treppe hielt Monika an und flüsterte ihm zu:
»Zieh deine Schuhe wieder an, Tobija.«
»Du weißt…?«
Sie nickte: »Damals war ich jünger als du, trotzdem erinnere ich mich gut an deine Eltern. Ich habe Kora und Simon von Anfang an in dir wiedererkannt.«
Aufsässig fuhr es ihm durch den Kopf:
»Dann laß mich los! Dann weißt du ja, wer ich bin!« Monikas Griff um Tobijas Handgelenk war eher noch fester geworden, und sie schüttelte den Kopf:
»Samuel hat mir aufgetragen, dich im Auge zu behalten.«
»Ich bin nicht Samuels Hund!« fuhr Tobija auf und versuchte, sich loszureißen.
»Nicht so laut!« warnte sie. »Er meint es gut mit dir, das weißt du sehr genau.«
»Das habe ich gerade gehört! Er ist alt, außerdem seit Angelas heimlichem Brief zerfahren und unentschlossen, erst recht, seit er weiß, daß sie tot ist. Laß mich endlich los!«
»Was hast du vor?« fragte sie mißtrauisch.
»Die Sandalen schnüren. Hast du mich zu verhören, eine Sklavin?«
Sie gab ihn frei, blieb jedoch argwöhnisch dicht bei ihm stehen. Weiter hinten im Zimmer war es ruhig geworden. »Sie haben uns gehört!« flüsterte Monika warnend. Tobija band ruhig seine Schuhriemen fest und sagte laut:
»Wenn schon! Einer muß ja den ersten Schritt tun.« Seine aufgebrachte Stimme hallte durch den hohen, weiten Gang, als er fortfuhr: »Ich habe nichts zu fürchten und nichts zu verlieren. Mir geht nur endlich ein Licht auf, glaubst du an Zufälle?«
»Leise, Tobija! Was soll das?«
»Stell dir vor, der Brief wäre nur einen Tag später nach Askalon gekommen und ich bereits mit den Fischern unterwegs – war das Zufall?«
»Hör auf, von dem Brief zu reden! Auch für mich steht allerhand auf dem Spiel. O Herr, laß es nicht zu spät sein – sie kommen.«
Tobija bückte sich zu seinen Sandalen.
»Was ist los?« rief Agatha aufgebracht. »Ein Dieb? Wo sind die Hunde!«
Tobija richtete sich auf, stellte sich vor Monika und blickte Samuel und seiner Tante selbstbewußt entgegen. Er fühlte sich nicht gerade mutig, auch nicht ruhig entschlossen, aber er wollte nicht länger passiv sein, sondern seinen eigenen Weg gehen. Was auf ihn wartete, konnte seiner Meinung nach nur sein Schicksal sein, und er war bereit, sich dem zu stellen. Samuel trat überrascht auf ihn zu:
»Du, Tobi? Ist etwas passiert?«
Tobija sah die fragenden Blicke der halb hinter Samuel stehenden Dame Agatha und stellte sich ihr kurzentschlossen vor:
»Ich bin Samuels Begleiter aus Askalon.« Sie horchte auf: »Aus Askalon, soso. Wie alt?«
»Gerade fünfzehn.«
Ihr Augen wurden schmal. Samuel beugte sich vor und sagte hastig und gedämpft:
»Es gibt Abmachungen zwischen uns, Tobi! Vergiß nicht…« Die hohe Stimme fiel ihm scharf ins Wort:
»Was soll er nicht vergessen! Und wie nennst du ihn? Tobi? Doch wohl sein Kindername. Wie heißt du wirklich, junger Mann?«
»Tobija.«
Er fühlte, wie sich Monikas Hand hart um seine Schultern krallte, als müßte sie ihn zurückreißen, und er sah Samuels Gesicht zurückweichen, als wäre er von Tobija geohrfeigt worden, sah den fassungslosen Ausdruck in Samuels großen, braunen Augen mit den schweren Lidern. In Agathas Gesicht breitete sich langsam ein Lächeln aus, das Tobija beklommen wachsen sah; sie atmete tief durch und übernahm das Wort:
»Mir scheint, hier gibt es einiges zu klären. Tobija aus Askalon, fünfzehn Jahre. Und deine Schwester… Debora, nicht wahr?«
»Ist jetzt dreizehn«, antwortete Tobija. Er fühlte sich nicht überrumpelt. Er war ja bereit gewesen, auch wenn Samuels Blick ihn anklagte. Tobija versuchte, sich mit Blicken zu seinem Vormund hin zu verteidigen: Soll ich etwa unhöflich sein und mich mit Schwindeleien zum großen Geheimnis machen – warum? Er zuckte die Achseln, und Monika ließ ihn los.
»Folgt mir alle ins Zimmer«, befahl die Dame des Hauses.
»Ich habe mich nur um sein Wohl gekümmert«, erklärte Monika.
»Also geh, was hättest du auch mit Familiengeschichten zu schaffen? Geh schon!«
Tobija griff nach Samuels Hand, während sie Agatha ins Zimmer folgten, und er fragte beschwörend:
»Sollte ich lügen? Bin ich vielleicht nicht Tobija aus Askalon?«
»Nein, du sollst nicht lügen, Tobija, auch mich nicht belügen – und vor allem nicht dich selbst.«
»Wie meinst du das?«
»Komm selber drauf.«
So kurz angebunden hatte Tobija seinen Vormund noch nicht erlebt, aber er sah keinen Grund, demütig um bessere Stimmung zu werben.
»Es gibt Abmachungen zwischen uns«, hatte Samuel gesagt. Was für Abmachungen! Daß er Tobi genannt werden sollte, hieß nicht zwangsläufig, seinen wahren Namen zu verleugnen. Ach ja, am Lagerfeuer im Wadi hinter Ashdod hatte Tobija beteuert: »Du mußt mich keinem Menschen als Koras Sohn vorstellen.«
Sie hatten in Tante Agathas Zimmer Platz genommen, sie halb ausgestreckt auf ihrem seidengepolsterten Liegesofa, die Männer ihr gegenüber auf einer ähnlichen Liegestatt sitzend.
»Fang schon an mit deinem Verhör, Agatha.« Samuels Stimme klang müde. »Was willst du hören?«
»Wie stellst du mich vor dem Jungen dar! Bin ich der Kaiser in Rom? Gewiß, vorhin erst fragte ich dich, wieso du so schnell nach Alexandria zurückkamst? Falls es wegen des Jungen ist, verstehe ich nicht, warum du ihn…«.
»Ja, genauso ist es, es ist meintwegen!« unterbrach Tobija aufgeregt. »Ich wollte endlich einmal alles sehen: Meine einzigen Verwandten, ihr Haus, diese Stadt…« Samuel blickte Tobija an, als könne er seinen Ohren nicht trauen. Auch Agatha entging nicht, wie Tobija unsicher wurde, den Faden verlor, verstummte.
»Na schön«, lenkte sie ein, »es muß ja nicht gleich alles auf den Tisch. Mit der Zeit werden wir schon dahinterkommen. Wenigstens eins möchte ich fürs erste klipp und klar wissen: Ist Tobija der Sohn meiner Kusine Kora?«
Tobija nickte.
»Und wo haltet ihr seine Schwester Debora versteckt?«
Endlich machte Samuel den Mund auf:
»Du gehst zu weit, Agatha! Ich schleppe die Kinder nicht hierher, um Neugier zu befriedigen. Einen Begleiter brauchte ich wie schon oft. Je älter ich werde, desto wichtiger ist es mir. Es ergab sich, daß ich keinen anderen fand als eben Tobija.«
»Ja, so war es«, pflichtete Tobija eilfertig bei, »mich interessierte nun einmal Alexandria am meisten. Ich hätte sonst nämlich Fischer werden müssen.«
»Etwas Vernünftiges werden mußt du so oder so«, wies ihn Samuel zurecht.
»Ganz recht«, sagte die Hausherrin, »darum werde ich mich nun kümmern. Es klingt, als würdest du nicht gern Fischer werden?«
»Nein, aber was sonst bleibt einem in Askalon übrig? Obendrein, wo mein Vater…«
»Ja ja«, unterbrach sie ihn, »an den möchte ich nicht erinnert werden. Und weil du nicht Fischer werden willst, hast du auf gut Glück die unerwartete Reise nach Alexandria angetreten? Irgendetwas mußt du dir dabei gedacht haben!« Sie redete so unbeherrscht drauflos, wie sie auch ihre Trauer auszudrücken pflegte, das fiel Tobija störend auf. Ihm war, als müßte er Stacheln ausfahren. Unwillkürlich rückte er näher zu Samuel hin und fragte:
»Muß ich darauf wirklich antworten?«
Der väterliche Freund ließ ihn nicht im Stich und erwiderte leise: »Nicht auf Unzumutbares, obwohl du auch mich langsam neugierig machst.«
»Es hat wirklich alles damit zu tun, daß ich nicht Fischer werden mag.«
»Schon gut, Tobi, und heute! Was ist es jetzt?« Die Matrone auf dem Seidensofa ließ ihre wachsamen, dunklen Augen von einem zum andern flitzen, dabei kraulte sie eins der Schoßäffchen, das zu ihr auf die Kissen gesprungen war. »Jaja, mein Liebling, mein Herzenspinsel…«
»Was es jetzt ist? Nichts anderes als daß ich nicht weiß, warum ich mich unten beim Gesinde verstecken muß. Dich, Samuel, sehe ich kaum noch! Die letzten Wochen, auf dem Weg hierher, waren wir Tag und Nacht zusammen, auch wenn du kaum mit mir gesprochen hast…« Tobija sah Samuels warnenden Blick in Richtung Agatha und fügte hastig hinzu: »Natürlich hat ein Wanderprediger mit anderen zu reden. Also, Wanderprediger oder Bote, das könnte ich auch nicht werden.«
»Dafür bist du noch viel zu jung, das kannst du unmöglich nach unserer ersten Reise schon beurteilen, Tobi.«
»Muß man dazu erst selber gereist sein? Von klein auf kenne ich christliche Boten! Kaum eine Woche, in der nicht einer durch Askalon kam. Und nach dieser ersten Reise weiß ich, daß ich es nicht werden kann. Verstehst du das, Samuel?« Tobijas bittende Blicke trafen auf zwei strenge, abweisende Augen, die deutlich genug zu ihm sprachen: In was steigerst du dich hinein? Worauf willst du hinaus? Bis hierher war ihm der alte Freund beigesprungen, jetzt überließ er ihn wortlos sich selbst. Tobija schlug die Augen nieder. Er wußte nicht weiter.
»Komm einmal zu mir, junger Mann«, sagte sanft die bislang eher schneidend hohe Stimme, »ja, setz dich zu mir auf die Kline, Tobija, bitte…«
Zaudernd ließ er sich an ihrem Fußende nieder. Das eben noch auf ihrem Schoß getätschelte Äffchen warf sie mit geübter Hand auf eines der zahlreich im Zimmer verteilten Kissen:
»Näher, Junge, näher, wenigstens deine Hand möchte ich nehmen können. Ich habe sonst keinerlei Verwandte, einzig dich…«
»Und Debora!«
»Richtig, aber du bist mein einziger Neffe.«
»Seine Mutter Kora war eine Tochter eurer Kusine, soviel ich weiß«, stellte Samuel klar.
»Bitte, Samuel, so genau wollen wir es nicht nehmen. Er hier ist jedenfalls mein einziger Verwandter. Wie unser Kind haben wir die kleine Kusine aufgezogen, nachdem auch ihr Vater gestorben war. Mit welcher Liebe! Die beste Partie von halb Alexandria hätte sie sein können!«
»Um welchen Preis?« mahnte Samuel leise.
Agatha zog ihr Tränentüchlein aus den üppigen Falten ihrer bodenlangen kostbaren Tunika und preßte es kurz gegen die Augen, dann schneuzte sie sich entschlossen und setzte ein einzig für Tobija bestimmtes Lächeln auf. Sie drückte seine Hand, als wolle sie ihn ermutigen:
»Wir beide, du und ich, werden alles besser machen. Du bist fast schon ein Mann. Du wirst begreifen, um was es geht. Tobija, mein Neffe – noch heute früh, als ich aus meinem kurzen, quälenden Schlaf erwachte und die entsetzliche Trauer mich zu Boden drückte, da hatte ich ja keine Ahnung! Wie gut es unser Schöpfer selbst im tiefsten Schmerz mit uns meint: Schickt mir meinen einzigen Neffen ins Haus, ausgerechnet in den schwersten Wochen meines Lebens! Ist das zu begreifen? Alle meine Gebete um Trost, um Hilfe, um die Stütze meines Alters…«
»Agatha! Willst du etwa behaupten, du hättest um Koras Kinder gebetet? Oder auch nur einmal für sie?«
»Für wen sonst hätten wir dir, Samuel, oft Sonderspenden mitgegeben?«
»Vorsicht, Agatha, ich könnte antworten! Unterschätze Tobija nicht.«
Achselzuckend wendete sie sich Tobija zu.
»Ich furchte, der gute alte Samuel ist ein wenig eifersüchtig auf uns zwei? Du gehörst in dieses Haus – und es ist ja nicht unser einziges, weißt du? Alles wird dir gehören, wenn du es nur willst!«
»Und Debora«, erinnerte sie Tobija. Ihre Hand wurde schlaff, doch das Lächeln hielt sie durch:
»Gewiß, auch Debora, wenn sie will. Mit Mädchen, weißt du, bin ich vielleicht unwillkürlich vorsichtiger, seit das mit Kora passierte. Aber was sage ich da! Ich sehe dir an, was du meinst: Debora ist anders. Erzähle mir von ihr.«
»Gern… äh, wie soll ich dich nennen?«
»Was für eine Frage? Tante!«
»Einfach nur Tante?«
»Ich bin deine Tante Agatha, oder gibt es noch andere, die sich einmischen könnten? Von deinem Vater etwa?«
»Nein. Debora und ich leben seit Mutters Tod bei unsern Pflegeeltern Sebastian und Miriam. Sie haben ein kleines Gehöft mit Landwirtschaft: Oliven, Pistazien, Mandelbäume, Obst, etwas Weinbau. Und selber drei Kinder, Eva, Abel und David.«
»O weh, hoffentlich genügend Vieh und Acker für so viele hungrige Mäuler?«
»Hungern mußten wir bei ihnen noch nie. Miriam hat Mutter gepflegt. Sie war sehr krank, schon lange…« Tobija blickte unsicher auf seine Tante, ob es sie interessierte, von Kora zu hören, denn sie ließ plötzlich achtlos seine Hand los, griff wie in Gedanken in den halbrunden Ausschnitt ihrer Tunika und beförderte eine Handvoll klirrender, blinkender Goldketten und Klunker nach außen, ordnete sie um Hals und Borten und murmelte:
»Daran muß ich mich erst gewöhnen. Ich muß ja jetzt auch die von meiner armen Schwester tragen, zum Gedächtnis. Aber sprich weiter, Kind! Was sagtest du zuletzt? Ach ja, von deiner Schwester wolltest du mir erzählen. Wie sieht sie aus?«
»Wie unsere… ja, sie ist genauso hübsch, und wir wurden beide genau gleich erzogen. Also lernte und studierte Debora genau so viel wie ich. Ist das Gold? Dein Schmuck, meine ich. Die Ketten und Ringe und Armreifen…«
»Was sonst? Selbstverständlich Gold und echte Juwelen. Du wirst es rasch lernen, echt von unecht zu unterscheiden. Ich werde dir alles zeigen! Das bißchen Alltagsschmuck hier ist nur ein winziger Bruchteil. Solange ich noch in Trauer bin, kann ich mich schließlich nicht aufzäumen wie ein Roß beim Wagenrennen.«
»Gibt es hier etwa Wagenrennen?«
»Oh, so war das nicht gemeint! Nein, nein, keine Rennen, keine Gladiatorenspiele und die übrigen römischen Laster. Wir sind in Ägypten! Das alexandrische Bürgerrecht gilt mehr als das römische. Ja, einen echten Alexandrier mache ich aus dir! Was schaust du dauernd zu Samuel hinüber?«
»Samuel ist mein Vormund…«
»Und ich deine Tante, deine einzige Verwandte. Was hat Samuel dir schon zu bieten?«
»Darum geht es nicht!«
»Um was sonst? Ich biete dir ein Elternhaus, und was für eins! Ganze Straßenzüge hängen daran! Gib es zu, Samuel, was hättest du dagegen zu bieten?«
Samuel zeigte seine leeren Hände.
»Darum geht es nicht!« rief Tobija beschwörend hinüber. »Ich will es richtig verstehen, ich will es richtig machen. Mein Weg wird es sein, Samuel, meiner! Setz mich nicht einfach so aus.« Tobija sprang von den Seidenpolstern auf und zu Samuel, warf sich ihm an die Brust, umschlang mit beiden Armen den gebeugten Nacken des alten Mannes und barg sein Gesicht an dessen rot und weiß umhüllter Schulter. »Hilf mir«, stammelte er, »es ist zu neu, zu anders. Hilf mir!«
»Ja ja«, sagte Samuel, »du hast es dir einfacher vorgestellt? Warst nicht du selber es, der diesen Weg wählte?« Er klopfte Tobijas Rücken, strich ihm über das dichte, dunkle Haar und blickte hinüber zu der Frau auf den Polstern, die die Szene achselzuckend verfolgte, als fragte sie: »Habe ich etwas falsch gemacht?«
»Genug, Agatha, es reicht. Köder benutzt nur, wer Fallen stellt. Ich habe dich gewarnt: Unterschätze auch Tobija nicht!«
Im Nu war wieder das Tränentuch in ihrer Hand. Sie preßte es gegen den Mund, daß ihre Stimme wie erstickend klang:
»Alle Liebe biete ich ihm, alle Liebe meines einsamen Alters! Und du wagst, meine besten Gefühle Köder zu nennen? Wenn ich dir jetzt nicht die Tür weise, Samuel, dann nur aus Rücksicht auf dieses Kind! Du weißt nur zu gut, wie weich sein Herz ist, wie mitfühlend! Aber du gönnst ihn mir nicht. Nicht einmal diesen einzigen Trost gönnst du mir in meinem unsäglichen Schmerz um meine Angela! Ist es zu fassen? Ich halte das nicht aus, deinen Neid, deine Herrschsucht über die unmündigen armen Waisen! Es tut weh… zu weh… bitte, meine Zofe! Um Himmels willen, so ruf mir Kamilla! Mein Herz…! Ich gehe zugrunde vor…« Ihre Stimme erstickte. Sie griff sich an die Brust, ihre Hand krallte sich um die feinen Tuchfalten über ihrem Herzen, dann sank sie mit einem Schluchzen auf die Polster und blieb mit geschlossenen Augen schwer atmend liegen.
Tobija drehte sich um und sah entsetzt, wie sie dalag, wie ihre Hand mit dem Tränentuch schlaff herabbaumelte.
»Hilf ihr, Samuel, hilf doch!«
»Geh an die Treppe und rufe Kamilla, wahrscheinlich triffst du sie bereits im Gang.«
Samuel blieb sitzen, sprang nicht einmal auf, sondern blickte ruhig zu Agatha hinüber. Er schien keine Spur besorgt. Tobija traute seinen Augen nicht.
»Sie könnte sterben, Samuel! Und du betest nicht einmal?«
»Sie denkt nicht daran, zu sterben. Ruf Kamilla, du kommst mit mir.«
»Nicht einen Schritt, solange sie womöglich stirbt!«
Tobija hastete hinaus auf den Gang und stieß fast mit Agathas Leibsklavin zusammen. Er brauchte ihr nichts zu sagen. Mit einem Fläschchen in der Hand trat Kamilla energisch an Agathas Lager. Samuel war aufgestanden. Er wollte Tobija aufhalten, der der Sklavin besorgt folgte. »Kann ich helfen? Man muß einen Arzt rufen! Sag mir, was ich tun kann, bitte!«
Sie blickte sich kurz nach ihm um und deutete zur Tür: »Männer sind jetzt hier überflüssig. Sag deiner Herzensfreundin Monika, sie soll das Übliche veranlassen.«
Samuel hatte das Zimmer bereits verlassen. Tobija rannte an ihm vorbei zur großen Treppe, rief durch die Halle nach Monika, die bereits mit Wasserkrug und Schüssel aus dem Gesindetrakt kam. Auch sie zeigte keinerlei Erschrecken, als wäre alles längst und oft erprobt.
»Nur keine Panik«, sagte sie im Vorbeihuschen, »und merk dir das für das nächste Mal…« und war augenblicklich im Zimmer ihrer Herrin verschwunden. Mit hängendem Kopf blieb Tobija an der Treppe stehen. Nicht einmal die Hunde unten rührten sich! Und er wußte doch, wie ahnungsvoll Hunde reagieren konnten, wenn es sich um ihr Herrchen oder Frauchen handelte. Was ging hier vor? Er verstand es nicht! Er hörte Samuels Schritte kommen, dann spürte er dessen Hand auf seiner Schulter und hörte sein leises:
»Komm.«
»Wohin? Es könnte so einfach sein, wenn du nicht… ach, wenn es nicht alle immer so gut mit mir meinten! Einmal im Leben möchte ich herausfinden, wie ich es selber mit mir meine.«
»Dann komm, Tobija.«
»Was hast du vor?«
»Dir Alexandria zeigen. Nicht die ganze riesige Stadt, nur Agathas Besitz, ihre Häuser, ihre Straßen, alles, was deiner Tante gehört.«
»Du? Du willst mir das zeigen?«
»Du mußt Bescheid wissen, wenn du selber herausfinden willst, welche Wege es gibt. Es ist bereits Nachmittag, wir kommen heute sowieso nicht mehr überall hin. Aber laß uns wenigstens anfangen. Komm.«
»Können wir die Tante jetzt allein lassen?«
»Sie ist gut versorgt. Soll sie sich ausruhen bis zur nächsten… Morgen ist sie bestimmt wieder auf den Beinen.« Samuel ging die Treppe hinab, durch die Halle zur Toreinfahrt. Tobija, hinter ihm, fragte:
»Was ist zwischen euch? Ein Kampf und wenn, um was? Oder mögt ihr euch einfach nicht? Es kann nicht jeder nach deinem Geschmack sein! Was ist es also?«
Zum zweiten Mal an diesem Tag sagte Samuel nur:
»Komm selber drauf.«