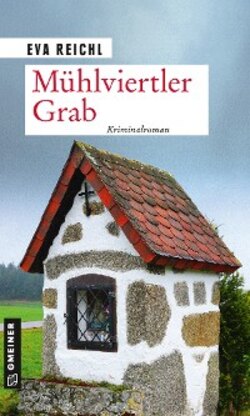Читать книгу Mühlviertler Grab - Eva Reichl - Страница 5
1. Kapitel
ОглавлениеOskar Stern wurde vom Läuten seines Handys geweckt. Er blinzelte. Draußen war es noch dunkel, demnach konnte er nicht verschlafen haben. Er griff nach dem Smartphone, das störend auf dem Nachtkästchen vibrierte, und wischte über das Display.
»Chef! Wir haben einen neuen Fall«, drang die Stimme von Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht aus dem Lautsprecher an sein Ohr.
»Wo?«, war alles, was Stern imstande war zu fragen. Sein Gehirn kam nur langsam in die Gänge und weigerte sich, auf das eben Gehörte angemessen zu reagieren. Schließlich war es unter der Bettdecke kuschelig warm, und Stern fühlte sich, als wäre er erst vor wenigen Augenblicken eingeschlafen.
»In St. Oswald bei Freistadt.«
Stern brummte und hielt dabei die Augen geschlossen. Er wünschte, er könnte ein paar Minuten länger im Bett liegen bleiben.
»Stern?« Grünbrechts Stimme drang fordernd aus dem Handy.
»Ich komme ja schon«, grummelte er.
»Soll ich auf Sie warten und Sie mitnehmen?«, fragte Grünbrecht. Es war ihr anzuhören, dass sie das lieber nicht tun wollte.
»Nein. Ich brauche noch eine Weile«, erwiderte Stern, und das war nicht übertrieben. Bevor er einsatzfähig war, benötigte er mindestens eine Tasse starken Kaffee. Vielleicht sogar zwei. Das war etwas, das sich mit zunehmendem Alter veränderte. Die Agilität verlangte oftmals eine gesonderte Einladung, um sich zu zeigen. Außerdem hatte er ein weiteres Hindernis zu überwinden, und das war der eigentliche Grund, weshalb er etwas mehr Zeit brauchte. Es wartete bestimmt bereits in der Küche auf ihn.
»Okay. Wir sehen uns dann auf dem Friedhof.«
»Auf dem Friedhof? Wieso auf dem Friedhof?« In Sterns Gehirn schrillten die Alarmglocken. Es konnte wohl kaum sein, dass die St. Oswalder die Leiche jetzt schon für das Begräbnis bereit machen wollten? »So schnell geht das aber nicht, wenn jemand stirbt, dass man den auf den Friedhof bringen kann, wenn der noch gar nicht …«
»Nein, Chef. Der Friedhof ist der Fundort der Leiche«, fiel Grünbrecht ihm ins Wort.
»Okay.« Stern beruhigte sich. »Wir sehen uns also nachher auf dem Friedhof.« Er beendete das Gespräch und wälzte sich aus dem Bett. Geräusche in seiner Wohnung hatten ihn die halbe Nacht wachgehalten, und auch in diesem Moment war ein Poltern zu hören. Ebenso ein Kratzen an der Schlafzimmertür. Es kam ihm vor, als lebte er mit einer Horde Poltergeister zusammen. Er schlüpfte in Hose und Hemd und schlurfte zur Tür. Ein starker Kaffee würde seine müden Knochen zum Leben erwecken, hoffte er, und danach wollte er nach St. Oswald aufbrechen. Er drückte die Klinke, zu seinen Füßen rollte ein Fellknäuel in den Raum. Und noch eines.
»Na, ihr beiden? Ihr habt es heute Nacht aber ordentlich krachen lassen. Ich verpetze euch bei eurer Mutter, da könnt ihr Gift drauf nehmen.« Er stieg über die kleinen, gerade mal zehn Wochen alten Kätzchen hinweg in den Flur. Die aufgedrehten Mitbewohner sausten purzelnd hinter ihm her und holten ihn auf halbem Weg in die Küche ein. Seit Wochen ging das schon so. Er konnte keinen Schritt mehr machen, ohne befürchten zu müssen, auf eines der Tiere zu treten.
Vor zweieinhalb Monaten war er von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte festgestellt, dass eine fremde Katze, die zweifelsohne durch ein offenes Fenster in seine Wohnung geklettert war – was im strafrechtlichen Sinn Hausfriedensbruch und widerrechtliches Betreten bedeutete – im Wohnzimmer ihre Jungen zur Welt gebracht hatte.
Eine Sauerei war das gewesen!
Stern erinnerte sich nur ungern daran, wie er alles hatte putzen müssen. Anschließend hatte er die Nachbarn gefragt, ob die Katze ihnen gehöre, aber niemand hatte der Besitzer der nunmehr vierköpfigen Familie sein wollen, und Stern hatte es nicht übers Herz gebracht, die alte Streunerin samt ihrem Nachwuchs auf die Straße zu befördern – Hausfriedensbruch hin und widerrechtliches Betreten her. Anfangs war die Sache auch ganz harmlos gewesen, da hatten die Rabauken die meiste Zeit an den Zitzen der Mutter gehangen und geschlafen. Aber seitdem sie angefangen hatten, die Umgebung zu erkunden, machten sie Sterns Wohnung unsicher und ließen ihn nachts nicht schlafen.
In der Küche stellte er eine Schüssel mit Katzenfutter zu Boden, auf das sich die hungrigen Mäuler gierig stürzten, bereitete sich selbst eine Tasse Espresso zu und säuberte, während die Kaffeemaschine geschäftig surrte, das Katzenklo. Mit der Tasse in der Hand beobachtete er die Rasselbande und überlegte, dass es nun langsam an der Zeit war, für die Findelkinder eine neue Bleibe zu suchen. Dann hätte auch er endlich wieder seine Ruhe, und die Streunerin könnte ihres Weges ziehen.
Seine Enkelkinder Melanie und Tobias würden sich über ein Haustier bestimmt freuen. Für sie hatte er ein schwarz-weiß geflecktes Kätzchen ausgewählt, das gefiele ihnen bestimmt am besten. Ihm musste nur noch einfallen, wie er seine Tochter Barbara überzeugen konnte, seinen Enkeln ihren langersehnten Wunsch nach einem Haustier endlich zu erfüllen.
Das Fell des zweiten Kätzchens war gestreift, bis auf den weißen Bauch und die ebenso weißen Pfoten. Dieses wollte er Bormanns Sekretärin schenken. Wenn er der Gerüchteküche im Landeskriminalamt Glauben schenken durfte, hatte sie sich erst kürzlich von ihrem langjährigen Freund getrennt und war nur noch heulend im Vorzimmer des Dienststellenleiters anzutreffen. Da wäre ein Schmusetiger, mit dem man Kuscheln und den man streicheln konnte, genau die richtige Ablenkung, fand er. Und für das dritte Kätzchen, ein astreiner grau-brauner Tiger, der wild und klug zugleich zu sein schien, würde ihm auch noch etwas einfallen.
Eine halbe Stunde später verließ er die Wohnung und fuhr mit seinem grauen Audi A6 auf der A7 Richtung Freistadt. Nach gut 40 Minuten erreichte er St. Oswald und bog bei der ersten Kreuzung rechts ab, da er den Turm der Kirche bereits erspähte. Dort in der Nähe musste der Friedhof sein, schlussfolgerte er, was sich nach der nächsten Kurve als richtig erwies. Ein blau blinkendes Lichtermeer empfing ihn, als hieße es ihn trotz des traurigen Anlasses willkommen.
Stern hielt nach Webers Wagen Ausschau. Durch die Versorgung der Katzenfamilie war er später losgekommen als üblich, dennoch hoffte er, vor dem Gerichtsmediziner eingetroffen zu sein. Zwischen ihnen beiden gab es diesen unausgesprochenen Wettkampf, wer als Erster an einem Tatort war. Von einem unerklärlichen Ehrgeiz gepackt – den Stern zwar jedem gegenüber abstreiten würde, sollte man ihn darauf ansprechen –, wollte er diesen Wettkampf jedes Mal unbedingt gewinnen wie ein Schuljunge, dem gerade die Hormone einschossen.
Als der Audi näherrollte, entdeckte er Webers Wagen direkt vor dem Friedhofseingang. Mist, fluchte er innerlich und parkte ein gutes Stück weiter hinten am Straßenrand. Wäre er tatsächlich vor Weber hier gewesen, würde er es ihm sofort unter die Nase reiben, sobald dieser einträfe. So aber beschloss er, Webers Sieg mit keinem Wort zu erwähnen, ihn einfach zu ignorieren und dessen Bedeutsamkeit, falls notwendig, herunterzuspielen.
Die Kollegen hatten den Friedhof längst abgesperrt. Ein paar neugierige St. Oswalder flankierten die Pforte in der Hoffnung, sie könnten einen Blick auf das Geschehen in der Gräberanlage werfen. Ein Aufgebot an Einsatzfahrzeugen wie dieses blieb natürlich nicht unbemerkt. Stern war sich sicher, dass bald der ganze Ort darüber Kenntnis erlangen würde. Doch sie waren hier durch Mauern vor neugierigen Blicken geschützt. Der Friedhof glich einer Festung, gerade jetzt, wo die Eingänge von Uniformierten bewacht wurden, die nur autorisierte Personen hindurchließen. Die Abschottung durch die Eingrenzung der Mauern war zwar gut für die Bestandsaufnahme des Tatortes, aber schlecht für die Ermittlungen, da der Täter wahrscheinlich seine Tat genauso ungestört hatte vollziehen können. Es würde schwer werden, Augenzeugen zu finden.
Stern übertrat die Schwelle zum Friedhof und erkannte sofort, wohin er sich wenden musste. Ermittler und Spurensicherer standen um eines der Gräber versammelt, als wären sie andächtig in ein Gebet versunken. Er konnte sich nicht erinnern, die Kollegen jemals so einträchtig gesehen zu haben. So friedlich …
Oder vor Schock gelähmt?
Denn üblicherweise waren sie geschäftig, jeder ging seiner Arbeit nach und ein reges Treiben beherrschte den Tatort. Als er näherkam, verstand er, was der Grund für ihr ungewöhnliches Verhalten war.
»Chef, wir haben auf Sie gewartet. Wir meinten, Sie sollen das genau so sehen, wie wir es vorgefunden haben«, empfing ihn Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht mit einer Erklärung anstatt eines Grußes. Die Körperhaltung der Leiche ließ Stern wissen, dass seine Kollegen richtig gehandelt hatten.
»Grüß euch«, sagte er abgelenkt, da sein Gehirn bereits die ungewöhnliche Darstellung auf dem Grab aufzunehmen versuchte.
Eine Person kniete inmitten von rosa blühenden Rosen auf einer mit Granit eingefassten Grabstätte, der Kopf hing nach unten, die Hände waren vor dem Leib mit Kabelbindern festgezurrt. Stern musste sich bücken, um dem Opfer ins Gesicht blicken zu können, damit er wusste, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. Es war eindeutig ein Mann, Mitte 30, schätzte er. Er erhob sich und umrundete das Grab. Die Kollegen wichen zurück, damit er auf den schmalen Wegen zwischen den Gräbern genügend Platz fand. Die Haare des Toten waren feucht, klebten ihm an Stirn und Nacken. Stern fragte sich, ob es letzte Nacht geregnet hatte, und sah sich auf dem Friedhof um. Alles war trocken, bis auf die Gräber, deren Besitzer die wenigen Blumen, die um diese Jahreszeit noch blühten, am Vortag gegossen hatten. Für Oktober war es ungewöhnlich warm, da mochte es schon gut sein, für ein wenig zusätzliche Feuchte zu sorgen. Aber wenn es nicht geregnet hatte, wieso war das Opfer dann nass?
»Was hältst du davon?«, fragte Gruppeninspektor Hermann Kolanski seinen Vorgesetzten mitten in dessen Überlegungen hinein. Er trug wie immer seine abgewetzte Lederjacke, Jeans und Cowboystiefel. Die Sonnenbrille hatte er auf sein Haupt hochgeschoben, um die Leiche auf dem Grab ungefiltert betrachten zu können. Wie üblich waren seine dunklen Haare viel zu lang, doch Kolanski pflegte die Wildnis auf seinem Kopf wie andere Männer ihren Wagen.
Stern ließ sich mit einer Antwort Zeit. »Der Täter hat ihn in Pose gebracht. Betend. Aus welchem Grund auch immer«, fasste er in wenigen Worten zusammen.
Der Anblick war in der Tat ungewöhnlich. Die zusammengebundenen Hände des Mannes waren vor dessen Brust derart positioniert, dass man meinen könnte, er würde beten. Den Kopf hielt er dabei geneigt, was den Anschein erweckte, er täte es aus Demut und nicht, weil er tot war. Durch die etwas zur Seite gestellten Beine konnte er nicht umkippen. Der Täter hatte sich Mühe gegeben, den Torso so auszurichten, dass er im Gleichgewicht war, und die Totenstarre tat ihr Übriges dazu.
»Was will der Täter damit andeuten? Dass das Opfer ein frommer Mann gewesen ist?«, stellte Grünbrecht eine berechtigte Frage.
»Oder vielleicht das genaue Gegenteil, dass er es nötig gehabt hat, im Angesicht des sicheren Todes seinem Herrn zu huldigen, um doch noch in den Himmel zu gelangen, wenn man an diese religiösen Dinge glaubt«, warf Gruppeninspektor Edwin Mirscher ein.
»Ich will, dass genügend Fotos von der Leiche gemacht werden, und zwar so, wie sie in Pose gebracht ist. Kennen wir den Namen?«
»Oliver Koch. 35 Jahre alt. Regionalpolitiker, wenn man dem Totengräber Glauben schenken darf«, spulte Grünbrecht herunter.
»Dem Totengräber?«, echote Stern.
»Johannes Blöchinger. Er hat die Leiche heute Morgen gefunden. Er wartet dort drüben auf uns.«
Sterns Blick folgte Grünbrechts Fingerzeig und wanderte hinüber zu einem Kreuz in der Mitte des Friedhofes, von wo ein Mann in Arbeitsklamotten und mit einem Spaten, auf dem er sich abstützte, zu ihnen herübersah und sie beobachtete. Ihn würde er später vernehmen.
»Hat es heute Nacht geregnet?«, fragte er.
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortete Mirscher.
»Prüft das nach! Denn wenn es in Linz nicht geregnet hat, heißt das noch lange nicht, dass das in St. Oswald auch der Fall gewesen ist«, befehligte Stern und widmete sich den Händen des Opfers. »Hier! Er hat eindeutig Abwehrverletzungen. Seine Fingerkuppen sind wundgescheuert.« Stern deutete auf die Hände des Toten. »Jedoch dort, wo die Kabelbinder sind, kann ich keine Verletzungen erkennen. Sie haben sich nicht ins Fleisch gegraben.«
»Das bedeutet, dass der Täter die Hände des Opfers erst nach dessen Tod mit Kabelbindern festgezurrt hat«, meldete sich Weber zu Wort. »Außerdem hat er einen Schlag auf den Hinterkopf abbekommen. Das ist zwar nicht auf Anhieb auszumachen, da er nur eine Beule und eine kleine Platzwunde hat, aber ich bin mir sicher, wenn ich ihm den Schädel öffne, dass das umliegende Gewebe, und vielleicht auch die Schädeldecke, meine Vermutungen bestätigen werden.«
»Kann die Kopfverletzung von einem Sturz stammen?«
»Eher unwahrscheinlich. Da sie weit oben am Kopf ist, müsste das Opfer schon ziemlich blöd gefallen sein«, zeigte sich Weber hinsichtlich dieser Theorie skeptisch. »Aber wie sag ich immer: Es gibt nichts, was es nicht gibt.«
»Ist er an dem Schlag gestorben?«, fragte Stern weiter, ohne auf Webers von sich gegebene Kalender-Weisheit einzugehen.
»Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete der Gerichtsmediziner. »Was ich dir bislang erzählt habe, war eine Ferndiagnose, weil ich das Opfer noch nicht anrühren durfte. Deine Kollegen wollten ja unbedingt, dass du es so siehst, wie es der Täter für uns zurückgelassen hat.«
»Für uns? Dann sendet er uns deiner Meinung nach eine Botschaft?«, hakte Stern nach. Auch wenn er und Weber sich oftmals uneins waren und sie dieser »Wer-als-Erster-am-Tatort-ist-Wettstreit« zu Konkurrenten machte, interessierte ihn dessen Meinung. Schon allein deswegen, da Weber heute noch keinen abfälligen Kommentar, weil Stern nach ihm am Friedhof eingetroffen war, abgelassen hatte. Dieser ständige Schlagabtausch gehörte zu jedem neuen Fall dazu wie ein Semmelknödel zu einem ordentlichen Schweinsbraten.
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht«, entwand sich Weber einer Bestätigung dessen, was er zuvor angedeutet hatte. »Es kann nämlich durchaus sein, dass der Tote nur ein Stoßgebet zum Himmel schicken wollte, damit du ein wenig beherzter aufs Gaspedal drückst und als Erster am Tatort erscheinst.« Weber grinste. Die endlich ausgesprochene Stichelei des Gerichtsmediziners brachte Sterns Weltbild, wie die Dinge zwischen ihnen beiden standen, wieder in Ordnung, wenngleich Webers nächste Frage ihn erneut unter Strom setzte: »Wieso bist du überhaupt so spät dran? Du wohnst ja allein, da müsste es demnach doch viel schneller gehen, dass du hier bist.«
Webers Frage ignorierend sagte Stern patzig: »Wenn du eh schon so lange vor mir dagewesen bist, kannst du mir sicher sagen, wann unser Opfer gestorben ist.« Denn natürlich ärgerte es ihn, dass Weber vor ihm in St. Oswald eingetroffen war, wie es ihn auch ärgerte, dass die Katzenfamilie Schuld daran trug, dass er morgens immer etwas länger brauchte, bis er die Wohnung verlassen konnte. Aber er wollte seinen Kollegen natürlich nicht auf die Nase binden, dass er, der beinharte Chefinspektor der Mordgruppe am Landeskriminalamt Oberösterreich in Linz, nicht in der Lage war, eine fremde Katzenfamilie in ein Tierheim zu verfrachten. Wie ließe ihn das denn dastehen? Da war es besser, die Kollegen stellten wegen seiner seit Wochen beinahe täglichen Verspätungen irgendwelche Spekulationen an, die ohnehin nicht zutrafen.
»Das könnte ich, wenn ich ihn mir mal genauer ansehen dürfte«, konterte Weber sofort.
Nachdem der Polizeifotograf Fotos vom Leichenfundort gemacht hatte, gab Stern dem Gerichtsmediziner zu verstehen, dass der Tote ihm gehörte. Weber kniete sich zu dem Opfer hinab und begann mit der Untersuchung vor Ort. Dafür öffnete er seinen mitgebrachten Koffer und zog Skalpell und ein Thermometer heraus, um zu allererst die Temperatur des Leichnams zu messen, die er für die Bestimmung des Todeszeitpunktes benötigte.
»Nehmen Sie sich Webers Sticheleien nicht so zu Herzen«, sagte Grünbrecht nahe Sterns Ohr, während sie beobachteten, wie der Gerichtsmediziner die Leiche in eine waagrechte Position brachte, ihr einen kleinen Schnitt im Rumpf verpasste und das Thermometer einführte, um die Temperatur der Leber zu messen.
»Das tue ich nicht«, gab Stern erstaunt zurück. Bislang hatte er angenommen, dass er seine aufwallenden Emotionen Weber gegenüber stets gut im Griff gehabt und vor den anderen hatte verbergen können. Wie es aussah, war das nicht der Fall.
»Dann ist es ja gut«, erwiderte Grünbrecht. »Gibt es vielleicht etwas, das Sie uns erzählen möchten? Warum Sie in letzter Zeit immer so spät dran sind?«, nutzte sie die Gelegenheit, solange sie auf Webers Einschätzung des Todeszeitpunktes warteten, ihn ihrerseits auf sein vermeintliches Geheimnis anzusprechen. Stern fiel auf, dass die anderen Kollegen unauffällig näherkamen. Anscheinend wollten sie mithören, was er antwortete.
»Nicht, dass ich wüsste«, brummte er.
»Eine Frau vielleicht?«, sprach Mirscher aus, was alle dachten.
»Ihr spinnt ja!«, fuhr Stern ihn an.
»Das würde erklären, warum du jeden Tag als Letzter ins Büro kommst«, schloss sich Kolanski der scheinbaren Verschwörung an.
»Interessiert sich vielleicht noch jemand für den Toten? Oder wollen alle lieber über Sterns Liebesleben plaudern?«, fragte Weber leicht pikiert, während er die Leiche weiter untersuchte.
Stern schüttelte ob der Spinnereien der Kollegen den Kopf und bat den Gerichtsmediziner, er möge doch bitte seine Erkenntnisse mit ihnen teilen.
»Der Todeszeitpunkt ist keine zwölf Stunden her, eher zehn. Die Leichenflecken an Beine und Gesäß sind voll ausgeprägt und konfluiert, lassen sich aber noch wegdrücken. Die Totenstarre ist am ganzen Körper ausgebildet, das bedeutet, dass der Tod vor mindestens acht Stunden eingetreten ist. Das alles deckt sich mit der Körpertemperatur, die bei diesen Temperaturen – in der Nacht hatte es an die 10 Grad – im Durchschnitt um 0,5 Grad Celsius pro Stunde sinkt. Zusammengefasst würde ich meinen, dass der Todeszeitpunkt zwischen 23 Uhr und 1 Uhr liegt«, gab Weber das Ergebnis seiner Untersuchung bekannt.
»Todesursache?«, fragte Stern knapp.
»Das Opfer ist erstickt oder ertrunken«, sagte Dominik Weber.
»Ertrunken?«, echote Stern.
»Ja. Oder erstickt. Petechiale Stauungsblutungen weisen darauf hin. Sie sind zwar nur gering ausgebildet, aber das könnte daran liegen, dass das Opfer nicht die Möglichkeit hatte, während des Todeskampfes nach Luft zu schnappen.«
»Was heißt ertrunken?«, hakte Stern nach und sah sich demonstrativ um. »Wir sind auf einem Friedhof, da gibt es nichts, wo man ertrinken könnte.«
»Dort drüben bei dem Kreuz ist ein Trog«, sagte Grünbrecht.
»Und? Ist Wasser drin?«
»Staubtrocken«, ließ ihn die Gruppeninspektorin wissen.
»Das ist dann wohl euer Problem«, erwiderte Weber. »Und nicht meines.«
»Seine inzwischen angetrockneten Haare und die bis zur Brust feuchten Klamotten sprechen für Webers Theorie«, schloss sich Grünbrecht der Meinung des Gerichtsmediziners an und deutete auf die unterschiedliche Farbgebung der Kleidung. »Seht ihr die dunklen Flecken auf dem Hemd? Die reichen bis zur Brust oder dem Bauch. Die Hose hingegen ist beinahe trocken.«
»Nach der Obduktion werden wir Gewissheit haben. Wenn das Opfer ertrunken ist, finde ich Wasser in der Lunge«, sagte Weber und packte die Instrumente in den Koffer.
Stern, der dem Gespräch etwas ratlos gefolgt war, fragte: »Könnt ihr mir verraten, warum jemand einen ersäuft und ihn anschließend auf einen Friedhof schafft?«
»Und ihn derart zur Schau stellt?«, ergänzte Weber.
»Vielleicht war’s ja ein Unfall«, schlug Mirscher ein wenig naiv vor. »Und derjenige, der ihn gefunden hat, hatte nicht den Mumm, die Polizei zu verständigen, sondern hat ihn hierher zum Beten gebracht, weil sich das so gehört … oder so.«
»Warum hat er ihn nicht einfach liegen lassen, dort, wo er ihn angeblich gefunden hat? Wäre das nicht die normale Reaktion?«, warf Grünbrecht ein, und Mirscher zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht ist er im Maria Bründl ertrunken«, stellte Kolanski eine These auf.
»Im Maria Bründl? Was ist das denn?«, wollte Grünbrecht von ihm wissen.
»Es gibt hier etwa zwei Kilometer außerhalb von St. Oswald im Wald eine Heilquelle, das ist das Maria Bründl. Sie zieht die Menschen, die an die Heilkraft von solchen Gewässern glauben, scharenweise an«, erklärte Kolanski.
»Kolanski, unsere wandelnde Wikipedia«, äußerte sich Mirscher durchaus anerkennend.
»Wenn der Tote krank gewesen ist, hat er vielleicht versucht, sich in dem Wasser von dieser Krankheit zu heilen und ist dabei ausgerutscht und ertrunken«, spekulierte Kolanski weiter. »Das würde zu der Verletzung an seinem Schädel passen. Wenn er sich den Kopf gestoßen hat und dadurch bewusstlos geworden ist …« Kolanski ließ das Ende des Satzes offen. Es wusste ohnehin jeder, was er ausdrücken wollte.
»Und wie ist er auf das Grab gekommen? Zu Fuß ja wohl kaum.«
»Da sind Schleifspuren.« Kolanski deutete rechts vom Grab auf zwei sanfte Rinnen im Kies des Weges. »Es sieht zwar so aus, als ob der Täter versucht hätte, den Weg wiederherzurichten, da die Spuren an dieser Stelle enden«, Kolanski machte drei Schritte vom Grab weg und wies zu seinen Füßen hinab, »aber wenn man genau hinsieht, kann man zwei Vertiefungen erkennen. Wahrscheinlich von den Schuhen des Opfers, die sich tief in den Kies gegraben haben. Die Kratzer auf seinen Halbschuhen würden diesen Schluss durchaus zulassen.«
»Warum soll der Täter das Opfer von der Maria-Bründl-Quelle hierhergebracht haben?«, fragte Grünbrecht.
»Tja, das müssen wir noch klären.« Kolanski steckte die Daumen in die Gürtelschlaufen seiner Hose und starrte auf den Toten, als wartete er auf dessen Kommentar.
»Die Kabelbinder hat er sich gewiss auch nicht selber angelegt und festgezurrt«, antwortete stattdessen Grünbrecht.
»Aber es würde erklären, warum er betet«, warf Mirscher ein. »Ich meine, warum ihn jemand als betend dargestellt hat«, stellte er richtig. Schließlich beteten Tote nicht mehr.
»Blödsinn! Was ihr da von euch gebt, gehört in ein Märchenbuch und nicht in einen Polizeibericht«, bereitete Stern den wilden Spekulationen ein Ende. Dennoch blieb ebenso für ihn die Auffindeposition des Toten ein Rätsel. Um keinen Fehler zu begehen, wenn doch etwas an dieser Heilwasser-Theorie dran sein sollte, sagte er zu Weber, dass er den Toten bei der Obduktion auf etwaige Krankheiten untersuchen solle. Allzu groß schätzte er die Wahrscheinlichkeit allerdings nicht ein, dass das Opfer tatsächlich krank gewesen war. Schließlich stand es mit seinen 35 Jahren gerade in der Blüte seines Lebens.
»Erzählt mir mehr über den Toten«, verlangte Stern von den Kollegen.
Grünbrecht zückte ihren Notizblock und las vor. »Also, Oliver Koch befand sich am Anfang seiner politischen Karriere. Er gehörte der rechten Partei an, war verheiratet und hatte ein Kind.«
»Weiter?«, hakte Stern ungeduldig nach.
Grünbrecht klappte ihren Notizblick zu und sagte: »Nichts weiter. Wir haben erst mit den Ermittlungen angefangen. Das Wenige, was ich Ihnen über Oliver Koch sagen kann, weiß ich vom Totengräber. In so einem kleinen Ort kennt jeder jeden. Obwohl gut gekannt hat er den Koch anscheinend nicht, das behauptet er zumindest.«
»Interessant«, brummte Stern.
»Wahrscheinlich war dieser Koch seiner Meinung nach in der falschen Partei, und er wollte nicht, dass wir denken, dass er auch zu denen gehört.«
Ein Totengräber, der eine Leiche findet, sinnierte Stern. Das Ganze mutete ziemlich ungewöhnlich an, ganz egal, zu welcher Fraktion der Tote gezählt hatte.
»Kommen Sie, Grünbrecht, wir beide reden mit dem Mann. Die Spurensicherung soll den Friedhof nach einem Gegenstand absuchen, mit dem man das Opfer niedergeschlagen haben könnte. Und natürlich suchen wir nach dem Tatort. Haltet Ausschau nach etwas, das dafür infrage kommt, jemanden zu ertränken. Mirscher und Kolanski, ihr beide befragt die Leute vor dem Friedhof. Vielleicht ist jemand dabei, der etwas gesehen hat.«
Stern schritt seiner Kollegin voran in Richtung des Kreuzes, das im alten Teil der Gräberanlage in der Mitte auf einem Betonsockel thronte und die Toten zu bewachen schien. Von dort aus beobachtete der Totengräber nach wie vor das Geschehen neugierig. Stimmt schon, so ein Mord auf einem Friedhof war etwas Besonderes, dachte Stern, ebenso, dass dieser Fall ganz St. Oswald aus seinem friedlichen Dornröschenschlaf rütteln würde. Plötzlich gab es einen Mörder in den eigenen Reihen. Sie würden sich gegenseitig verdächtigen, etwas mit dem Tod von Oliver Koch zu tun zu haben. Misstrauen und Denunzierungen würden ab heute Einzug in die Bevölkerung halten und gedeihen wie Unkraut auf einem wohlgenährten Boden.
»Chefinspektor Oskar Stern, das ist meine Kollegin Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht«, stellte Stern sich und seine Kollegin dem Totengräber vor. »Wie heißen Sie?«
»Hans Blöchinger. Eigentlich heiß’ ich ja Johannes, aber alle sag’n Hans zu mir. Ist kürzer. Kann man sich leichter merk’n«, sprudelte es aus dem Angesprochenen heraus.
Na gut, eine Leiche zu finden war keine alltägliche Sache, da war Erregung schon angesagt, dachte Stern und hoffte, dass der Mann in seiner Aufregung nichts angefasst hatte. Dann nämlich würden sie am Tatort seine Fingerabdrücke finden, vielleicht sogar auf dem Opfer. »Sie haben den Toten entdeckt?«
»Ja, heut’ Morgen. Ich wollt’ ein Grab ausschaufeln für eine andere Leich’, für eine frische. Aber die hier ist noch frischer.« Der Totengräber deutete hinüber auf das Grab, auf dem das Opfer gefunden worden war, das gerade von zwei in weißen Overalls steckenden Männern in einen grauen Blechsarg gehoben wurde. »Die andere Leich’ ist nämlich schon 83 Jahre alt, ist also schrumpelig. Eine Frau ist es.«
»Ist Ihnen bei dem Toten irgendetwas aufgefallen, das außergewöhnlich ist?«, fragte Stern.
»Wenn S’ mich frag’n, ist bei der Leich’ alles außerg’wöhnlich«, antwortete Blöchinger, und Stern gab ihm in Gedanken recht. »Sonst sterb’n die Leut’ ja im Bett oder auf der Straß’n. Oder werd’n erschossen wie in Amerika. Aber so …« Erneut zeigte der Totengräber hinüber zu jener Stelle auf dem Friedhof, von wo sich die Männer gerade mit dem geöffneten Sarg auf den Weg in die Gerichtsmedizin machten, da sich der Sargdeckel aufgrund der Totenstarre der Leiche nicht schließen ließ. Dort würde ihm Dominik Weber alle Geheimnisse entlocken, die er vor ihnen verbarg. Ob er tatsächlich ertrunken oder an dem Schlag auf den Kopf gestorben war. Und ob er tatsächlich an einer schweren Krankheit gelitten und Heil im Quellwasser von Maria Bründl gesucht hatte. Ein Unfall war nicht auszuschließen, wenngleich er äußerst unwahrscheinlich war. Aber vielleicht hatte tatsächlich jemand die Leiche gefunden und sie aus Angst, mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden, hierhergeschafft, ohne sich zu erkennen zu geben. Die festgezurrten Hände deuteten jedoch eher auf vorsätzlichen Mord und eine Zurschaustellung des Opfers hin. Deshalb würden sie die Unfalltheorie nicht weiter verfolgen. Für Stern lag ohnehin auf der Hand, dass es sich um Mord handelte. Die in Pose gebrachte Leiche sprach eindeutig dafür.
»Haben Sie jemanden auf dem Friedhof gesehen, der Ihnen verdächtig vorkam?«
»Na! Zu so früher Stund’ sind noch keine Leut’ auf ’m Friedhof. Da bin ich immer allein«, erklärte Blöchinger. Er wirkte nun etwas entspannter als zu Beginn der Befragung.
»Was haben Sie eigentlich so früh hier gemacht?«, wollte Grünbrecht von dem Totengräber wissen.
»Ich hab ja schon g’sagt, dass ich ein Grab ausheben muss, für die alte Frau, die vor ein paar Tagen g’storben ist. Die ist friedlich entschlafen. Zumindest denken das alle, weil wiss’n tut man so etwas ja eigentlich nie«, erwiderte Blöchinger.
»Gibt es einen begründeten Anlass für diese Spekulation?«, fragte Stern. Ein zweites Opfer würde ihm gerade noch fehlen.
»Nein! Aber wiss’n tut man es trotzdem net.«
Stern verdrehte ungewollt die Augen. »Dafür gibt es die Totenbeschau, Herr Blöchinger. Damit alles seine Ordnung hat und keine Gewalttat als natürlicher Tod durchgeht.«
»Kann ich weiterarbeit’n? Am Nachmittag ist das Begräbnis der Frau, und da muss ich mich wirklich beeilen, dass ich das schaff’«, erklärte der Totengräber. »Das ist nämlich net klass’, wenn die Familie kommt und den Sarg net in die Erde reinlassen kann. Stellen S’ Ihnen das mal vor!«
»Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das Begräbnis am Nachmittag überhaupt stattfinden kann. Der Friedhof ist schließlich ein Tatort, und wir müssen zuerst alle Spuren sichern«, sagte Stern.
Der Totengräber nahm die Nachricht mit Bestürzung auf. »Das geht net! Bei uns ist noch nie ein Begräbnis abg’sagt word’n! Das ist ja net wie ein Konzert oder eine Party. Das ist eine Leich’, und die Leich’ vergammelt, wann die net unter die Erd’ kommt.« Auf seinem Gesicht wechselten Unglaube und Entsetzen einander ab. Anscheinend konnte er Sterns Worte nicht glauben, noch viel weniger wollte er sie an die Betroffenen weiterleiten, die dadurch vor einem unangenehmen Problem stünden, wofür Stern dann doch Verständnis aufbrachte.
»Wo wollen Sie denn graben?«, frage er.
»Dort drüben, gleich hinter dem schönen Kreuz von unser’m Herrn Pfarrer. Dort, wo die neuen Gräber alle sind. Dort muss ich graben.« Blöchinger deutete in die angesprochene Richtung, hinüber in den neuen Teil des Friedhofes, wo eine grüne Rasenfläche zu sehen war. Offensichtlich hatte man in St. Oswald vorgesorgt und den Friedhof erweitert, damit jeder Tote seinen Platz in geweihter Erde fand.
»Das ist okay. Wenn Sie in diesem Teil des Friedhofes bleiben, dürfen Sie das Grab ausheben«, entschied Stern und ließ den Totengräber ziehen. Er war zweifelsohne ein einfacher Mann, jedoch einer, der seine Arbeit äußerst ernst nahm.