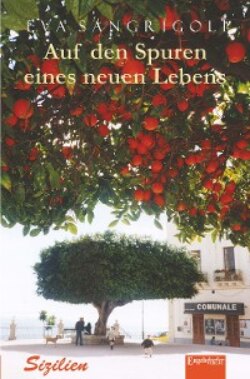Читать книгу Auf den Spuren eines neuen Lebens - Eva Sangrigoli - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel
Domenico aus Randazzo
ОглавлениеGanz oben, auf dem Kamm der Hybläer Berge, bevor sich die Staatsstraße durch weiße Kalkfelsen schlängelt, bietet sich dem Passanten ein zauberhafter Blick hinunter auf die Ebene, „la Piana“ von Catania. Bei gutem Wetter ist die Sicht so klar, dass hinter dem sich weit hinziehenden grünen Teppich der immergrünen Zitronen- und Orangenplantagen der Ätna zu erkennen ist. In den Zeiten zwischen November und April lässt er majestätisch sein vom Schnee bedecktes Haupt erkennen. „Mongibello“, der „schöne Berg“, herrscht über dieser Szenerie und bildet gleichzeitig die nördliche Grenze von Catania und seiner Ebene. Im Osten schließt sich das Ionische Meer mit seinen kilometerlangen Badestränden an, und an manchen Tagen trennt der weiße Streifen der Gischt das Blau des Wassers von dem grünen Teppich der Zitronenplantagen.
Einsam, wenige Meter von der Straße und Tankstelle entfernt, der Staatsstraße, die weiter nach Syrakus führt, steht ein kleines, rotes Haus. Auf einer Bank im Vorgarten sitzt ein alter Mann. Er beobachtet eine braune Bergziege, die an einen Ölbaum gebunden ist. Der Alte schreit ärgerlich dem Tier zu, das immer wieder wie närrisch an der Leine zieht. Gackernde Hühner picken auf dem Boden herum. Mit der hereinbrechenden Dämmerung erhebt sich der Alte. Er sperrt die Tiere in das Haus, in dem er danach selbst verschwindet.
„Es ist der alte Domenico“, sagt der Tankwart den neugierigen Passanten, wenn sie ihn danach befragen.
„Er hat seinen letzten Wohnsitz seinen Kindern überlassen und wohnt jetzt im Hause seiner Mutter.“
Domenico war ein Sonntagskind und hatte stets gute Laune. Überall wo er sich zeigte, bildete er den Mittelpunkt. Wenn er nach verrichteter Arbeit in Randazzo abends die Bar auf der Piazza betrat, war er im Handumdrehen von einer Schar Freunden umgeben. Immer zu Scherzen aufgelegt, vital und lebendig, in seiner Art zu sprechen, hatte er stets neues zu berichten. Alle mochten ihn, keiner sprach schlecht von ihm, da er weder zu den Armen, noch zu den Reichen zählte. Über die Reichen sprachen die Klatschmäuler aus Neid, über die Armen aus Verachtung, weil sie es nicht weiter gebracht hatten. Er lernte Maria zum Madonnenfest in Randazzo kennen und gehörte zu den Trägern, die in der Prozession das schwere Traggestell der „Vara“ durch die Straßen zogen. Da entdeckte er das Mädchen, das mit großen Augen, am Straßenrand, in Begleitung seiner Eltern dem feierlichen Treiben folgte. Sie war damals sechzehn und hatte wunderschöne, kastanienbraune Haare, und ihre Augen, die ihn in dem winzigen Moment des Vorübergehens streiften, hatten ihn verhext. Sie hieß Maria und wurde später seine Frau.
Sie lebten in Randazzo, in Domenicos Geburtsort, da er bei Signor La Rosa in einer kleinen Marmorfabrik arbeitete. Das Jahr 1937 brachte ihnen viel Neues: die Geburt ihres ersten Kindes Lorenzo und die Trennung voneinander. Domenico hatte sich für Spanien als Freiwilliger gemeldet, um auf der Seite Francos zu kämpfen. Die finanzielle Not, die hinter dem Schicksal der meisten Legionäre stand, war der Hauptgrund ihrer Entscheidung. Domenico dachte dabei an den guten Verdienst und an das Danach, an die viel verheißenden Versprechungen und Privilegien von „Vater Staat“ und Mussolini, dem Freund von Franco. Er träumte von einem beruflichen Neuanfang und einer persönlichen Unabhängigkeit im Bereich der Arbeit, und – Domenico war ein Abenteurer.
Maria die aus Lentini stammte, zog während der Abwesenheit ihres Mannes in ihr Elternhaus. Auch sie hatte eine schwere Zeit: Die Versorgung ihres neugeborenen Kindes und die Pflege des kranken Vaters, den sie mit der Mutter bis zu seinem plötzlichen Tode umsorgte, nahmen ihre ganze Kraft in Anspruch. Er, der Vater, gehörte zu den Landbesitzern in der „Piana, der Ebene von Catania“. Nach der Trockenlegung des Sumpfgebietes unter der Anordnung Mussolinis erwarb er seinen zweieinhalb Hektar großen Grundbesitz. Durch die Anpflanzung der rasch wachsenden Eukalyptusbäume konnte die Trockenlegung beschleunigt werden. Eine wichtige Aktion gegen die Malaria, die sich epidemisch ausgebreitet hatte. Sinn war es, den idealen Lebensraum der Anophelesmücke, Überträgerin der Krankheit, zu vernichten und die Ebene in ein fruchtbares Anbaugebiet für die Bauern zu verwandeln. Maria erbte nach dem Tod des Vaters seinen Grundbesitz und wurde Landbesitzerin. Sie freute sich besonders für Domenico und konnte es kaum erwarten, ihm diese Überraschung persönlich mitzuteilen. Sie betete jeden Tag, dass er gesund aus Spanien heimkehren möge.
Er kam gesund zurück und die Überraschung mit dem Grundstückserbe hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Domenico war mit dem Plan der beiden Frauen, von Randazzo nach Lentini umzuziehen einverstanden.
„Auch ich habe eine Neuigkeit zu melden“, sagte er. „Jetzt, wo Italien seine Kolonie in Afrika besitzt und ich beim Staat meine versprochenen Privilegien kassiere, wird einiges geschehen. Es lebe der Faschismus und Franco!“
„Und wie sehen deine Neuigkeiten aus“, erwiderte Maria?
„Ich gehe nach Afrika, nach Libyen, nach Bengasi, ein wenig Geld zu machen!“
Maria schrie auf und rief: „Sind wir verrückt geworden? Nach Afrika zu den ‚Neurazzi‘?“
„Maria, du kannst so nicht reden. Erstens sieht es dort aus wie bei uns, zweitens sind viele Italiener ausgewandert und es wird inzwischen dort mehr Weiße als Schwarze geben. Und drittens solltest du generell zwischen Schwarzen und Weißen keinen Unterschied machen.“ Maria schwieg.
„Ich habe vor, dort einen eigenen Betrieb zu eröffnen und Fußbodenplatten herzustellen. Die Arbeitskräfte sind dort sehr billig und wenn alles klappt, hole ich euch nach. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren das nötige Geld beisammen haben werden, um hier, daheim, mit einem guten Grundkapital etwas beginnen zu können. Wir müssen an unseren Sohn Lorenzo denken, er soll eine gute Zukunft haben.“
Maria wusste, dass sie es niemals erreichen würde, Domenico von seinem Plan abzubringen. Eine Woche später nahm er ein Schiff in Catania, mit dem Kurs Richtung Bengasi. Sein Begleitgepäck bestand aus einer Hand-Pressmaschine für die Herstellung von Fußbodenplatten, seinen persönlichen Habseligkeiten und einem Brief von einem Kriegskameraden, den er in Spanien kennenlernte, an einen Freund, der in Bengasi lebte. Jener sollte ihm bei seinem Neuanfang behilflich sein.
Während Domenico in Bengasi mit seinen Arbeitern Fußbodenplatten herstellte, spitzte sich die politische Lage in Europa immer mehr zu. Im Rausch seiner Zufriedenheit, dass sich der Traum seiner Selbständigkeit erfüllt hatte, nahm Domenico wenig Notiz davon. Begeistert schrieb er Maria von seinem Erfolg, dem guten Verdienst, berichtete von den Arbeitern, die ihn mochten. Über die Dankbarkeit eines Arbeiters, der so weit ging, ihm seine Frau anzubieten, verlor er wohlweislich kein Wort. Doch der afrikanische Traum war schnell vorbei. Wenn er nicht von seiner Familie abgeschnitten werden wollte, musste er rasch handeln. Er hatte ohnehin viel zu lange in Anbetracht der Unruhen und des sich anbahnenden zweiten Weltkrieges mit seiner Heimkehr nach Sizilien gewartet. Es ging alles so schnell, dass er sich wahrhaft glücklich preisen durfte, auf dem letzten Dampfer, der nach Sizilien fuhr, noch einen Platz zu bekommen. Dieses Mal hatte er kein Begleitgepäck, die Zeit eilte und so überließ er seine Pressmaschine seinen Arbeitern.
Domenico wurde wegen seines Alters nicht eingezogen. An Arbeit war nicht zu denken. Die Verantwortung über die Familie und wie es weiter gehen sollte, stand im Vordergrund. Der kleine Lorenzo weinte, als er von seinem Spanienkrieg zurückkam, ihn auf den Arm nahm und küsste. Domenico gab sich die größte Mühe es dem Kleinen recht zu machen, ihn freundlich zu stimmen.
Am 3. Juli 1943 begann ein intensiver Luftangriff gegen Sizilien. Die deutschen Soldaten, die ihre Position auf der Insel bezogen hatten, erlebten eine böse Überraschung, wie ein junger, deutscher Sanitäter in seinem Tagebuch vermerkte: „Zweiundzwanzig zählte ich bei der Landung der Alliierten auf Sizilien. Ich begriff erst am 10.07.1943 wie ernst es um uns stand.“
Vier Wochen nach Beendigung der Kämpfe in Tunesien besetzten die Alliierten auf ihrem Weg nach Sizilien, am 11. Juni, die Insel Pantelleria. Am 10. Juli begannen die Landungsoperationen der angloamerikanischen motorisierten Verbände an der Südküste zwischen Gela und Licata und der Ostküste in der Nähe von Syrakus. Alles geschah schlagartig. Die Bombardierung aus der Luft und vom Meer her war nicht mehr aufzuhalten.
„Die Italiener leisteten nur örtlichen Widerstand, oft feierten sie die Amerikaner als Befreier“, schreibt der junge, deutsche Sanitäter in sein Tagebuch. Und weiter: „Ich habe am 14.7.1943 in der Nähe von Caltagirone, an der Weggabelung, die nach Mineo führt, vier meiner Kameraden bestattet. Unsere Verwundeten haben wir mit Hilfe unserer Rot-Kreuzfahne bei Messina aufs Festland übergesetzt.“
„Ich muss nach Randazzo, nach meinen Verwandten schauen“, sagte Domenico. „In Catania ist die Hölle los. In der Via Etnea graben die Leute überall Löcher in die Erde, legen Bunker an, ihre Angst kennt keine Grenzen. Die Schwefelfabriken brennen und wenn es stimmt, was ich von Randazzo hörte, habe ich meine Bedenken!“
Maria weinte: „Du kannst doch jetzt nicht gehen“, schluchzte sie, „jetzt wo wir unseres Lebens gar nicht sicher sind, was mach’ ich bloß? Und du scheinst außerdem vergessen zu haben, dass ich wieder ein Kind erwarte.“
„Du gehst am besten mit deiner Mutter und Lorenzo zu euren Verwandten aufs Land. Ich bringe dich zu deinem Onkel, der sehr zuverlässig ist. Sobald ich kann, komme ich zurück.“
„Aber unser kleiner Renzino! Er hat sich gerade etwas von seiner Krankheit erholt, dank deinem Interesse, ihn herumzutragen.“
„Maria, bitte, mache es mir nicht noch schwerer, als die Lage ohnehin schon ist!“
Maria schaltete ihren Onkel ein.
„Du bist wohl lebensmüde“, sagte der Onkel ohne Umschweife. „Außerdem kommst du jetzt nicht weiter. Die Bahnlinien sind zerstört, die Circum Etnea, die nach Randazzo führt, ist unterbrochen. Was du bei all dem vergessen hast ist, dass Maria und wir dich brauchen. Unsere Lebensmittelvorräte sind zu Ende, wir müssen zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Ich habe mich erkundigt, die Lage sieht sehr ernst aus.“
Es stellte sich heraus, dass Domenico in der Beschaffung von Lebensmitteln eine besondere Begabung an den Tag legte. Er hatte gelernt, Arbeit zu delegieren und befahl den ewig Wartenden mit anzupacken, mit ihm auf die Felder zu gehen Ähren zu lesen, Obst und Wildgemüse zu sammeln. Endlich bekam er als Heimkehrer von seinem Spanienkrieg, als Privilegierter eine Entschädigung in Lebensmitteln. So überlebten sie.
„Nach 38 Tagen Kampf verließen wir auf einer Siebelfähre, im Schutz der Vierlingsflak die Insel und kehrten auf das Festland zurück“, lauten die letzten Eintragungen des deutschen Sanitäters in sein Tagebuch.
Domenico war erschüttert, als er von seinem Ausflug nach Randazzo heimkehrte. „Alles kaputt“, sagte er und wurde still. Dann fuhr er fort: „Das Haus meines Vaters steht nicht mehr. Gottlob musste meine Mutter dieses Unglück nicht miterleben. Wenn ich daran denke, wie jung sie war, als sie starb. Wo sie doch zu den fleißigsten Kirchgängerinnen zählte! Sparen konnte sie, wie keine andere und hat nur von dem Erlös unseres Weines das Geld für den Kauf unseres Hauses zusammen bekommen. Sie lebte so bescheiden! Maria und weißt du, was ich bis heute nicht verstehe? Dass meine Mutter früh morgens um sechs Uhr beim Beten in der Kirche starb! Und da faselst du mir von einem Gott!
Randazzo ist ein Trümmerfeld. Unsere schönen Kirchen! San Giuseppe in unserem Ort haben sie dem Boden gleich gemacht. Die Bewohner sind erledigt. Und der Aufstand der Separatisten hat allem eine Krone aufgesetzt: blutige Kämpfe, zwischen Militär und unseren Rebellen. Die Leute reden, dass wir gleich nach Montecasino mit der Zerstörung folgen.“
„Und deine Verwandten“, wollte Maria wissen?
„Sie leben alle. Sie haben sich beizeiten auf dem Land, hoch oben auf dem Ätna, in alten Hütten versteckt. Vater geht es nicht gut. Er wohnt bei seiner Schwester, die ihn versorgt. Als die Amerikaner von den Waffenlagern der Deutschen hörten, ging es mit den Angriffen erst richtig los. Randazzo hieß das Stichwort.“
„Und die Waffenlager, wo befanden sich die Waffenlager?“
„Auf dem Ätna. Im Grunde eine geniale Idee. Doch haben Spione, stelle dir vor, unsere eigenen Leute, bei den Amerikanern mit ihren Informationen ihr dickes Geld verdient!“
„So war alles eine sinnlose Zerstörung?“
„Genau das kann man sagen: eine sinnlose Zerstörung. Der Rückzug der Deutschen erfolgte über die Brücke des Alcantaraflusses, die sie nach ihrer Überquerung sprengten. Weiter ging es über die Berge, Richtung Messina.“
Maria wurde unruhig. Sie dachte an den Plan, den sie mit Domenico besprochen hatte, Lorenzo als Externen, wenn er seine drei Grundschuljahre absolviert hatte, in Randazzo bei den Salisianern einzuschulen. Er sollte humanistisch gebildet werden.
„Das Schlimme ist“, sagte Domenico, der ihre Gedanken erriet, „dass der Paratyphus viele kleine Kinder, besonders Buben, dahingerafft hat. Von einer Schuleröffnung ist noch keine Rede. Doch haben die Bombardierungen wenigstens die Gebäude von Don Bosco verschont.“
Dann wurde auch Lorenzo krank. Dank der sorgfältigen Pflege von Maria und einem Universitätsprofessor von Catania, den man hinzugezogen hatte, überlebte der Kleine. Wie Maria immer wieder betonte: „Dank der Heiligen und Gottes Hilfe!“
Maria, die sich nach einem ruhigen und geordneten Leben mit Domenico sehnte, vor allem, ein Leben mit einem Mann an ihrer Seite, kam auf die Privilegien der aus Spanien zurückgekehrten Legionäre zu sprechen und meinte: „Domenico, warum ziehst du nicht eine Staatsstellung in Betracht? Du hättest ein sicheres Gehalt, könntest zur Bahn zum Beispiel …“
„Niemals“, erwiderte Domenico. „Maria, du hast vergessen, dass ich ein freier Mann sein will! Beginnen wir mit dem neuen Leben als Grundstückbesitzer, schließlich bin ich der Sohn eines Bauern!“
Er hatte keinerlei Probleme sich seinem neuen Umfeld an zu passen. Er freundete sich mit seinem Nachbarn, Benito, dem Gärtner an, der ihn als Gehilfen zur Arbeit mitnahm, ihm das Pfropfen und Schneiden von Bäumen beibrachte. Benito war ein Redner und außergewöhnlich gebildet.
„Mein Hobby ist Geschichte“, sagte er. „Bedenken mit dem Berufswechsel? Wir sind das anpassungsfähigste Volk der Erde!
Glaube mir, das schaffst du. Das haben andere in sehr viel schwierigeren Momenten auch bewältigt. Ich denke dabei an die Einwohner von Mascali, die nach dem Ätnaausbruch im Jahre 1928 alles verloren haben. Die Zeit nach dem Unglück war eine harte Zeit, obgleich die Bewohner schon in einem halben Jahr wieder ein Dach über ihrem Kopf hatten, wie mir mein Vater erzählte. Mussolini hatte dadurch bei den Bauern einen besonderen Stellenwert. Die Lava glühte lange noch. Mascali steht heute in Küstennähe, weit entfernt des alten, zerstörten Ortes in dem vorwiegend Weinbauern lebten. Da hast du das Beispiel: Heute sind es Fischer, Kaufleute, kleine Unternehmer, vor allem der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Mascali ist heute ein beliebtes Einkaufszentrum.“
„An dir ist ein Avvocato (Advokat) verloren gegangen“, entgegnete Domenico und begann mit den Vorbereitungen. Benito zeigte sich als wahrer Freund, da er ihm Kundschaft besorgte. Nun verschnitt und pfropfte Domenico Bäume, arbeitete nach Wunsch und Bestellung in Gärten und auf Ländereien, die je nach Jahreszeit verschiedener Pflege bedurften. Seine Haut war gebräunt, er fühlte sich stark und gesund, scherzte wieder gern und erlaubte sich so manchen Spaß. Nicht selten kam es vor, dass er bei einem Händedruck, besonders bei jungen Mädchen, so fest zugriff, dass ein Aufschrei kommen musste und er seinen Spaß daran hatte. Aus alter Gewohnheit trug er eine Baskenmütze, die ihn im Winter vor Kälte, im Sommer vor der glühenden Sonne und gegen alles Ungeziefer, was von den Bäumen fallen konnte, schützte. Er hatte vor, mit Marias Einverständnis, ihre Weinlandschaft in einen Orangen- und Zitronengarten zu verwandeln. Mit dem Obst versprach er sich einen besseren Gewinn. Benito und zwei Freunde aus Randazzo, sowie ein ehemaliger Kollege, Spezialist auf dem Sektor der Bewässerung, halfen ihm dabei.
Die Nähe des Flusses erleichterte die Arbeit und so kamen sie gut voran. Maria erschien jeden Mittag mit der kleinen Tochter Agata und dem eingepackten Mittagessen zur gewohnten Zeit. Alles hatte seine Richtigkeit. Man saß zusammen, aß gemeinsam, ganz so wie früher, als Marias Vater noch lebte und sie ihren Spaß zur Weinlese miteinander hatten.
Sie pflanzten Orangen-, Zitronen- und Mandarinenbäume und als Abgrenzung zum Grundstücknachbarn Olivenbäume.
Die Zeit verstrich. Lorenzo besuchte als Externer das „Instituto Salisiani San Basilio“ in Randazzo. Er wohnte bei Verwandten. Domenico hatte mit Maria seine Not, die unter der Trennung von Lorenzo litt. Doch sah sie schließlich ein, dass sie die Zukunft ihres Erstgeborenen nicht gefährden durfte.
An den Wochenenden kam ihr Junge heim und brachte die neuesten Meldungen aus Randazzo mit. Nonno, dem Großvater, ging es gar nicht gut, so dass Domenico häufiger als gewohnt, seinen Vater in Randazzo besuchte, der, wie der Arzt bemerkte: „… an den Folgen des Krieges zerbrochen ist. Sie müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen“, sagte der Arzt. Dann kam die Nachricht von seinem Tod.
Endlich gab es die erste große Ernte. Eine Ernte, die sich sehen lassen konnte. Domenico lud großzügig zum Orangenpflücken seinen Schwager und dessen Familie ein.
„Nehmt euch so viel mit, wie ihr wollt“, verkündete er und beschenkte Freunde und Verwandte mit den kostbaren Früchten. Es waren weit und breit die größten und schönsten.
„Warum verkaufst du die Ernte nicht und verschenkst so viel“, ermahnte ihn Maria, „wir müssen unsere Tochter verheiraten, bei ihrer Wäscheaussteuer fehlt noch einiges. Sie sollte wenigstens von allem ein Duzend haben.“
Domenico, ausgelassen und zufrieden, hatte anderes in seinem Kopf. Er nahm Maria an die Hand und führte sie in die Küche, wo ein Korb der schönsten Orangen auf dem Boden stand. „Frau, siehst du gar nichts, es sind die herrlichsten Früchte, die ich je gesehen habe“, rief er aus. Eifrig griff er nach einem Messer und schnitt eine Orange in der Mitte durch. Wie im Rausch presste er die halbierte Frucht zwischen seinen kräftigen Händen und ließ den Saft auf den Boden fließen. „Schau dir das an! Hast du schon einmal so etwas gesehen! Alles aus einer einzigen Frucht!“
Einen Tag später, als er mit seinem kleinen Lieferwagen, seiner „Ape“ heimkehrte, eilte ihm Maria entgegen und rief: „Hast du gut verkauft?“
„Verkauft? Die Leute haben mir das Obst aus den Händen gerissen, wenn du es wissen willst“, ereiferte sich Domenico. Lustig blinzelte er mit seinen Augen, wie immer, wenn er übertrieb.
„Du musst den Preis erhöhen“, sagte Maria. „Fahre in die Bergdörfer, wo die Früchte nicht wachsen!“
„Mein Weib ist schlau“, dachte Domenico und er sprach mit Lorenzo darüber, der dem Vorschlag beistimmte und den Verkauf, wenn er an den Wochenenden und in den Ferien daheim war, in die Hand nahm. Domenico arbeitete indessen auf dem Land, pflügte den Boden unter den Bäumen, pflanzte Erbsen und Bohnen – es hatte genügend geregnet.
An einem Tag, als Domenico nach Hause kam, sah er Agata heulend am Tisch sitzen. Sie bemerkte ihren Vater nicht, und er, um den wahren Grund ihres Unglücks zu erfahren, verbarg sich hinter der Tür. Plötzlich stand sie auf und rief wütend: „Ich halte es hier nicht mehr aus. Jeden Tag die gleiche Symphonie! Während sich alle amüsieren, werde ich hier eingesperrt, in diesem verdammten Kaff! Ich möchte unter Menschen, hinaus in die Welt, Geld verdienen und vor allem weg von hier. Wo es außer Essen und Kinderkriegen auch noch andere Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt.“
„Gibt es hier etwa keine Arbeit?“, entgegnete Maria. „Immer noch liegt das Leinen uneingefasst im Schrank – und du sprichst von Arbeit!“
Weder die Mutter noch der Vater ahnten, was in Agata vorging. Nur Lorenzo, der Bruder, wusste es. Sie weihte ihn in ihre Geheimnisse ein. Doch Hilfe und Trost bekam sie von ihm auch nicht, da er ganz anders über ihre Angelegenheiten dachte. Er konnte es einfach nicht verstehen, dass seine Schwester nach Deutschland wollte. Für ihn kam ihr Begehren einem Verrat gleich. Wo anders sollte es besser als in seinem Sizilien sein? Wie viele Bekannte kehrten aus Heimweh nach einer Zeit der Auslandsarbeit wieder heim. Nicht, dass er rassistische Ansichten vertrat, vielmehr ärgerte ihn ihre Begeisterung zu einem Land, das ihm in seiner Mentalität sehr fremd erschien.
„Deutschland gefällt mir“, sagte sie ein anderes Mal, „die Art der Menschen sagt mir zu.“ Er wunderte sich, wie rasch sie die deutsche Sprache erlernte und erinnerte sich, wie mühelos sie sich im letzten Sommer am Lido von Catania mit Reisenden aus Deutschland unterhalten hatte.
„Sie hätte vor zwei Jahren nicht zu den Verwandten nach Deutschland fahren dürfen“, sagte Lorenzo zu seinem Cousin. Er musste sich aussprechen, einen Bruder hatte er nicht. „Sie ist Sizilianerin und war noch nie von zu Hause weg.“
Wenn Agata mit ihrem wippenden Gang durch die Straßen stolziert, schauen ihr alle nach. Die alten Frauen, die mit ihren Handarbeiten vor ihren Häusern sitzen, erheben ihre Augen, schütteln ihre Köpfe. Die jungen Mädchen, die in Gruppen beieinander stehen, kichern spöttisch. Und die frechsten der jungen Burschen pfeifen oder schreien ihr nach. Die einzigen, die sie bewundern, sind gewisse alte Männer, geil blitzt es in ihren Augen, wenn sie ihrer gewahr werden.
Schon in ihrer Kindheit munkelte die Verwandtschaft über sie, da ihre rebellische Art so gar nicht dem Idealbild eines sizilianischen Mädchens entsprach.
„Che brutta, wie hässlich“, rief Maria aus, als sie das kleine schwarzhaarige und unterentwickelte Kind Ende der Kriegsjahre zur Welt brachte.
Ein Verwandter meldete das Kind auf dem Rathaus an. „Wann es geboren ist? Das weiß ich nicht genau“, sagte der Verwandte. „Ich glaube vor zirka einer Woche, wir kamen nicht dazu, es eher anzumelden.“
„So“, sagte der Beamte. „Vor einer Woche war der siebte, wenn ich mich nicht irre, und heute ist der dreizehnte, Unglücksdaten! Vielleicht ist es besser, wenn Sie mir ein anderes Geburtsdatum nennen.“
„Oh ja, damit bin ich einverstanden“, erwiderte arglos der Verwandte und so einigte man sich auf friedliche Art und Weise auf den Tag des heiligen Camillo am nächsten Tag.
„Nun verraten Sie mir noch den Namen“, wollte der Beamte weiter wissen.
„Ach“, sagte der Verwandte, „die Mutter ist krank und liegt mit hohem Fieber im Bett, der Vater hat keine Zeit.“ So entschied man sich für den Namen Agata, der Großmutter, die aus Catania stammte und den Namen der Schutzheiligen trug.
Das Hänseln der Familie der Kleinen gegenüber häufte sich. „Che brutta anatrocolo“, rief Maria immer dann, wenn sie Unzufriedenheit und Unmut im Gesicht der Kleinen entdeckte. Die Reizbarkeit den Erwachsenen gegenüber verschärfte sich. Die Eifersucht gegenüber ihrem „schönen Bruder“ Lorenzo wuchs. „Beddu“, sagte Maria zu ihrem Erstgeborenen. Sie hatte es nicht leicht mit ihrer rebellischen Tochter. Agata aß sehr schlecht – mit Absicht, zur Strafe für die Mutter, die sie „nicht liebte“.
Das war ihre Welt, in der sie vor allen Dingen zwischen den Spielkameraden bestimmen konnte. Von ihrem Charakter her hatte Agata ein gutes, mitleidiges Herz. Kinder aus der Nachbarschaft liebten ihre Gesellschaft, sie fühlten sich wohl in ihrer Nähe, vor allen Dingen, der herrenlosen Tiere wegen. Agata nahm heimatlose und verletzte Tiere auf, die sie auf dem Küchenbalkon in Pappkartons mit großer Hingabe versorgte. So verstrichen ihre Kindheitsjahre in Gesellschaft der Tiere und einem großen Kreis von Kindern aus der Nachbarschaft. Die Veränderung des Kindes mit dem beginnenden Erwachsenen- alter war verblüffend. Maria hatte keinen Grund mehr, sich auch nur annähernd über das Aussehen ihrer Tochter zu beklagen. Mit dreizehn Jahren, nach der Firmung, bestand Agata darauf, dass man sie mit Signorina ansprach. Ein Jahr darauf verlobte sie sich mit einem Jungen aus der Nachbarschaft, von dem sie sich ein halbes Jahr später wieder trennte.
Sie verstand sehr wohl, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bis weit über ihre Schultern, wallten ihre krausen, schwarzen Haare. Kurze, hautenge Kleider unterstrichen ihre wohlgeratene Figur. Sie trug als einziges der jungen Mädchen aus ihrem Ort großmaschige, schwarze Netzstrümpfe. Nicht sehr groß an Wuchs, glich sie diesen, ihr erscheinenden Makel mit hochhackigen Schuhen aus. Herausfordernd konnte sie ihre Hüften schwenken und ihre Brüste, die zwei reifen Zitronen glichen, betonte sie mithilfe ihrer Kleidung. Agata war sehr stolz. Sie schickte Heiratsbewerber, die keinen akademischen Bildungsgrad vorzeigen konnten, davon und empörte sich nicht selten über die Anmaßung ihrer Bittsteller. Immer fester schloss sie sich ihrer Cousine und Freundin Rosella an, die sich in Sachen „Liebe“ auskannte.
„Hör’ mal Agata“, sagte Rosella eines Abends zu ihr, „ mein Freund hat einen Vetter, der dich sehr gerne kennenlernen möchte. Er ist Ingenieur. Ich habe ihn gesehen, ich denke, er passt gut zu dir.“ Agata war einverstanden, stimmte zu.
„Ich gehe zu Rosella“, sagte sie an einem Nachmittag. Sie föhnte gerade ihre Haare, als Maria sie überraschte. Mit ihren größten Goldohrringen verließ sie das Haus.
Sie gefielen sich auf den ersten Blick, als sie sich im öffentlichen Garten gegenüber standen. Salvatore hieß er und erinnerte sie an einen spanischen Torero. Seine sportliche und vitale Ausstrahlung entsprach ihrem Männer-Idealbild. Endlich sah sie die Erfüllung ihrer geheimen Wünsche in allernächste Nähe rücken.
Als sie Salvatore das erste Mal ihren Eltern vorstellte, sagte Domenico: „So, er ist Ingenieur? Aus welcher Familie kommt er, was sind seine Eltern?“
Wohlweislich verlor darüber Agata kein einziges Wort. „Kommt Zeit, kommt Rat“, dachte sie und ließ es dabei bewenden.
Jeden Tag erschien Salvatore pünktlich zum Mittagessen. Er konnte sich diesen Luxus leisten, er war arbeitslos. Die Nachmittage verbrachte er bis nach dem Abendessen im Hause seiner Verlobten und fuhr erst mit dem Nachtzug wieder heim.
„Ich ahnte richtig“, sagte Domenico nach dem Besuch von Salvatores Eltern.
„Villani, gente primitiva“, sprudelte es aus dem spitzen Mund Marias empört heraus. „Es ist mir egal, was ihr darüber denkt“, erwiderte Agata wütend. „Ich liebe ihn und das hat euch zu genügen!“
Als Salvatore dann täglich kam, gab Agata ihre Arbeit auf. „Alle Halsabschneider, Gauner“ schimpfte sie, als sich Maria bei Domenico über sie beschwerte.
„Sie zahlen alle viel zu wenig! Und überhaupt, mit dem verdammten Blusen-Sticken habe ich meine Augen verdorben, brauche jetzt schon eine Brille!“
Am Tage war sie aushilfsweise beim Kaufmann ihrer Eltern angestellt, am Abend bestickte sie weiße Blusen mit bunten Eselskarren. Das schwierige Auszählen der winzigen Kreuzstiche erforderte Konzentration und vor allem gutes Licht. „No, grazie!“ Sie hatte die Schnauze voll. „Miserables Kleingeld“ bekam sie für eine Bluse über der sie stundenlang und mit großer Mühe saß.
„Du hättest weiter zur Schule gehen müssen“, sagte Domenico. Er hatte weiß Gott anderes in seinem Kopf, als sich mit der schwierigen Tochter abzugeben. Das schob er seiner Frau zu, das fiel für ihn in das Gebiet der „Weiberwirtschaft“, mit der er nichts zu schaffen haben wollte. „Weshalb hast du nicht weiter die Schule besucht“, wiederholte er lakonisch!
„Die Schule? Das fehlt mir gerade noch“, wetterte Agata gegen ihren Vater los. „Das was ich brauche, ist eine Schreibmaschine. Gebt mir das Geld dazu, und ich besuche einen Lehrgang für Sekretärinnen, wo ich Schreibmaschine und Steno lerne. Denn schließlich will ich etwas tun. Die Zeiten des dummen Schafes sind vorbei.“
„Gut“, sagte Domenico, „die Hauptsache, du gibst Ruhe.“
Agata bekam ihre Schreibmaschine, auf der sie täglich übte. Die gewohnte Hausarbeit blieb liegen, Maria war verzweifelt. Die Anfälle ihrer Stauballergien verboten ihr, sich um die Putzarbeiten im Haus zu kümmern. Außer dem Kochen schob sie diese Arbeit Agata zu. Eines Tages tauchte Salvatore schon am Vormittag im Hause der zukünftigen Schwiegereltern auf. Als er Agata verschlafen und spärlich bekleidet an der Tür stehen sah rief er: „Bist du krank?“
„Krank? Wie kommst du darauf?“
Stumm wies er auf die Zeiger seiner Armbanduhr woraufhin sie lediglich mit einem leichten Achselzucken reagierte.
„Wann wollt ihr endlich heiraten“, fragte Maria eines Abends.
„Weißt du, dass du mir gefällst“, erwiderte Agata. „Du scheinst vergessen zu haben, dass er keine Arbeit hat. Oder bist du einverstanden, dass er zu uns zieht?“
„Ohne Bewerbungsschreiben wird er kaum zu einer Arbeit kommen. Zumindest kannst du ihm sagen, dass wir bald einen Hochzeitstermin erfahren wollen. Vielleicht gibt er sich dann mehr Mühe.“
Das Gespräch hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Salvatore bemerkte an einem Sonntag während des Mittagessens: „Wir heiraten bald. Ich denke in drei Monaten. Im Herbst könnt ihr damit rechnen. Ich habe Aussicht auf Arbeit.“
Wie bei einem schwarzen Himmel, der sich plötzlich aufhellt, glätteten sich die Falten auf Marias Stirn. Auch konnte Domenico seine Überraschung nicht verbergen. Gewöhnlich schweigsam, wenn es um „Weibergeschichten“ ging, sagte er: „So, ihr wollt heiraten, va bene, – na gut.“
Agata begann mit den Hochzeitsvorbereitungen. Brav beendete sie die Stickerei einer begonnenen Tafeldecke, kaufte Stoffe in allen Farbvariationen, die sie zur Schneiderin brachte für ihre neuen Kleider. An einem besonders heißen Nachmittag, als das Thermometer fünfundvierzig Grad im Schatten anzeigte, klingelte es. Agata blätterte gerade mit Rosella in einem Modejournal. Sie schauten nach einem geeigneten Modell für das Hochzeitskleid. Es war Salvatore, der hastig die Treppen heraufeilte. Bedrückt kam er herein und meinte, nachdem sich Rosella diskret zurückgezogen hatte: „Sag’ einmal, was machen wir, wenn ich die Stelle, die ich in Aussicht hatte, nicht bekomme? Du weißt, dass ich keinerlei Ersparnisse habe und es mir inzwischen sehr peinlich ist, dich täglich um Geld für mein Zugbillett zu bitten. Darf ich fragen, wie es mit dir und deinen Finanzen steht?“
Agata, irritiert, reagierte nach einer Pause aggressiv, indem sie sagte: „Und wenn ich dir sage, dass ich außer meiner Wäscheaussteuer nichts mit in die Ehe bringe? Wenn man sich liebt, findet man immer einen Weg.“
Immer wieder musste Agata an ihr Gespräch und das verdutzte Gesicht Salvatores denken. Nächtelang konnte sie nicht schlafen. Ihre Situation verschlimmerte sich von Tag zu Tag.
„Hör’ mal“, sagte Salvatore eines Abends, „wir müssen unseren Heiratstermin verschieben. Mit meiner Arbeit hat es nicht geklappt, sobald ich Land sehe, heiraten wir.“
Agata wunderte sich, wie wenig sie diese Mitteilung überraschte.
„Ah, die Arbeit? Du hast keine Arbeit? Das ist ja fantastisch! Warte nur, wenn es das ist, werden wir Abhilfe schaffen!“
Von nun an setzte sich Agata täglich an ihre Schreibmaschine. Sie tippte, bis ihre Finger schmerzten, Bewerbungsschreiben für Salvatore, die sie in alle Himmelsrichtungen des Landes verschickte. Unter vielen Absagen kam endlich eine positive Antwort: Eine Fachschule in Oberitalien suchte einen Lehrer für angehende Ingenieure. Agata hüpfte vor Freude, küsste den Brief, eilte auf den Balkon und als sie Salvatore kommen sah, hielt sie das Schreiben überschwänglich in die Luft und rief: „Schau mal was ich habe!“
Erneut setzte man den Hochzeitstermin fest, dieses Mal auf den kommenden Frühling.
Salvatore nahm Abschied, die neue Stellung anzutreten.
„Ich komme so oft es mir möglich sein wird“, flüsterte er Agata ins Ohr und reiste ab.
Mit der Abreise Salvatores begann für Agata das reinste Lotterleben. Kaum hatte sie sich eine Stunde vor dem Mittagessen von ihrem nächtlichen Lager erhoben, so legte sie sich nach dem Essen wieder hin. Rosella, ihre Freundin sagte: „Du hast Depressionen.“
Täglich kam es zu Streitereien zwischen Maria und der Tochter. Die Hausarbeit blieb liegen, Maria saß auf einem Stuhl und rang nach Luft. Ihre jahrelange, von den Ärzten nicht erkannte Allergie artete nun mitunter in schlimme Asthma-Anfälle aus. Agata ärgerte das ewige Herumsitzen ihrer Mutter und so konnte sie an manchen Tagen, wenn die Streitereien kein Ende nahmen, sagen: „Du bist hysterisch und steigerst dich in etwas hinein. Ich habe es satt, ständig deine Dienerin zu sein.“
Auch an ihrem Bruder sparte sie mit ihren ausfälligen Reden nicht, da dieser sie bei seinen Vergnügungen nie dabei haben wollte. Nur bei ihrem Vater kontrollierte sie sich besser. Sie erreichte, dass er ihr das Geld für einen Führerschein gab. Leider hatte sie Pech, da sie das neu gekaufte Familienauto beim Hineinfahren in die Garage demolierte. Die Familie erteilte ihr Fahrverbot. Viele Stunden am Tage widmete sie ihren Tieren und brachte ihrem Papagei das Sprechen bei. Ihre Hündin Bella folgte ihr auf Schritt und Tritt und ihre beiden Katzen miauten so lange vor ihrer verschlossenen Tür, bis sie ihnen Einlass gewährte. Sie fand die Katzenkinder in einer Abfalltonne und ging dem erbärmlichen Schreien so lange nach, bis sie die kleinen Neugeborenen entdeckte. Jetzt sind sie erwachsen und ihre ganze Freude. Ihre größte Sorge galt nun ihren kleinen, aus dem Nest gefallenen, nackten Schwalbenkindern.
„Es ist unwahrscheinlich, dass sie überleben“, sagte ein Experte. Mit ihrer selbst zusammengestellten Nahrung die aus Hackfleisch, Algen aus dem Meer oder Blattsalat und ihrem eigenen Speichel bestand, hatte sie Erfolg. Sie kaute das ganze so lange in ihrem Mund, bis ein feiner Brei entstand, den sie den kleinen Vögeln mit einem Zahnstocher verabreichte. Die schlimmste Arbeit stand ihr in den Nächten bevor, da sie alle drei Stunden für die Fütterung aufstehen musste. Der Erfolg zeigte sich, die kleinen Vögel wuchsen heran und starben nicht.
Die wenigen Briefe, die sie von Salvatore erhielt, enttäuschten sie. Kurz und knapp berichtete er über Belanglosigkeiten und jedes Mal stand im letzten Satz: „Den Rest erzähle ich dir, wenn ich komme.“
Er kam selten, weil er, wie er meinte, die Reisekosten sparen müsse. Endlich vor Weihnachten stand er plötzlich unangemeldet vor ihrer Tür. Er drückte sie im Überschwang und meinte: „Heute habe ich keine Zeit, muss schnell wieder heim, meine Mutter wartet.“
Schnell verstrichen die Tage, die Familie entschied, den schon lange geplanten Gegenbesuch bei Salvatores Eltern zu erwidern.
„Sie sollen es ruhig erfahren, mit wem sie es zu tun haben“, dachte Maria, als sie ihr Brokatkleid für besondere Anlässe aus ihrem Schrank holte. Agata musste ihr beim Überziehen der neuen Schuhe helfen. Ihre Korpulenz und ihr Alter standen ihr bedauerlicherweise bei Aktionen dieser Art im Weg.
„Willst du unbedingt diese verdammten Latschen anziehen, siehst du nicht, wie dick geschwollen deine Füße sind“, presste Agata, während sie an den Schuhen zog, heraus? „Du wirst nicht darin gehen können. Schon der Gedanke macht mich wütend, wie lächerlich du darin aussehen wirst.“
„Meine liebe Tochter, du hast vergessen, dass ich nicht gehe, sondern von deinem Bruder gefahren werde“, entgegnete Maria. Schwerfällig stand sie auf und humpelte die wenigen Schritte zu ihrer Frisierkommode. Sorgfältig puderte sie ihr ohnehin blasses Gesicht mit hellem Puder nach und schminkte ihre Lippen. Zeremoniell öffnete sie die oberste Schublade ihrer Kommode und holte ihren gesamten Goldschmuck heraus. Die ältesten Stücke reichten bis in die Kinderjahre, ihrer ersten Kommunion, zurück. Agata begann zu lachen, als sie zusah, wie die Mutter sich mit ihrem Gold behängte.
„Weißt du Mutter, wem du ähnlich siehst? Unserer lieben Schutzpadronin!“
Salvatore stand vor seinem Haus und schaute unruhig die Straße entlang. Als er sie kommen sah, rief er etwas, sichtlich nervös, zur Haustür hinein. Maria bestand trotz Halteverbotes energisch darauf, direkt vor der Haustür abgesetzt zu werden. Das Aussteigen machte ihr große Mühe, krampfhaft hakte sie sich bei der Tochter ein. Immer noch war sie wütend, dass Domenico nicht mitgekommen war. Schließlich handelte es sich um die Hochzeit ihrer Tochter. Er saß laut schnarchend im Salon und zeigte keine Absicht aufzustehen. Auch mit ihrem eindringlichen Ermahnen hatte sie kein Glück. Er hielt an seinem Starrsinn fest und schlief weiter.
„Ich komme nicht mit“, das war sein letztes Wort.
Kritisch musterte sie das kleine Fischerhaus in N. Die Farbe des ehemaligen Putzes war nicht mehr zu erkennen. Fenster und Türen mangelte es ebenso an einer gründlichen Überholung. Sie traten direkt nach der Eingangstür in einen Raum. An den vier Wänden entlang, in einem Kreis angeordnet, standen Stühle verschiedenster Art. Und in einer Ecke thronte als einziges Möbelstück ein großer Fernsehapparat. Schnell füllte sich der Raum. Salvatores Mutter, winzig und zart, reichte Maria ihr braun durchfurchtes Gesicht zum Willkommenskuss. Nach der allgemeinen Begrüßung der Verwandten setzten sie sich. Wer fehlte, war Salvatores Vater.
„Er kommt später“, sagte Salvatore und stellte der Reihe nach seine Verwandten vor. Steif und aufrecht schaute Maria maliziös um sich. Ein Glück, dass sie ihre Filethandschuhe trug, ihren Fächer dabei hatte. Eine ihrer Hitzewellen plagte sie. Die jungen Leute unterhielten sich und die Kinder balgten sich so laut, dass die Erwachsenen Mühe hatten, sich gegenseitig zu verstehen. Sie aßen die mitgebrachten Süßigkeiten, tranken Espresso. Die beiden Mütter der Verlobten saßen Stuhl an Stuhl und schwiegen. Das erste Wort der anderen kam nicht.
Still hatte sich die Dämmerung in den Tag geschlichen. Der kreisrunde Mond schickte sein silbernes Licht in die dunklen Gassen, und der Lärm der spielenden Kinder von draußen ließ nach, bis er ganz verstummte.
„Oh, es ist Zeit, dass wir gehen“, sagte Lorenzo und stand auf.
„Ich finde es unverschämt, dass uns dein zukünftiger Schwiegervater nicht einmal begrüßt hat“, schimpfte, kaum dass sie draußen waren, Maria auf Agata los. Dabei hatte sie vergessen, dass auch ihr eigener Mann bei dieser Partie fehlte. Am späten Abend kam es zu einem handfesten Krach, als Agata das nicht stattgefundene Gespräch erwähnte.
„Ihr seid alle komplette Idioten. Weshalb sind wir überhaupt hingefahren? Du, mit deinem verdammten Stolz“, zischte sie die Mutter an. „Und weshalb habe ich eigentlich einen Vater!“
„Still Cretina – du hast noch einiges zu lernen, worauf es im Leben ankommt“, entgegnete Maria. „Sie können froh sein, wenn sie dich bekommen, du siehst wohl gar nichts? Du scheinst vergessen zu haben, dass wir Grundstücksbesitzer sind und ich einem Adelsgeschlecht entstamme.“
„Wenn du, liebe Mutter, glaubst, dass du mich damit beeindruckst, muss ich dich leider enttäuschen. Im Übrigen habe ich dieses alte Thema bis zum Erbrechen satt! Ach, im Grunde ist jedes Wort umsonst!“
Wütend stand Agata auf und verschwand laut schimpfend in ihrem Zimmer.
„Discreziata, sei still, man hört dein Geschrei bis hinaus auf die Straße“, konterte Maria nicht weniger leise zurück. Manchmal ließ sie sich in ihrem Ärger mit der Tochter so weit treiben, dass sie ihre Herkunft in Frage stellte.
„Schuld hast du“, sagte Domenico. „Du hast sie nicht erzogen. Meine Hand ist zu schwer, ich würde sie sonst totschlagen.“
Am nächsten Tag kam Agata noch später als üblich aus ihrem Zimmer. Mürrisch griff sie nach dem von der Mutter zubereiteten Milchkaffee und steckte sich dazu eine Zigarette an. Die Küche, die ganze Wohnung roch nach Stockfisch. Liebevoll stand Maria neben ihrem Herd und rührte hin und wieder in den dampfenden Töpfen.
„Grässlich“, giftete Agata, „fällt dir nichts besseres ein? Gibt es dazu etwa wieder Nudeln? Dir ist es ja völlig egal, wenn ich wie eine Tonne auseinander gehe, nicht wahr? Aber eines kann ich dir versichern, ab heute bestimme ich, was ich esse. Das erste was ich vom Tisch fege, sind deine blödsinnigen Nudeln!“
Maria hatte gute Laune, die sie sich an diesem Tag auch nicht von ihrer Tochter verderben ließ. Verwandte aus Randazzo hatten sich am Nachmittag für einen Besuch angemeldet. Antonia, ihre jüngste Schwester, die auch ihre Lieblingsschwester war, hatte sie lange nicht gesehen und so freute sie sich auf dieses seltene Ereignis. Kritisch blickte sie auf Agata, die in ihrer schwarzen Spitzenunterwäsche vor ihr stand.
„Heute kommen Tante Antonia und Onkel Egidio. Ich möchte, dass du dich ordentlich ankleidest und vor allem keinen Grund zu Peinlichkeiten gibst, hast du mich verstanden? Die Verwandtschaft redet schon ohnehin genug über dich!“
Maria saß mit ihrem Fächer an der offenen Balkontür und rang wieder einmal nach Luft. Unter großer Mühe versuchte sie ihr Unbehagen zu verbergen.
„Du wirst dich erkälten“, sagte Antonia. Sie nahm ihr schwarzes Schultertuch und legte es der Schwester liebevoll über ihren Rücken. Agata rührte sich nicht aus ihrem Zimmer. Selbst das energische Klopfen des Onkels ließ sie kalt.
„Lasst mich alle in Ruhe, ich fühle mich nicht wohl“, rief Agata zurück. Ein Glück, dass die Tante die Spannung begriffen hatte und den Espresso auf den Gasherd stellte. Dankbar belohnte Maria sie mit einem langen Blick.
„Sie wird dich ins Grab bringen“, sagte Antonia, „wann heiratet sie endlich?“
„Das weiß nur Gott allein“, flüsterte Maria und schwieg erneut, um Luft zu schöpfen. „Seit er arbeitet, ist sie wütend, statt froh zu sein. Als er nicht arbeitete, schimpfte sie, dass er nichts tat. Ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen wird.“
Gerührt umschloss Antonia die kleine zarte Hand der großen Schwester.
„Mache dir nichts daraus, denke einmal an dich! Lasse sie machen, was sie will. Du siehst doch, dass du bei ihr mit Ratschlägen nicht weiter kommst.“
Maria begann zu weinen. So viel Verständnis wie Antonia brachte niemand für sie auf. Aus ihren großen, schönen, bernsteinfarbenen Augen tropften dicke Tränen.
„Du bist zu gut mit ihr gewesen“, sagte Egidio, der Schwager, in ärgerlichem Ton. „Man hätte sie züchtigen müssen!“
„Pst“, gab Antonia zu verstehen, „das hat jetzt alles keinen Sinn, das bringt uns auch nicht weiter.“
Am nächsten Morgen verließ Agata eilig das Haus. Ihre schlechte Laune sah man ihr von weitem an. Mit großen Schritten eilte sie auf den Platz zur Telefonzentrale, wo Rosella arbeitete.
„Ich kann nicht mehr“, rief sie der Freundin entgegen, als sie die Telefonzentrale betrat. Ein Glück, sie waren allein.
„Er schreibt immer weniger und von der Hochzeit ist keine Rede mehr. Ich weiß wirklich nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Was mache ich bloß?“
„Rufe ihn doch an, entgegnete Rosella. Vielleicht hat er kein Geld zum Heiraten. Schlage ihm eine ‚fuga‘ vor, du wirst sehen, wie er darauf reagiert.“
Agata wählte die Nummer der Schule, an der Salvatore unterrichtete.
„Es ist dringend“, gab sie der Sekretärin zu verstehen und legte auf.
Daheim angekommen, hörte sie, während sie die Treppen hinaufstieg, das Telefon. Maria war dabei, den Hörer abzunehmen.
„Es ist für mich“, rief sie atemlos der Mutter zu, „gehe bitte in die Küche und schließ’ die Tür!“ Zitternd griff sie nach dem Hörer: „Hallo, ich bin es! Nein, es ist nichts passiert. Es ist nur wegen unserer Hochzeit. Einen Moment, rege dich nicht auf, ich erkläre es dir! Wir müssen heiraten, hörst du? Ich schnappe sonst über, hast du mich verstanden? Ich halte es hier nicht mehr aus. Es geht mir schlecht, ich schlafe keine Nacht mehr. Bitte sage mir, dass wir bald heiraten! … Du kannst jetzt nichts sagen? … Wir sprechen, wenn du kommst? Wann kommst du? Sage mir wenigstens, dass zwischen uns beiden alles in Ordnung ist. Du sagst alles, wenn du da bist? … Ja, ich verspreche dir, dass ich dich nicht mehr anrufe. Ciao!“
Agata wankte in ihr Zimmer. Besorgt kam Maria herbeigeeilt und versuchte auf sie einzureden. „Lasse mich in Ruhe, verschwinde, ich kann dich nicht ertragen.“
Maria entfernte sich. Von Tag zu Tag erging es Agata schlechter. Ihr Hausarzt sagte zu Maria: „Was hat Ihre Tochter? Sie ist viel zu dünn und braucht Luftveränderung.“
„Du musst dich zusammennehmen“, sagte Rosella. „Du siehst müde und elend aus. Wenn er kommt, musst du dich von deiner besten Seite zeigen, lustig und unbekümmert! Männer mögen keine problematische Frauen.“
Am nächsten Tag ging Agata zu ihrem Friseur. Sie ließ ihre langen, schwarzen Haare tizianrot färben, glätten und kurz schneiden. Die Veränderung verwunderte sogar den Friseur, der seine Komplimente immer wiederholte. Auch Agata gefiel sich auf den ersten Blick, als sie ihr Spiegelbild wohlwollend betrachtete. „Euch allen werde ich es zeigen“, dachte sie, als sie den Friseursalon verließ.
Maria, nichts Gutes ahnend, stand auf dem Balkon. Als sie Agata sah, zog sie sich ins Haus zurück und rief ihr, außer sich vor Entsetzen, im Treppenhaus entgegen: „Was hast du angerichtet! Unglückselige! Bist du ganz von Sinnen? Deine schönen Haare! Wenn das dein Vater sieht!“
„Wenn du wüsstest, liebe Mutter, wie gleichgültig mir deine und die Meinung anderer Leute ist. Du solltest endlich begreifen, dass ich handle, wie ich es zu entscheiden wünsche. Übrigens gefalle ich mir sehr gut mit meinen neuen kurzen Haaren. Diese verdammte Straßenköderfarbe, die ich vorher hatte, konnte ich schon lange nicht mehr sehen.“
Salvatore fand zunächst keine Worte, als ihm Agata eine Woche später die Tür öffnete.
„Du siehst gut aus“, sagte er ganz wie ein Kavalier und streichelte über ihre neue Haarpracht. Agata ließ sich nicht täuschen. Sie spürte deutlich die abgrundtiefe Entfremdung, die zwischen ihnen lag, und wurde traurig. Sie dachte an die weisen Worte ihrer Freundin und spielte ihre einstudierte Rolle tapfer weiter.
„Höre Salvatore, ich habe eine Neuigkeit“, begann sie. „Ich habe die Möglichkeit Rosella in der Telefonzentrale zu vertreten. Weißt du, was das heißt? Eigenes Geldverdienen und Sparen. Dann können wir endlich heiraten. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es den Weg einer ‚fuga‘, hast du an diese Möglichkeit noch nie gedacht? In diesem Falle käme ich zu dir nach Oberitalien. Arbeit finde ich auch dort, hast du vergessen, dass ich mich als Sekretärin weitergebildet habe? Ohne mich hättest du deine Arbeit nie bekommen! Ach weißt du, wir …“
„Halt, bis hierher und nicht weiter“, ereiferte sich Salvatore. „Ich bin fix und fertig von dem ganzen Stress. Dieses ewige Tauziehen kann ich nicht mehr ertragen! Du denkst nur an dich! Meine Eltern, meine Mutter vor allen Dingen! Hast du sie vergessen, dass auch sie Anspruch auf ihren Sohn haben? Ich habe meinen Eltern ein Auto gekauft, natürlich auf Ratenzahlung! Meine Mutter ist alt und braucht Hilfe …“
„Basta! Genug! Verdammter Lügner“, schrie Agata. „Du hast mich nur benutzt! Heiratsschwindler! Schmarotzer, verschwinde! Raus mit dir du Scheißkerl! Zwei Jahre hast du dich vollgefressen!“
Ungeahnte Kräfte hatten sie beflügelt. Sie packte den großen, starken und erschrockenen Mann, schob ihn Richtung Treppe und stieß ihn hinunter. Dann zog sie ihren Verlobungsring von ihrem Finger, den sie ihm in hohem Bogen nach schleuderte. „ Komme mir nie wieder unter die Augen“, tobte sie ihm nach, bevor die Haustür krachend ins Schloss fiel.
In der kommenden Nacht bebte der Ätna. Maria saß aufrecht in ihrem Bett und hatte einen schlimmen Anfall. Der Arzt musste gerufen werden. Domenico stand auf. Er setzte sich in den Salon und wartete halb schlafend auf das Morgengrauen. Der Ascheregen des Vulkans hielt an. Der Flughafen von Catania musste geschlossen werden. Die Nachrichten der lokalen Sender sprachen deutlich von einer Katastrophe. Die Prognose der Schäden im Falle starker Regenfälle überstieg alle denkbaren Grenzen.
„Zum Glück bin ich Obstgärtner“, sagte Domenico. „Du solltest heute nicht das Haus verlassen“, wandte er sich an Maria. Die Luft ist unrein von dem Ascheregen.“
Eine Woche hielt der Ascheregen an. Das Rathaus verteilte Gratis-Masken, besonders für Kinder und Allergiker. Die Ärzte empfahlen den jungen Müttern mit ihren kleinen Kindern daheim zu bleiben. Die hinausmussten, benutzten Regenschirme, so heftig war es mit dem Ascheregen. Alles verstopfte, Pflanzen erstickten. Der Regen, der zu allem Übel auf die Ascheschichten fiel, blieb nicht ohne Folgen. Die schwarze Lavaasche des Vulkans, die in Maßen als fruchtbar gilt, hatte sich im Zusammenspiel mit Wasser in Zement verwandelt. Täglich gab es Neuigkeiten. Der Tageszeitung „La Sicilia“ mangelte es nicht an Stoff und Sensationen. Gemüsebauern, die ihre gesamte Ernte verloren, standen im Vordergrund. Die Abwasserrohre der Häuser verstopften, brachen unter der Last der nassen Asche auf Straßen herunter. Hausfrauen verzweifelten. Die feine Asche des Vulkans drang durch alle Ritzen in die Häuser, bedeckte Terrassen Autos, Straßen und verwandelte die Landschaft in eine Mondlandschaft. Das Saubermachen, bei vielen Frauen eine Leidenschaft, wurde zum Verhängnis, da ein Ende nicht abzusehen war.
Wieder verging ein Sommer. Während sich Domenico seinen Orangenbäumen widmete, spitzten sich die Spannungen zwischen Agata und ihrer Mutter immer mehr zu.
„Ich bin erwachsen und über das Mündigkeitsalter hinaus“, verkündete Agata, nachdem sie ihre drei Waisenkinder, die sie jeden Sonntag seit einiger Zeit zum Mittagessen und Spielen abholte, heimbegleitet hatte. „Ich habe vor, nach Deutschland zu gehen.“
Domenico hatte Reden dieser Art mehr als einmal gehört. Er maß daher diesen Worten keine Bedeutung mehr bei.
„Sie wird sich schon beruhigen“, dachte er und sagte: „Leute, die nächste Ernte wird vielversprechend. Die Früchte sind in diesem Jahr besonders schön. Ich habe zwei Angebote von Großhändlern, die gut bezahlen. Noch sind die Würfel nicht gefallen, ich warte noch ein wenig.“
Domenico stand in der Regel sehr früh am Morgen auf. Er liebte es den Tag mit der aufgehenden Sonne zu beginnen. Während Maria in tiefem Schlaf lag, kleidete er sich an und begab sich in die Küche. Er freute sich auf seinen Espresso, den er sich vor dem Weggehen zubereitete. An einem dieser schon am frühen Morgen lauen Sommertage erschrak er fürchterlich. Genüsslich hielt er gerade seine Espressotasse an seine Lippen, als Maria gleich einem Gespenst plötzlich neben ihm stand. Wirr starrten ihre Augen ins Leere und sie sagte stumpf: „Sie ist gegangen.“
Domenico verstand nicht sofort den wahren Sinn ihrer Worte, vielmehr glaubte er an einen üblen Traum seiner Frau und klopfte ihr beruhigend auf die Schulter.
„Sie kommt nicht wieder“, stammelte Maria. „Glaube mir, ich fühle es, sie ist für immer weg. Weg, einfach weg. Sie hat mich, ihre arme Mutter, allein gelassen.“
Maria schluchzte laut und verbarg ihr Gesicht in ihren Händen. Jetzt begriff Domenico.
„Wo ist Lorenzo? Hat er nichts von seiner Schwester erfahren?“
Laut polternd trat er an Lorenzos Bett. Dieser, von dem plötzlichen Lärm erwacht, blickte ungläubig zu seinem Vater auf und fragte: „Was gibt es?“
Er sah seine weinende Mutter und war mit einem Mal hellwach. Und da sahen sie ihn alle gleichzeitig: den Brief, der auf dem Tisch zwischen den Plastikblumen steckte. Drei Hände streckten sich gleichzeitig nach dem Brief aus.
„Nimm’ du ihn, lies ihn vor“, sagte Domenico zu Lorenzo und stellte sich hinter den Lesenden, während sich Maria auf dem Rand des Bettes niederließ. Zitternd riss Lorenzo das Kuvert auf und begann leise: „Lieber Renzo! Ich bin gegangen, habe es wahr gemacht, ich musste weg. Bringe es den Eltern schonend bei, die mich nie verstanden haben, sie leben in einer anderen Welt.“
„Weiter“, befahl Domenico, „was schreibt sie noch?“
„Nichts weiter“, flüsterte Lorenzo.
„Drehe den Brief herum“, befahl Domenico, „vielleicht steht auf der Rückseite noch etwas.“ Ungläubig starrte er auf den leeren Bogen.
„Welche Schande! Welche Schande“, schluchzte Maria, „sie hat mich allein gelassen. Und die Leute! Was werden die Leute sagen!“
„Still – verdammte Weiber! Ich will sie nie wieder sehen! Wehe sie kommt mir noch einmal unter die Augen, diese verdammte Hure!“
Lärmend verließ Domenico das Haus. Lorenzo schloss sich im Badezimmer ein und hielt seinen Kopf unter das frisch sprudelnde Wasser. „Ich werde dich finden“, sagte er immer wieder, so lange, bis er Ruhe in sich spürte.
Domenico besuchte seit dem Verschwinden seiner Tochter die Bar auf der Piazza nicht mehr. Auch Maria verließ so wenig wie möglich das Haus.
„Sie ist bei Verwandten“, erzählte Lorenzo den Klatschsüchtigen.
Jeden Tag stand Maria stundenlang am Fenster, hinter den Gardinen und wartete auf Post von Agata. Post, die nicht kam. Domenico arbeitete noch mehr und ohne Grenzen. Mit dem Sonnenaufgang verließ er das Haus und kehrte erst mit dem Sonnenuntergang wieder nach Hause zurück. Er hatte es sich angewöhnt, zu den Mittagsmahlzeiten nicht mehr heim zu kommen. Er fühlte sich wohler, unter seinen Bäumen, wo er um die Mittagszeit seinen mitgebrachten Schafskäse, Brot, Oliven und seinen Wein verzehrte. Er gönnte sich danach in seinem Geräteschuppen, in dem er sich eine gemütliche Ecke eingerichtet hatte, eine Siesta. In diesen Momenten der Ruhe und Zufriedenheit konnte er mitunter auch das Elend mit Agata vergessen. „Es wird eine großartige Ernte geben“, konnte er dann sagen.
Der Sommer wollte nicht weichen. Der September stand in seinen Temperaturen dem August nicht nach. Die Weideflächen der Hügel und Täler lagen braun und ausgedorrt unter den Strahlen der sengenden Sonne. In den ausländischen Zeitungen stand: „Sizilien steht in Flammen.“
„Es sollte regnen“, sagten die Bauern, die Hirten und Schäfer.
„Lass es regnen“, beteten die Gläubigen zur Mutter Gottes. Aber es regnete nicht.
„Ich habe keine Probleme“, verkündete Domenico den laut Klagenden. „Ich habe genug Wasser. Meine Früchte sind schöner denn je. Ich ernte das ganze Jahr.“
Der Oktober hielt seinen Einzug, der ersehnte Regen kam nicht. Mitten in der Nacht des Heiligen Francesco erwachte Domenico. Jemand klopfte energisch an seine Haustür und rief seinen Namen: „Domenico, steh’ auf, schnell, bevor es zu spät ist!“ Ungläubig sah Domenico aus seinem Fenster und erkannte seinen Freund Benito.
„Was gibt es amico?“, rief er zurück.
„Was es gibt? Lauf so schnell du kannst. Beeile dich, dein Grundstück steht in Flammen!“
„Mein Grundstück, meine campagna? Da muss ein Irrtum vorliegen.“
Trotz seiner Zweifel überfiel ihn Unruhe. Er kleidete sich rasch an, eilte aus dem Haus, auf den kleinen Vorplatz, wo sein Fahrzeug, seine kleine ape stand.
„Steig’ ein“, rief er Benito zu. Endlich setzte sich das Motorgetriebe des altersschwachen Wagens ratternd in Bewegung. Schon von weitem sah er den Widerschein der Flammen. Es gab keinen einzigen Baum, der nicht lichterloh brannte. Unverkennbarer, beißender Benzingeruch schlug ihm entgegen.
Trotz des Unglücks auf dem Lande, musste das Leben weitergehen. Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass Domenico auf Andere hörte und nicht versichert war.
„Niemand ist versichert“, hörte er von allen Seiten. Manch einer lachte über sein Bedenken. Und er? Er legte diese Zweifel wie ein altes, unbequemes Kleidungsstück ab und vergaß die Sache ganz.
Benito, der den Brand entdeckte und bei der Feuerwehr meldete, hatte kein Glück. Die Feuerwehr kam nicht, da kein Einsatzwagen zur Verfügung stand.
„Sind Häuser in der Nähe, besteht Lebensgefahr“, fragte die männliche Stimme am Telefon? So erzählte es Benito. Domenico versäumte es nicht, bei den Carabinieri eine Anzeige wegen Brandstiftung gegen Unbekannt aufzugeben. Auch hier bekam er keine positive Antwort, da der Beamte ihm keine Hoffnung machen konnte.
Dennoch, das Leben ging weiter und brachte Neuigkeiten: Lorenzo hatte sich verliebt. Seine Freundin erwartete ein Kind, da hieß es schnellstens handeln. Noch mehr Schande wollte er, der Stammhalter der Familie, seinen Eltern nicht bescheren. Die Geschichte mit Agata hatte seine Eltern sehr mitgenommen. Außerdem wäre nun die Reihenfolge mit der Heirat richtig. Er war der Älteste!
Über Alberto, den Cousin, erfuhr er, dass es Agata in Deutschland prächtig erging. Sie arbeitete in einem Tiergeschäft. Der Groll Domenicos der Tochter gegenüber, war unverändert. Er ging sogar so weit zu sagen: „Wenn sie wagt zu kommen, seht ihr mich nie wieder!“
Lorenzo äußerte den Wunsch, beruflich weiterzukommen. Sein Abitur, das er auf dem humanistischen Gymnasium in Catania mit Erfolg bestand, lag hinter ihm. Den Weg, den er weiter zu gehen gedachte hieß, an staatlichen Prüfungen teilzunehmen. In der „Gazetta del Sud“ las er von den frei gewordenen Stellenangeboten. Nicht selten fanden die Examen und so genannten „Concorsi“ im Norden Italiens statt. Das setzte voraus, dass die ohnehin arbeitslosen Teilnehmer enorme Spesen in Kauf nehmen mussten. Soldi, soldi, soldi! Wer hatte das Geld für die Reisespesen, das Hotel, das Taschengeld? Tausende von Prüflingen mit nur zwanzig ausgeschriebenen Arbeitsplätzen waren keine Seltenheit. Welcher Wahnsinn! Lorenzo musste warten. Zum Glück fand er immer wieder Gelegenheitsarbeiten, allerdings ohne versichert zu sein. Das musste sich in Zukunft in jedem Falle ändern.
Die Aufträge auf den Ländereien ließen nach. Die Preise der Grossisten sanken, die Unkosten für den kleinen Grundbesitzer stiegen. Den Bauern, die in Genossenschaften lebten, ging es etwas besser. Die Einschaltung der EWG-Nationen trug auch nicht gerade dazu bei, die Lage zu verbessern.
„Eia Maria santissima! In Messina gab es Zitronen aus Spanien“, sagte Domenico als er von einer Fahrt dorthin nach Hause kam. Ein Glück, dass sie finanziell nicht ganz verloren waren. Maria gestand ihm nach dem Brand auf dem Land, dass sie im geheimen ein besonderes Konto auf den Namen Lorenzos eingerichtet hatte. Nach dem Tode ihrer Mutter bezog sie das Geld von zwei Mietwohnungen.
„Das ist unser Notgroschen“, sagte sie Domenico.
Für ihn war dieses Thema nicht vorhanden und er sagte: „Das ist mir vollkommen egal, mache was du willst, ich bin der Ernährer der Familie und verantwortlich für euch. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo sich vieles ändern muss. Und weißt du Maria, was ich denke, das ist nicht schwer zu erraten. Schon als Kind wollte ich beruflich nicht zur Landwirtschaft. Mein armer Vater in Randazzo, der selbst Bauer war, hat es damals akzeptiert, dass ich andere Ideen im Kopf hatte. Man wird weitersehen.“
Am Abend lenkte sich Domenico mit handwerklichen Arbeiten ab. „Handwerk hat goldenen Boden“, sagte einst sein Vater, der ihm das Flechten für die Sitzflächen von Stühlen beibrachte. Und im Spätsommer, erinnerte er sich, nahm er ihn nach Mojo mit, wo die schönsten Riesenfenchel wuchsen. Sie nahmen ihr Maultier und eine Laubsäge mit, befreiten die Pflanze von ihrem vertrockneten Blüten- und Blattwerk und fixierten die Fracht auf ihrem Maulesel. Federleichte, ausgereifte Halme, die sie daheim in einer der Vorratskammern bis zum Winter lagerten. An den Wintertagen, wenn es in Randazzo schneite, es kalt und ungemütlich draußen war, saß die Familie in der Küche, wo es am wärmsten war. In ihrem Ofen, in dem sie einmal in der Woche Brot buken, heizten sie bereits in den frühen Morgenstunden ein. Da holten sie ihr gesammeltes Riesenfenchelmaterial hervor und fügten die gesägten Stücke kunstvoll mit Bast und Naturdübln zusammen. So entstanden Hocker, Tische, Truhen und noch vieles mehr. Oder sie flochten Körbe, Weiden wuchsen in Hülle und Fülle. Ein kleiner Nebenverdienst für den Wochenmarkt war ihnen sicher. „Beati quei tempi – eine gesegnete Zeit.“
Bei einem Verwandtenbesuch in Randazzo erfuhr Domenico, dass der Sohn Signor La Rosas daran dachte den Familienbetrieb zu schließen und nach Käufern für die Maschinen suchte. „Die Gelegenheit“, sagte er zu seinem Freund Benito. „Mich zieht es wieder zurück zu meinem alten Beruf. Ein Glück, dass ich mit dem Haus und dem Grundstück kreditwürdig bin. Mit einem Kredit von meiner Bank, kaufe ich die Maschinen.“
Domenico nahm die Mitteilung von Lorenzos Hochzeit zur Kenntnis – mit gemischten Gefühlen, versteht sich. „Kannst du eine Familie ernähren“, fragte er seinen Sohn? Über die Ausrichtung der Hochzeit war sich Domenico mit Maria einig: Eine große Hochzeit, mit allen Freunden und Verwandten sollte es sein. Eine Hochzeit, die sich sehen lassen konnte, eine Hochzeit mit allem Luxus. Den Klatschmäulern musste man ein für alle Male das Maul stopfen.
An dem Tag, an dem seine Bank den Kredit bewilligte, fuhr er mit Maria von Catania mit dem Zug, der „Circum“, nach Randazzo. Er hatte vor, das Grab seines Vaters zu besuchen und den Kauf der Maschinen persönlich in die Hand zu nehmen. Er war wie aufgezogen und erzählte Maria aus seinem Leben, so, wie er es bisher noch nie getan hatte:
„An manchen Tagen, wenn ich nicht zur Schule musste“, begann er, „nahm mich mein Vater mit zur Arbeit. Ich war etwa zehn Jahre und durfte, besonders zu den Erntezeiten, mit aufs Feld. Ein heiliger Moment für mich, wenn wir gemeinsam auf dem Maultier saßen. Oft sprachen wir kein Wort. Manchmal fielen mir vor Müdigkeit die Augen zu. Mit dem Aufgang der Sonne kamen wir je nach Jahres- und Erntezeit am besagten Orte an, wo die geplante Arbeit auf uns wartete. Die Arbeit war mir in jedem Falle lieber als die Schule. Ach ja, die Schule! Das Sitzen machte mich nervös Eines Tages, als ich auf dem Schulweg an der kleinen Fabrik von Signor La Rosa stehen blieb, vergaß ich die Zeit. Ich schaute den beiden Arbeitern bei ihrer Tätigkeit zu. Sie stellten Treppenstufen und vor allem Fußbodenplatten mit verschiedenen, farbigen Mustern her. Bei der Prozedur der Farbenmischung passte Signor La Rosa besonders auf, dass die Farbenstärke stimmte. Er saß im Hintergrund auf einem Stuhl und achtete darauf, dass die beiden Männer keine Fehler machten. Ein Tag, zwei Tage oder auch mehr, schwänzte ich die Schule. Dann kamen mir Bedenken. Auf die Dauer konnte ich das Fehlen in der Schule nicht mehr weiter so treiben. Ich musste einem Skandal vorbeugen und so beschloss ich, mit Vater zu reden.
‚Padre‘, sagte ich, ‚ich habe gesündigt.‘
Vater war erstaunt und sagte nach einer Pause: ‚Ich höre.‘
Nach einem Räuspern meinerseits sagte ich: ‚Mir gefällt Arbeit.‘
‚Das ist gut‘, meinte er.
Und ich: ‚Ich meine die Arbeit eines Mannes, eine nutzbringende Arbeit.‘
‚Das sagtest du schon.‘
‚Schließlich‘, redete ich weiter, ‚habe ich vor, eines Tages zu heiraten.‘
‚Das hat noch Zeit‘, sagte er. ‚Aber ich kann dir entgegenkommen und dir insofern helfen, als dass ich bei den Handwerksmeistern herumhöre, wer dich in den Schulferien zur Hilfe anstellt.‘
Verdammt, dachte ich, ich muss Vater das mit der Schule deutlicher sagen, und ich sagte: ‚Vater, die Schule ist sinnlos.‘
‚Wer hat dir diesen Schwachsinn erzählt?‘, fragte Vater. ‚Du solltest in jedem Falle wissen, wie wichtig die Schule ist. Unter uns Bauern gibt es immer noch viel zu viel Analphabeten. Viele hatten keine Möglichkeit das Schreiben zu erlernen, und unsere Ahnen waren Sklaven im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst heute gibt es immer noch Sklaven. Möchtest du ein Sklave werden? Habe ich dir von meinem Bruder, deinem Onkel, erzählt, von der Geschichte mit der Auswanderung nach Amerika?‘
‚Nein‘, entgegnete ich.
‚Hast du in der Schule von der Auswanderung unserer Leute erfahren? Kurz, dein Onkel war auch dabei. Der ganze Betrug begann bereits mit Garibaldi, das sollst du wissen. Was schreiben die Bücher? Freiheitskämpfer? Wo werden die Bücher gedruckt? Auf dem Kontinent, nicht wahr? Da hast du es! Merke dir: du bist Sizilianer. Wir gehören mit Italien nicht zusammen. Ja, auf dem Papier, das mag sein. Doch in unseren Herzen auf gar keinen Fall! Garibaldi? Ein Militarist, der Befehle ausführt. Unsere Leute haben auf seiner Seite gekämpft. Große Reden, seine Reden! Ohne uns Bauern hätte er den Sieg gegen die Bourbonen niemals gewonnen. Seine Werbereden, seine Versprechungen auf den Plätzen und sein geflügeltes Wort: ‚Ihr werdet Landbesitzer, wenn ihr mit mir kämpft‘, hat seine Wirkung nicht verfehlt.
‚Wir werden gewinnen‘, predigten die Priester von den Kanzeln ihrer Kirchen und stimmten in seine Reden ein.
Junge, ich sage dir, wir standen nach dem Sieg ärmer da als vorher. Unsere Ländereien, die uns der ‚Freiheitskämpfer‘ versprochen hatte, bekamen die, die den Kriegszug Garibaldis finanzierten. Menschen von draußen, hast du verstanden?‘
‚Und welche Rolle spielte der König?‘
‚Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Doch zurück zu Amerika. Die Armut der Menschen stieg, sie suchten verzweifelt nach einem Ausweg. Alles strebte nach Amerika, ins gelobte Land. Und nun komme ich zur Hauptsache: Dein Onkel verkaufte alles, was er besaß, um eine Fahrt nach Amerika buchen zu können.‘
‚Und wie ging die Sache aus?‘, wollte ich wissen.
‚Eine Woche war sein Schiff unterwegs. Dann hieß es in der Nacht des letzten Tages an einem unbekannten Strandgebiet aussteigen. Das Schiff fuhr weg. Die Menschen standen verlassen da und das war alles. Eine Irrfahrt von einer Woche in unbekannte Gebiete, ganz in der Nähe, ein paar Mal um Sizilien herum und man war wieder zu Hause. Ärmer denn je. Und die Scham, das war das Schlimmste für viele. Ein Betrug von Menschenhändlern, die mit ihren dunklen Machenschaften Leute in ihr Elend stürzten. Auch dein Onkel Vincenzo ist daran zerbrochen. Domenico, hast du jetzt begriffen, weshalb wir reagieren müssen? Wir Sizilianer müssen aus unserem Sklaventum heraus, uns weiterbilden, selbständig denken lernen! Nur so kann sich unsere Lage verbessern!‘
‚Vater‘, sagte ich, ‚du musst mir vertrauen! Auch wenn ich manchmal Fehler mache, eines verspreche ich dir, du wirst in Zukunft keine Enttäuschung mehr von mir erfahren. Erinnerst du dich, als ich bei Monsignore Messdiener war? Er wählte mich für die ‚Vara‘ zu Maria Himmelfahrt aus. Ich war der jüngste unter den Jungen, die das Leben der Mutter Gottes mit darstellen durfte. Sie wählten für mich das Sonnenrad aus und ich durfte den Erzengel Gabriel mit dem Schwert spielen.‘
‚Lass es gut sein‘, sagte Vater und ich spürte, dass ich genug geredet hatte. Die Unbehaglichkeit, die Geschichte mit der Schule, quälte mich trotz vielen Redens. Den Brief der Lehrerin hatte ich nun mal vernichtet.
Wenige Tage nach meinem Gespräch mit Vater sprach ich mit Signor La Rosa. Er saß wie üblich auf seinem Stuhl und dirigierte die Arbeiter. Ich fühlte, dass er mich mochte. So fragte ich ihn, als ich bei ihm stand, ob ich etwas helfen dürfe. Ja, ich durfte. Ich durfte aus der Bar drei Espressi holen.
‚Domenico‘, sagte er, ‚hättest du Lust, dir in den Ferien ein kleines Taschengeld zu verdienen? Ihr Kinder habt viel zu lange Ferien und kommt in einem Alter wie in deinem nur allzu schnell auf dumme Gedanken.‘
‚Hat mein Vater mit Ihnen gesprochen?‘, fragte ich. ‚Das hat ja schnell funktioniert.‘ Als er verneinte, erzählte ich von meiner Unterhaltung mit Vater. ‚Dann‘, sagte ich, ‚haben sich unsere Gedanken gekreuzt?‘
‚So scheint es‘, erwiderte er. Hallo, dachte ich, ich habe Arbeit gefunden, ohne Hilfe, verdiene Geld. Da wird Vater froh sein. Am liebsten wäre ich Signor La Rosa um den Hals gefallen. Stattdessen schlug ich in seine Hand ein, wie ich es auf dem Viehmarkt zwischen zwei Männern gesehen hatte und bedankte mich.
Am selben Abend, als Vater müde von der Arbeit nach Hause kam, sich gewaschen und umgezogen hatte, wir vor unseren Spagetti-Tellern saßen, verkündete ich meine Neuigkeit. Mutter blickte enttäuscht zu mir herüber, sicher hatte sie die ständig verschmutzten Arbeiter des Signor La Rosa vor Augen. Ihre geheimen Wünsche für ihren Sohn mögen anders ausgesehen haben. Vater ließ mich reden. Ich denke, dass er über seinen ältesten Sohn, der mit zwölf Jahren schon so selbständig dachte, stolz war.
‚Nur in aller Welt‘, sagte er, ‚was treibt dich gerade zu diesem Beruf? Das musst du mir noch sagen.‘
‚Weißt du Vater‘, sagte ich daraufhin, ‚ich habe neben den Produkten – den Treppenstufen, den Fußbodenplatten, den Spülsteinen – eine fantastische Möglichkeit. Signor La Rosa möchte sich vergrößern. Grabsteine und Skulpturen herstellen. Ich habe jetzt schon in meinem Kopf, wie ich kleine Engel für Kindergräber modellieren werde.‘
Mutter fing an zu weinen und Vater schwieg ziemlich lange, dann sagte er: ‚Nun gut, Signor La Rosa ist ein zuverlässiger Padron, du kannst zu ihm gehen. Eine Bedingung stelle ich jedoch, dass du die Schule fertig machst.‘
Dann sagte ich es ihm. Alles. Von der Schule und dem Brief. Und was glaubst du Maria, wie mein Vater reagierte? Er hat mich seit diesem Tag wie einen Erwachsenen behandelt. Keine schlimmen Konsequenzen folgten, wie ich befürchtet hatte. Im Gegenteil, Vater ging so weit, mich bei schwerwiegenden Entscheidungen nach meiner Meinung zu fragen. Dass ich von nun an bis zum Abschluss regelmäßig die Schule besucht habe, versteht sich von selbst. Siehst du Maria, im Grunde habe ich immer gewusst, was ich wollte. Und du kannst mir glauben, dass ich mit dem Kredit alles in Ordnung bringe.“
„Auch die Hochzeit von Lorenzo?“
„Auch die Hochzeit von Lorenzo. Eine Hochzeit, die niemand vergessen wird!“
„Weißt du Domenico“, sagte Maria, „ich bin sehr traurig, dass ich deine Mutter durch ihren frühen Tod nie kennenlernen durfte.“
Träge erhob sich Lorenzo von seinem Lager. Er hatte nicht geschlafen und stand splitternackt vor einem großen Spiegel:
„Der Bräutigam“, sagte er sehr leise. „Ein schöner Bräutigam“, artikulierte er mit Nachdruck und strich sich mit gespreizten Fingern durch die parfümierten Haare. Zwei neue Zähne, welcher Luxus! Er hätte sie nicht machen lassen, wenn es nach ihm gegangen wäre. Und überhaupt, wo er ohnehin nie lachte. Nun ja, es war geschehen. Aber das war nun vorbei, nicht mehr zu ändern, die Zähne saßen fest. Erst vom Halbprofil, dann mit erhobenem Kopf, begann er mit dem Lächel-Lachzeremoniell. Solange bis er es fertig brachte, seinem Spiegelbild frontal so überschwänglich zuzulachen, dass sein Gelächter bis zur Küche drang. Es stimmte also doch, dass beim Lachen Tränen kommen konnten. Nun tropften sie von seinem Kinn auf die behaarte Brust und blieben dort wie Regentropfen hängen. Maria, die in der Küche herumhantierte, wunderte sich, als sie das Gelächter ihres Sohnes hörte. Man konnte nie wissen, was in einem Menschen vor sich ging. Man wird sehen. Jedenfalls hatte sie jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, da sie bei ihrer Friseuse einen Termin vereinbart hatte. Der Laden öffnete in einer viertel Stunde, da wollte sie die Erste sein. Nur zu ganz besonderen Anlässen gönnte sie sich diesen Luxus, der zur Verjüngung ihres Aussehens beitragen sollte. So auch heute, für die Hochzeit ihres Sohnes. Allen wollte sie es zeigen! Ihren Auftritt in der Kirche hatte sie schon viele Male durchdacht. Der Weg vom Auto, die Treppen zum Kirchplatz hinauf, mit dem Sohn an ihrem Arm, gehörte zum wichtigsten Akt. Maniküre, Pediküre, Schönheitsmaske, färben der Haare und Augenbrauen, alles würde sie ertragen, trotz Hitze.
„Mach dich schön“, rief ihr Lorenzo nach. Ja, das wollte sie. Sie schloss die Augen. Das monotone Geräusch der Trockenhaube führte eine angenehme Entspannung herbei. Jetzt hatte sie Ruhe, über alles nachzudenken. Sie hatte ihre Probleme, die sie still in sich trug. Ihr größtes Problem galt ihrem Mann Domenico, der mit seinem Starrsinn zu keinerlei Kompromissen bereit war. Aber das schwor sie sich, dieses Mal bestimmte sie, wie es weiterzugehen hatte. Die Geschichte mit Agata empfand sie als Versagen, als eine Verletzung ihrer Elternpflichten. Sie hatte es sich so schön ausgemalt, die Tochter stets bei sich zu haben, wo sie doch durch ihre labile Gesundheit dringend Hilfe brauchte. Zu allem Ärger kam Domenico in der letzten Zeit heim, wann er wollte. Er nahm keinerlei Rücksicht auf sie. Er wurde mit zunehmendem Alter immer schwieriger und vor allen Dingen, sagte er auch nie, wo er war. Das machte sie nachdenklich. Ihr Plan stand fest: Dieses Mal würde sie ihren ganz persönlichen Notgroschen dazu verwenden, die Geschichte mit Agata in Ordnung zu bringen. Die Gelegenheit – Lorenzos Hochzeit. Ihr Geschenk für ihn: Eine Reise nach Deutschland. Ohne Partnerin, nur er allein, das war ihr Pakt. Schmutzige Wäsche wusch man schließlich in der Familie.
Heute war ihr Tag! Ein plötzliches Freudengefühl stieg in ihr auf. Der Gedanke, dass sie ohne Domenico einmal ganz allein in der Geschichte mit Agata entscheiden würde, stimmte sie schadenfroh. Gut gelaunt streckte sie der Friseurgehilfin ihre Hände hin, ließ Finger- und Fußnägel lackieren. „Die Nägel könnten etwas länger sein“, dachte sie. Auf der anderen Seite mochte sie die langen Krallen ihrer zukünftigen Schwiegertochter auch nicht. Ein Kunststück, wenn man nichts im Haushalt tat. Armer Lorenzo! Nun, es war nicht ihre Sache. Er würde dann schon sehen, wen er sich eingehandelt hatte. – Sie stand auf.
„Bring’ mir den Brautstrauß auf dem Rückweg mit“, hatte Lorenzo ihr noch nachgerufen. Sie zahlte, legte dem Mädchen das Trinkgeld auf den Tresen, schaute noch einmal zum Spiegel hin und grüßte. Die Blumenbinderin wickelte gerade den Brautstrauß ein, als sie in den Laden trat. Gelbe Rosen mit weißen Orchideen und Schleierkraut, so ordnete es ihre zukünftige Schwiegertochter bei Lorenzo an, wie er ihr erzählte. Mein Gott, sie dachte an ihre Hochzeit. Domenico überreichte ihr rosarote Gladiolen. Sie hätte niemals gewagt, in dieser Frage über ihren Bräutigam zu bestimmen. Wie hatten sich die Zeiten geändert!
Schon von weitem sah sie Lorenzo am Fenster stehen. Sie wunderte sich schon den ganzen Tag, wie nervös und mürrisch er sich benahm. Er machte nicht gerade den Eindruck eines glücklichen Ehemannes. Ging ihm die Abwesenheit seiner Schwester Agata so nahe? Das erste Mal, dass sie ihn mit seinem Vater streiten sah. Das hatte er sich bisher nie erlaubt. Nun voran, zum Nachdenken blieb jetzt keine Zeit. Sie musste sich beeilen, Domenico behilflich sein, ihm, wie immer, den Krawattenknoten binden. Beide Männer waren bereit und warteten auf sie.
„Das Auto steht schon draußen“, rief Lorenzo der Mutter zu, die im Schlafzimmer verschwand.
„Ein anderes Kleid, andere Schuhe und ich bin fertig“, rief Maria zurück. Als sie mit Hut und ihren leider viel zu engen Schuhen zum Vorschein kam, rief Lorenzo aus: „Wie wunderschön ist Mutter!“ Dann nahm er sie am Arm, drückte ihr die Blumen in die Hand und stieg mit ihr die Stufen ihrer Hochparterrewohnung hinunter auf die Straße.
„Viva lo sposo – es lebe der Bräutigam“, riefen die Nachbarn, als Lorenzo in den Wagen stieg.
„Es ist schon spät“, sagte Maria und mahnte schneller zu fahren. Wie verhext standen alle Ampeln auf Rot. Der weiße Mercedes der Braut stand schon da. Freunde, Kinder und Schaulustige warteten vor der Kirche.
„Steig’ aus, öffne die Tür“, presste Maria nervös heraus und ließ sich von ihrem Sohn aus dem erhitzten Wagen ziehen. Wie eine Königin, das Bouquet an sich gepresste, stolzierte sie am Arm des Bräutigams in das überfüllte Gotteshaus.
Nach alter Tradition, führte sie den Sohn der Braut entgegen, während der Brautvater die Tochter zu ihrem Bräutigam begleitete. Das Hauptportal stand offen. Auf den roten Teppich wagte keiner mehr zu treten. Fotografen eilten hin und her. Scheinwerferblenden, Staunen, alte Frauen weinten als der Hochzeitsmarsch erklang. Im Rhythmus schritt das Paar unter Orgeltönen zum Altar.
„Was für ein schönes Kleid“, sagte eine Verwandte zu Maria geneigt, „welcher Luxus!“
„Ja, ja!“
Maria fand das Brautkleid reichlich übertrieben, vor allem die viel zu lange Schleppe, die kein Ende nahm. Armes Söhnchen! Über hundert Gäste, heller Wahnsinn! Das beste Restaurante! Und das Goldkollier mit seinen Steinen! Maria spürte deutlich, dass sie ihrer Schwiegertochter diesen Luxus nicht gönnte. Von Anfang an, mochte sie die affektierte Art des Mädchens nicht. Sie schluchzte aus Wut und faltete die Hände. Lorenzo schien alles sehr anzustrengen. Besorgt sah sie, dass er immer wieder den Schweiß von seiner Stirn entfernte. Gut, dass Ernesto der Freund und Trauzeuge neben ihm stand. Ein lieber Junge. Endlich kam der Priester. Er sprach gut gemeinte Worte mit Nachdruck und Eindringlichkeit. Plötzlich begann die kleine Vera fürchterlich zu weinen. Kaum dem Babyalter entwachsen, musste sie die Ringe, die auf einem weißen Atlaskissen lagen, mit ihren kleinen Händen tragen. Ein blond gelocktes Kind mit einem langen mit Volant verziertem Kleid. Die angestaute Wärme, das Licht der Lampen jener Fotografen, die den Ablauf filmten, war unerträglich. Ah, endlich, die Sache ging voran. Der Priester kam zum Kernpunkt der Vermählung und begann pathetisch, wobei er Lorenzo mit einem väterlichen Blick bedachte: „Ich frage dich, Lorenzo, willst du Barbara, die dir Gott anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte: ‚Ja, mit Gottes Hilfe.‘“
Ernesto nahm das Atlaskissen auf dem die Ringe lagen der kleinen Vera aus der Hand und reichte es beflissen dem Priester hin. Da, ganz außer Protokoll, man hörte nur den Ventilator surren, sagte Lorenzo mit aufgerissenen Augen gedämpft, doch so laut, dass es die Gäste in seiner Nähe deutlich hören konnten: „Nein! Es tut mir für alle leid, aber ich kann nicht anders.“
Der alte Priester, Begebenheiten dieser Art in keiner Weise gewohnt, musste sich erst fassen. Dann sagte er sehr mild, nicht ohne Zittern in der Stimme: „Aber weshalb?“
Diskret beugte sich daraufhin der Bräutigam zum Priester hin und flüsterte: „Weil meine zukünftige Frau die Frau eines andern ist. Ich habe sie gestern Abend durch einen reinen Zufall mit ihrem Liebhaber erwischt.“
Wie vom Blitz getroffen eilte Ernesto in einer derartigen Geschwindigkeit dem Ausgang zu, dass ihn die Empörung der wild gewordenen Hochzeitsgesellschaft nicht mehr erreichen konnte. Zwei Frauen aus dem Verwandtenkreis des Bräutigams traten hin zur Braut, rissen ihr den Kranz von ihrem Kopf und die Blumen aus ihrer Hand.
„Wir sind in einem Gotteshaus“, rief der Priester, doch umsonst. Wie versteinert stand Maria da. Sie traute ihren Augen nicht, als man auf die Braut einschlug und sie bespuckte. Erst als sie den Brautstrauß auf dem Boden liegen sah und den warmen Hauch des Sohnes spürte, löste sich ihre Erstarrung. Lorenzo hob die Blumen auf, reichte sie der Mutter. „Gehen wir feiern“, sagte er und schritt mit ihr, ohne sich auch nur einmal umzuschauen, dem Ausgang zu.
Domenico war wieder einmal nicht aufzufinden. Er hinterließ keinerlei Nachricht und kam drei Tage nicht nach Hause. Maria war entsetzt und versuchte aus ihm etwas herauszulocken. Doch umsonst. Stumm saß er da und überlegte. Die einzige Möglichkeit für ihn, sich abzulenken, bestand in Arbeit. Benito nahm ihn wie früher mit aufs Land. Am Abend ging er in seinen Geräteschuppen und beschäftigte sich mit seinen Flechtarbeiten. Maria war besorgt um ihn. Oft fand sie ihn schlafend auf einem Stuhl und sie hatte Mühe ihn zu überreden ins Bett zu gehen. Sie wollte unbedingt heimlich mit Benito sprechen.
„Du musst weg von hier“, sagte Benito zu Domenico. „Nimm deine Maschinen, packe Maria und den Hausrat ein, fange noch einmal da an, wo du einst begonnen hast. Höre auf dein Herz. Meine Verwandten aus Naxos erzählen viel Gutes. Sie bauen dort wie die Weltmeister und wo man baut, gibt es Arbeit genug, besonders in deinem Gewerbe.“
Es lohnte sich darüber Gedanken zu machen, dachte Domenico und begann wieder aufzuleben.
„Ich mache dich mit meinem Vetter in Naxos bekannt“, sagte Benito. „Vielleicht kann er dir eine Mietwohnung und eine Bleibe für deine Maschinen besorgen.“