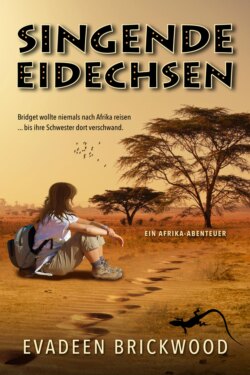Читать книгу Singende Eidechsen - Evadeen Brickwood - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеWorauf hatte ich mich da bloß eingelassen? Klar, Tony war traurig und durcheinander und das alles, aber es war unmöglich mit ihm über Claire zu sprechen. Der einfühlsame Augenblick beim Flughafen war verflogen. Und er schien es mit den Nachforschungen auch nicht sehr eilig zu haben. Warum nur war das so schwierig mit ihm?
Tony musste doch sicher auch mehr herausfinden wollen, oder? Warum sonst war er noch hier? Aber ich konnte ihn noch nicht mal dazu bringen über meine Schwester zu reden, geschweige denn einen Plan zu machen. Vielleicht war er ja verhext. Unsinn, sagte ich mir. Fang nicht an zu spinnen, Bridget, es wird sich schon alles geben.
Ich tat mein Bestes, versuchte verständnisvoll zu sein, ihm Zeit zu geben. Aber ich hatte keine Zeit. Ich war aus England gekommen, nur um ihm bei der Suche zu helfen. Aber er machte keine Anstalten zu suchen.
Ich saß in einem abgelegenen afrikanischen Dorf, in dem ich sonst niemanden kannte, und wollte endlich loslegen. Und alles was ich bekam waren so komische Pausen, wenn ich das Thema ansprach.
Ich kannte Tony zu wenig. Vielleicht würde er mich ja rausschmeißen, wenn ich ihm Vorhaltungen machte. Und ich hasste Konfrontationen sowieso. Aufgeben kam aber nicht in Frage. Was blieb mir anderes übrig als Geduld zu üben.
Ich musste mich auch erst einmal akklimatisieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Staub und die Hitze machten mir zu schaffen, und jetzt hatten auch noch die Regenfälle eingesetzt. Der Regen kühlte die Tagestemperaturen ab, aber nie für lange. Und meine Denkfähigkeit schien auch sehr unter der Hitze zu leiden.
Als Mom am Freitag prompt anrief, war ich ungeheuer froh ihre knisternde Stimme zu hören. Wenigstens wollte sie mir helfen.
“Vielleicht ist Claire über die Grenze gegangen - in ein anderes Land.”
“Das glaube ich nicht, Mom,” erwiderte ich vorsichtig.
“Du kannst doch nachfragen, oder? Die Polizei sollte das mal nachprüfen.”
“Ja, Mom, ich werde mich drum kümmern.” Wie sollte ich meiner Mutter erklären wie leicht es war über die grüne Grenze zu verschwinden ohne die geringste Spur zu hinterlassen?
“Gut.” Sie schien zufrieden zu sein.
“Mom?”
“Ja?”
“Ich hab’ dich sehr lieb Mom.” Ich schluckte ein paar Heimweh-Tränen hinunter.
“Ich dich auch, Bridget.” Ich hörte meine Mutter ein wenig schluchzen.
“Sag’ Dad, dass ich ihn auch lieb habe. Bis bald.”
Ich riss mich zusammen. Beim Hoteleingang war nicht leicht gefühlsduseln.
“Tschüss, pass auf dich auf,” sagte Mom langsam, so als wollte sie mich nicht gehen lassen.
“Tschüss dann.” Ich hängte auf und war wieder allein unter den ganzen Hotelgästen.
Das Landhotel hatte ein großes Restaurant, eine Bar beim Eingang und zwei Billardtische. Auf der Theke stand das unbezahlbare Telefon und jeden Freitagabend versammelte sich die gesamte Gegend im Botsalo.
Tonys Lehrer-Freund, Neo Moletsane, kam aus der nahegelegenen Stadt Serowe. Neo war single und die beiden verbrachten die meisten Abende im Botsalo Hotel. Das neue Semester hatte noch nicht begonnen und es gab nicht viel anderes zu tun. Also kam ich mit.
Neo Moletsane war ein gebildeter junger Mann. Er unterrichtete die Maurer am Berufszentrum, während Tony für das Fach Wirtschaftslehre verantwortlich war.
Der etwas untersetzte Neo trug immer ein sauberes Baumwollhemd, nie T-Shirts oder Jeans. Tony sagte, wir könnten ihm vertrauen und er wusste, warum ich nach Botswana gekommen war. Immerhin.
Die beiden spielten Billard, assen zu Abend, tranken ziemlich viel Bier und schwatzten mit den anderen Leuten dort. Ich saß mit meinem Buch in einem der gemütlichen Clubstühle in der Eingangshalle und las.
Die meisten Gäste waren in Hotelzimmern hinten beim Swimmingpool untergebracht und reisende Vertreter brachten oft Neuigkeiten aus anderen Gegenden Botswanas mit. Nichts was mich interessierte, aber ich hörte höflich zu.
Um den Schein zu wahren, stellte Tony mich überall als seine Freundin vor, die aus England zu Besuch gekommen war. Wir hatten beschlossen, dass es besser war die wahre Absicht meines Aufenthaltes geheimzuhalten.
Aber ich fragte mich wie lange es wohl dauern würde, bis man in Palapye die Wahrheit spitz kriegte.
Einheimische Mädchen kamen auch zum Hotel. Anscheinend oft aus zwei Gründen: um sich mit ihrem Freund zu treffen oder einen Freund zu finden. Das hatte Neo gesagt, in einem traurigen Tonfall. Die meisten kamen aus dem Dorf. Einige lebten in bequemen Häusern, die von ihren Lekgoa Freunden gemietet wurden.
Da Palapye an der Hauptstraße auf halbem Wege zwischen Gaborone und Francistown lag, stiegen Reisende gern hier ab.
Andere Frauen waren Angestellte am Berufszentrum, denen es gefiel sich in der Gesellschaft von Lekgoas aufzuhalten. Es gab auch einige ausländische Frauen wie mich, die waren aber zu sehr an Tratsch und Gin & Tonic interessiert. Es war nicht leicht sich mit den rauen Sitten der Männer hier abzufinden. Ich hielt mich lieber an mein Buch und die Government Gazette.
Oft war es schon dunkel, wenn wir auf sandigen Feldwegen nach Hause fuhren. Mittlerweile konnte ich gut verstehen, warum jeder so nervös war nachts mit dem Auto zu fahren.
Einmal hatte Tony fast zwei schläfrige Kühe angefahren, die sich im warmen Sand breit gemacht hatten. Nach einigem Hupen und Schreien, ließen sich die Viecher dazu herab sich von ihrem weichen Lager zu erheben, und vorwurfsvoll muhend davon zu trotten.
Ein anderes Mal fuhr der Wagen gegen einen im Schlamm verborgenen Stein und schlingerte vom Weg ab. Wir sanken in den schwammigen Ackerboden ein und brauchten zwei Holzplanken und eine Menge Muskelkraft, um den Toyota wieder auf den Sandweg zurück zu bugsieren.
“Wenn mich nochmal jemand fragt: ‘na, wann wird denn geheiratet?’, fang’ ich anzuschreien,” beschwerte ich mich eines Abends bei Tony, als wir uns wieder mal Richtung Komplex aufgemachten.
Er steuerte vorsichtig durch den grauen Sand. Der war noch tief zerfurcht vom letzten Gewitterregen. Regenbäche hatten sich kreuz und quer einen Weg gebahnt. Im Scheinwerferlicht sah man hier und da gezackte Steine herausragen. Man musste höllisch aufpassen.
“Tja, es gehört eben zum guten Ton, seine Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken,” sagte Tony. “Es gibt sicher bald was anderes durchzuhecheln, aber im Moment sind wir noch ein aufregendes Thema.”
Zwei Angestellte bei irgendeiner Mine hatten uns nach einem Gin und Tonic zum Abendessen im Restaurant eingeladen. Erst wollten wir nicht, aber sie schienen Unterhaltung nötig zu haben und wir gaben nach. Es gab Schlimmeres als zum Abendessen eingeladen zu werden.
‘Kingklip Thermidor’ war die Spezialität des Hauses. Der Fisch war frisch und lecker gewesen und die beiden hatten Wein bestellt.
“Weißt du, als du auf der Toilette warst? Der eine Knilch hat mir doch tatsächlich gesagt, ich sollte dich verlassen und mit ihm nach Orapa kommen. Er hätte in der Diamantenmine genug Geld für uns beide verdient, und wollte sich gut um mich kümmern.” Ich musste kichern. “Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm ‘ne Abfuhr gab.”
Tony war still. Hörte er mir zu?
“Wann war das denn?” fragte er besorgt.
“Na, als du auf der Toilette warst. Er hat’s wohl einfach mal probiert.”
“Wetten, der wird sich so bald nicht wieder anbieten.”
“Ich war nicht wirklich gemein zu ihm. Erklärte ihm nur, dass man Liebe nicht mit Geld kaufen kann und dass ich dich nie verlassen werde,” sagte ich. “Meine Predigt hat ihn fast zu Tränen gerührt.”
“Wahrscheinlich hat er sich seiner leidgeplagten Frau und Kinder in Südafrika erinnert. Und was für ein Hund er ist,” sagte Tony verachtungsvoll.
Der Wagen ächzte weiter durch den Sand. Wir waren an einer vertrauten Weggabel mit einem niedergetrampeltem Zaun angelangt.
“Ja, es war die kleine Notlüge wert,” kicherte ich zufrieden.
Das war einer der unbeschwerteren Momente gewesen. Es gab aber noch immer diese unangenehmen Pausen zwischen uns.
Ich wurde aus Tony einfach nicht schlau. Zum einen konnte ich mich noch nicht mit der hiesigen Langsamkeit abfinden. Zum anderen fand ich, dass Tony es nicht gerade eilig hatte, der Sache mit Claire auf den Grund zu gehen.
Vielleicht ich ihn ja missverstanden. Vielleicht hatte ich mir nur eingebildet, dass er der Sache auf den Grund gehen wollte. Aber was machte er dann noch hier in Palapye? Warum hatte er mich eingeladen?
Ich brachte ihn irgendwie dazu, mit mir zur örtlichen Polizeistation zu gehen.
Das schmuddelige Gebäude saß auf der anderen Seite der Eisenbahnschienen neben dem schmuddeligen Posthäuschen. Post wurde in einem klapprigen Fahrzeug donnerstags oder freitags angeliefert und musste abgeholt werden. Eine gute Gelegenheit, mal schnell in die Polizeistation ‘reinzuschauen.
“Guten Tag. Wir wollten fragen, ob es in diesem Fall schon etwas Neues gibt —” Tony schob ein Stück Papier mit der Aktennummer über die Theke.
Der Polizist sah sich den Zettel an und verschwand für einige Zeit in einem Hinterzimmer, bevor er mit einem älteren Beamten wiederkehrte. Der war kurz angebunden.
“Tut mir leid Sir, aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Keine neuen Erkenntnisse.”
Ich stellte hartnäckige Fragen, aber es half nichts, denn Fragen begegnete man mit ausdauernder Gleichgültigkeit. Ich prallte an einer unsichtbaren Mauer ab. Damals vermutete ich, dass die Mühlen in Botswana eben nur sehr, sehr langsam mahlen. Soviel hatte ich schon begriffen. Ich ging danach ab und zu allein zur Polizeistation. Irgendwie würde es schon weitergehen.
Wie sollte ich die Situation Freunden und Familie in Cambridge erklären? Ich drückte mich einfach und schrieb, wie wundervoll Palapye war, wie das Abendrot zwischen den Hügeln hinter dem Komplex glühte. Reine Magie.
Wie Tony mir dabei half, etwas über Claires Verschwinden herauszufinden, wie hilfsbereit die Polizei war… Kurzum, ich log was das Zeug hielt.
Die Sonnenuntergänge waren zwar spektakulär, aber Tony bemühte sich nicht gerade. Und die Polizei schon mal gar nicht. Was sollte ich bloß tun?
Ich würde nach Gaborone fahren und mit der Polizei dort sprechen - ja und außerdem mit Zeugen in Bobonong und Motschudi. In der Zwischenzeit musste ich versuchen, mich in diesem seltsamen Ort zurechtzufinden.
In den letzten beiden Ferienwochen kam langsam etwas Leben ins Berufszentrum. Ganz langsam.
Bis auf die Angestellten und einige ausländische Lehrer, war der Komplex immer noch recht verlassen. So sehr ich mich in England manchmal nach Ruhe gesehnt hatte, war es jetzt zu ruhig. Ich sehnte mich nach ein paar verständigen Freundinnen, mit denen ich mich unterhalten konnte.
Oh Liz, Diane und Sahida, es tut mir leid, wenn ich euch nicht genug zu schätzen wusste!
Was Kommunikation anging, befanden wir uns ja noch in grauer Vorzeit. E-Mail, SMS und Mobiltelefone gab es noch nicht und sowas wie Skype existierte höchstens in Science Fiction Filmen.
Um nicht den Verstand zu verlieren, machte ich mich daran, in Tony’s Garten Blumen, Kräuter und Unkraut, das wie Blumen aussah, anzupflanzen. Tony hielt es fürs beste, mir das Projekt zu überlassen.
Tagelang grub ich den sandigen Boden um und mischte stinkigen Kuhmist darunter, den Tony Lastwagenweise bestellt hatte. Dann wurde alles eingegraben. Buschige Motsetsizweige aus dem Dorf lagen in großen Haufen neben der Auffahrt. Das alles zur Belustigung der einheimischen Komplexarbeiter. Für mich war es die reinste Therapie.
Neo hatte mir versichert, dass die Motsetsi-Pflanzen schnell anwachsen würden. Alles was man machen musste, war sie am Zaun entlang in den Boden zu stecken und oft zu wässern.
Ein kleiner Steingarten war als Nächstes an der Reihe. Wir hatten nach einer wackeligen Fahrt über Stock und Stein von einem ausgetrockneten Flussbett glatte Steine mitgebracht.
Und das war noch lange nicht alles.
Neo erwähnte, wie man aus verschieden großen Autoreifen einen Gemüsegarten anfertigen konnte. Die Reifen wurden aufeinandergelegt und mit Kompost gefüllt. Das Ganze hieß dann ‘Wakah’.
“Das braucht kaum Wasser und wenig Pflege, und du hast immer frischen Salat und Kräuter zur Hand,” meinte er.
Bald stand ein dreistöckiger Wakah-Turm im Garten. Der ständige Regen half winzigen, grünen Blättchen dabei sich durch den Boden zu arbeiten. Ein zähes Akazienbäumchen vervollständigte den Garten.
Meine Hände waren schmutzig und meine Nägel ungepflegt, aber ich war stolz auf meine Leistung.
All das musste auch ein faszinierender Anblick für Ethel Poppelmeyer gewesen sein. Ethel war die ziemlich propere Frau des glatzköpfigen neuen Schuldirektors, dessen Bauch sich gerade noch in den hellblauen Safarianzug knöpfen ließ Die beiden waren Tonys direkte Nachbarn.
Wir waren einander noch nicht formell vorgestellt worden, aber ich wusste dass Ethel nebenan wohnte. Sie beobachtete mich oft hinter cremefarbenen Spitzengardinen, die mit ihr aus England angereist waren. Wahrscheinlich gab es noch nichts anderes zu beobachten.
Sie nahm offenbar an, dass Tony und ich in Sünde lebten. Zumindest hatte ich das im Botsalo Hotel gehört. In dem kleinen englischen Ort Cobblestead, aus dem sie stammte, hätte man so eine Lebensart wohl nicht toleriert. Ich fand das erheiternd.
Ich ging nach der Arbeit ins Haus, um mich zu waschen. Teile des Gartens klebten noch an mir und das Wasser tropfte mal wieder braun und spärlich aus dem Hahn.
Na prima. Ich brauchte eine Weile, um mich sauber zu schrubben. Ich war gerade dabei mich mit einem gekühlten Getränk auf der Veranda niederzulassen, als ich sah wie Ethel die noch leeren Fertighäuser auf der anderen Straßenseite inspizierte.
Es musste Ethel sein, da es nicht viele Frauen mit dauergewelltem blonden Haar im Komplex gab. Sie kam herüber, um unsere neu gepflanzte Motsetsihecke zu begutachten. Komm’ schon Bridget, gib dir einen Stoß Sei ein guter Nachbar und rede mit ihr, sagte ich mir. Schließlich interessierte sie sich immer so sehr für meine Gartenarbeit.
“Hallo Ethel, ich heiße Bridget, schön Sie endlich kennenzulernen,” begrüßte ich sie und schlenderte die Auffahrt hinunter. Jeder hier benutzte Vornamen, also dachte ich mir nichts weiter dabei.
Ethel fuhr zusammen und stieß sich vom Zaun ab, als sei er elektrisch geladen. Ihre Augen unter den hellen, buschigen Augenbrauen betrachteten mich misstrauisch. Sie machte einen schwachen Versuch mir die Hand zu schütteln, überlegte es sich aber anders und streichelte lieber eine junge Motsetsipflanze.
Offenbar hatte sie nicht bemerkt, dass ich zuhause war. Du lässt nach, Ethel, dachte ich amüsiert.
“Wie geht es Ihnen?” antwortete sie steif und ihr Gesicht nahm einen dünkelhaften Ausdruck an.” Wir sollten uns mit Nachnamen anreden. Wissen Sie denn nicht, dass ich die Frau des Schuldirektors bin?”
“Sicher weiß ich das.” Jeder wusste, dass sie die Frau des Schuldirektors war.
“Man muss schließlich einen gewissen Anstand wahren, vor allem in so fremden Breiten. In dieser Wildnis. Ich werde Sie mit Miss Reinhold ansprechen und für Sie bin ich bitteschön Mrs. Poppelmeyer.”
Sie hielt ihre Rede ohne die geringste Spur eines Lächelns auf den dünnen Lippen. War es Ethel noch nicht in den Sinn gekommen, nett zu ihren Mitmenschen zu sein, wenn sie in der Wildnis nicht vor Einsamkeit zugrunde gehen wollte?
“Aber natürlich, verzeihen sie meine Vorwitzigkeit. Ich werde ab jetzt immer tadellosen Anstand zeigen, Mrs. Poppelmeyer,” sagte ich voll Ironie, was sie nicht zu bemerken schien.
“Ja,” sagte sie nachdenklich. “Vielleicht darf ich Sie ja schon bald mit Mrs. Stratton anreden?”
Das wurde ja immer bunter. “Das glaube ich kaum. Tony und ich haben nicht vor zu heiraten.”
“Oh, wie bedauerlich, Miss Reinhold,” sagte Ethel eisig. “Unter diesen Umständen werden wir kaum etwas miteinander zu besprechen haben, Miss Reinhold.” Anscheinend mochte sie meinen Nachnamen, weil sie ihn ständig wiederholte.
Sie streckte ihre Nase noch etwas höher in die Luft.
“Ja, das ist sehr bedauerlich, Mrs. Poppelmeyer. Aber ich bin davon überzeugt, dass Sie gute Gründe dafür haben.”
“Durchaus.” Sie ließ endlich die arme Motsetsi Pflanze los und strich stattdessen ihre bestickte Schürze glatt.
“Es war trotzdem nett, sie kennenzulernen.” Ich hätte ihr noch gerne so einiges an den Kopf geworfen, aber um Tonys Willen lächelte ich nur.
“Guten Tag Miss Reinhold. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt, ich bin äußerst beschäftigt.” Damit drehte sie sich um, stieß fast mit einem streunenden Hund zusammen und marschierte zum Haus des Schuldirektors zurück. Kurz darauf bewegten sich die Spitzengardinen. Ich setzte mich kopfschüttelnd mit meinem Glas auf die Veranda.
Irgendwie tat sie mir leid. Vielleicht hatte die afrikanische Hitze Ethels Gehirn ja ein wenig durchgebraten. Andererseits hatten die Poppelmeyers laut Tony einige Zeit in Südamerika gelebt. Na, wenn das nicht genauso exotisch war wie hier!
Tony lachte nur über die Sache mit Ethel.
“Sie kriegt noch einen steifen Hals, wenn sie ihre Nase immer so hoch hält. Das macht sie bei allen so. Ethel Poppelmeyer ist eine einsame Frau,” sagte er. “Alle ihre Hausmädchen laufen nach ein paar Tagen davon. Sie scheint sich für so’ne Art Adelsdame auf ihrem Schloss zu halten. Um sie herum gibt’s nur niedere Dienstboten.”
“Nur dass es hier kein Schloss gibt. Und schon gar keine niederen Dienstboten.”
“Ganz genau.”
“Sie scheint sich hier nicht sehr wohlzufühlen. Manche Leute können sich eben nicht so leicht anpassen,” meinte ich.
Tony grinste verschmitzt. “Wahrscheinlich eher ‘falsches Jahrhundert’.”
Palapye war nicht gerade der unterhaltsame Ort, den ich mir in meiner Fantasie vorgestellt hatte.
Es gab keine wimmelnden Märkte, keine wilde Tanzmusik und keine lachenden Marktfrauen in farbenfroher Kleidung. Die Einheimischen konnten ziemlich zurückhaltend sein. Ein Zustand, dem sie manchmal mit genug Hirsebier Abhilfe schafften.
Auch kein einziger afrikanischer Krieger weit und breit, der im entferntesten wie Shaka Zulu aus der Videoserie aussah. Überhaupt trug niemand so kreative, afrikanische Kleidung wie im Film. Dafür gab es eine Menge roter Erde, grauen Sand, staubige Pflanzen und glühende Hitze. Es gab viel zu wenig Leute zum Unterhalten und zu viel Zeit zum Nachdenken.
Eine Woche später erwies mir Mrs. Poppelmeyer noch einmal die Ehre. Es war niemand sonst greifbar, deshalb beschwerte sie sich wohl bei mir bitterlich über ihren Gärtner, der eine Arbeitshose zerrissen hatte. Er war nicht wieder erschienen, nachdem sie ihm richtigerweise 10 Pula vom Monatslohn abgezogen hatte.
War ihr denn nicht klar, dass der Ärmste von den 50 Pula, die er im Monat verdiente, seine Familie ernähren musste? Wenn ich mich richtig erinnere, waren 10 Pula im Jahr 1988 etwa 1 Pfund Sterling wert. Ein Vermögen für einen einfachen Gärtner.
“Als mein Mann und ich in Bolivien wohnten, wo er natürlich der Schuldirektor eines sehr wichtigen Colleges war, wäre so etwas nicht vorgekommen. Das Personal spurte. Mein Mann brauchte nur zu sagen ‘Hey chico, komm her und mach’ das hier’ und der Dienstbote gehorchte. Aber diese Schwarzen sind so schwierig —” grollte sie.
Ich sagte lieber nichts dazu und machte mich wieder an meine Gartenarbeit mit der Notlüge, dass Tony alles bis Tagesende fertig haben wollte.
Danach behelligte mich Ethel nicht mehr. Einige Zeit später hörte ich Gerüchte, dass sie wieder nach Cobblestead zurückgegangen war. Ethel hatte ihren ach so hart arbeitenden Ehemann einfach in der afrikanischen Wildnis zurückgelassen.
Ein anderer Nachbar war wieder aus England eingetroffen. Alfred Jones wohnte links neben Tony. Er unterrichtete Holzwerken und war ein richtiges Original. Seine hochschwangere Frau war lieber in Cardiff geblieben.
Alfred war ein kräftiger Bursche und ziemlich verschroben. Er hatte ungekämmte graue Haare und einen drahtigen Bart, hinter dem sich fast sein ganzes Gesicht verbarg.
Er schrieb seiner Frau Judith jeden Tag einen Brief. Meist am Nachmittag, bevor er sich auf seiner Veranda ein paar Biere hinter die Binde kippte. Manchmal nahm er mich zur Polizeistation mit, wenn er den Brief aufgab. Alfred Jones konkurrierte mit mir auch schon mal um das Telefon im Botsalo Hotel.
Tony lud ihn öfter mal zu einem Gespräch ein, damit er nicht ganz so einsam war. Es war ein Anblick für die Götter, wenn unser Nachbar mit einer Kerze in der Hand, umständlich auf einen Stuhl stieg und über den Zaun kletterte. Stromausfälle waren keine Seltenheit.
Bei einer solchen Gelegenheit hatte er mal in der Dunkelheit meine Hand ergriffen und sie festgehalten – vollkommen betrunken natürlich. Hinterher konnte er sich an nichts mehr erinnern, aber Tony hatte das mit der Kerze vorgeschlagen.
Der Schulbeginn rückte näher und die Frauen zweier Tswana-Lehrer waren damit beschäftigt sich im Komplex häuslich niederzulassen.
Sie bereiteten den lieben langen Tag Mahlzeiten für ihre Großfamilien zu. Das Hauptgericht hieß Mielie Pap und wurde im Garten in dreibeinigen, schwarzen Eisentöpfen gekocht. Der feste Brei bestand aus gestampftem weißen Mais und das hölzerne Stampfen war ständige Hintergrundmusik. Es ging Ethel Poppelmeyer sicher schrecklich auf die Nerven.
Dazu gab es meist Maroch, wilden Spinat. Die Frauen liefen auch ständig hinter ihren Kindern her und wuschen Kleider oder beaufsichtigten junge Mädchen dabei.
Leider konnten wir uns nicht verständigen. Mein Setswana existierte fast gar nicht. Eine ausführliche Unterhaltung war deshalb ausgeschlossen. Mrs. Matija, eine Matrone mit fünf kleinen Kindern, brachte es immerhin fertig, mich auf Englisch zu begrüßen und dabei kichernd ihre Füße zu betrachten.
“Guten Morgen, Mrs. Matija, wie geht es Ihnen? Oh, ist das Ihr jüngstes? Hallo.”
“Guten Morgen, Miss Reynole.” Das war schon alles.
Ihr Mann war einer der leitenden Lehrkräfte am Berufszentrum. Eine Stellung, die er mit Würde und Sinn für Tradition wahrnahm.
Es war mittlerweile klar, dass mein Aufenthalt länger wurde als erwartet. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich musste Setswana lernen.
Tsanana, unsere Maid, kam jeden Tag aus dem Dorf und machte bei Alfred und Tony sauber. Sie war das einzige weibliche Wesen, mit dem ich mich einigermaßen unterhalten konnte. Sie war zur Schule gegangen und – oh Glück - sprach ein wenig Englisch. Während sie putzte, brachte Tsanana mir Einfaches auf Setswana bei: “Dumela mma - Guten Tag, Madam.”; “Dumela ra - Guten Tag, Sir.”; “Le kai? - Wie geht es Ihnen?”; “Re teng - Mir geht es gut.”; “Ke utlwa Setswana gologonje - Ich verstehe ein wenig Setswana.”
Ich musste die Sätze wie ein Papagei wiederholen. Aber sie war geduldig, auch wenn es mit der Aussprache nicht gleich klappte. Oh, all diese ‘g’ Laute, die wie ein hartes ‘ch’ ausgeprochen wurden. Und dann gab es da die kleinen Eigenheiten, die ich mir merken musste. Zum Beispiel, dass ‘ph’ wie ‘p’ und ‘sh’ wie ‘s’ gesprochen wurde und dass ein ‘er’ sich oft unerklärlicherweise in eine ‘sie’ verwandelte.
Endlich brachte ich einen einfachen Gruß auf Setswana zustande: “Dumela”. Das war noch nicht genug für eine Unterhaltung, aber immerhin ein Anfang. Nachmittags trommelte der Regen auf das Blechdach und wir mussten lauter sprechen.
“Tsanana, warum sehen die Leute mich nicht an, wenn ich mit ihnen spreche?” wollte ich wissen. Die seltsame Angewohnheit auf die Füße zu starren war mir bei den Einheimischen immer wieder aufgefallen.
“Nein Madam, sie schaut auf die Füße aus Respekt!” erklärte Tsanana mir geduldig. Das war natürlich das genaue Gegenteil von Respekt in der westlichen Kommunikation.
Tsanana nannte mich immer noch Madam. Die afrikanischen Hierarchieregeln waren da streng. Sie war ganz erschrocken als ich ihr das ‘Du’ anbot.
‘Oh Madam, ich darf Mma nicht Bridget nennen. Muss Respekt zeigen,’ hatte sie gesagt.
Sie weigerte sich auch mit mir in einem Zimmer zu essen oder gar am selben Tisch. Das war undenkbar. Stattdessen saß sie auf dem Küchenboden. Der Fußboden war sehr sauber, aber verstehen konnte ich das trotzdem nicht.
Tsanana bestand darauf, dass es ihre Kultur so verlangte. Sie musste Respekt zeigen. Wir waren als ihre Arbeitgeber so etwas wie ältere Angehörige. So war das eben. Wenn jemand herausbekam, dass sie uns nicht genug Respekt entgegenbrachte, gab es Schwierigkeiten. Wie konnte ich da nicht nachgeben?
Die Kommunikation mit England war schleppend. Von den Anrufen einmal abgesehen, waren Briefe der einzige Kontakt zur Außenwelt.
Mit einiger Verspätung hielten sie mich über das Leben in Cambridge auf dem Laufenden. Zum Beispiel erfuhr ich von Zahida, dass David eine neue Freundin hatte. Ich kannte Pippa und wusste, dass sie bei weitem nicht so querköpfig war wie ich.
Gut, David hatte endlich die Richtige gefunden. Keine Eifersucht, kein Schmerz. Nur ein wenig Heimweh. Kneipen und Kinobesuche erschienen mir mittlerweile sehr verlockend. Und wie ich zu meiner Schande gestehen musste, vermisste ich das britische Fernsehen.
Aber je mehr ich mich an meine afrikanische Umgebung gewöhnte, desto weniger fehlte mir das Kneipenessen und die nächste Folge von Coronation Street.
Ich schrieb eifrig zurück. Über den Vogelgesang am Morgen, Tonys Garten und den erdigen Geruch der Savanne. Über Mrs. Poppelmeyer und wie lautstark sich die Tswanas auf der Straße unterhielten.
Aber sie interessierten sich mehr für meine bislang erfolglose Suche nach Claire und fragten danach. Nur wie sollte ich ihnen die unüberwindlichen Hürden erklären, die sich in Botswana vor mir auftürmten? Wie naiv ich gewesen war, als ich dachte, man könne hier einfach in einen Bus oder Zug steigen und drauflossuchen. Die Infrastruktur war hoffnungslos vorsintflutlich.
Bobonong war ja angeblich in der Nähe von Palapye. Ich wollte unbedingt dorthin. Und von dort aus zum Tuli Block. Aber sogar mit einem Auto war die anstrengende Fahrt durch Regen und Schlamm ziemlich wahrscheinlich von Misserfolg gekrönt.
Es gab kaum Straßenschilder, dafür aber eine Menge Abzweigungen. Zudem war Tonys Toyota gerade in der Werkstatt. Ich konnte noch nicht mal zum Botsalo fahren, um das Reservat im Tuli Block anzurufen. Tony hatte keine Zeit oder Lust, mich in einem vollbesetzten Minitaxi dorthin zu begleiten.
Was war, wenn der Wagen liegenblieb? Mit ‘Dumela mma’ konnte man sich schlecht durchfragen. Nicht mal Claire war durch schlammige Straßen gefahren und sie war auf dem Weg zum Reservat verlorengegangen. Ich hatte Angst. Das Risiko, dass ich mich verfahren würde, war einfach zu groß. Wieder hieß es abwarten.
Meine Eltern waren erleichtert, dass ich nichts über Schießereien oder Bomben zu berichten hatte. Die einzigen Waffen, von denen ich wusste, hingen über den Schultern der Soldaten an den Straßensperren.
Am meisten fehlte mir Claire! Sie hätte schon eine Idee gehabt, was zu tun sei. Sie hätte nicht gewartet. Ich zeigte schon so viel Mut, wie ich nur aufbringen konnte.
Hinter dem Schulkomplex drängte sich ein kleines Tal. Wegen der hohen Zäune musste man den Komplex verlassen und sich auf einem engen Pfad entlangtasten, um ein Plätzchen mit schönem Ausblick zu finden. Ich träumte manchmal davon, Claire eines Tages dort hinter den Hügeln wiederzufinden. Bald.
In der Zwischenzeit musste ich zu Fuß einkaufen gehen. Die lange Straße vom Berufszentrum zu den Shops war zwar frisch geteert, machte aber einen weiten Bogen um das Dorf.
Es gab kein Fleckchen Schatten und der ölige Teerbelag blieb an den Schuhen kleben. Es war besser die Abkürzung zwischen Bäumen und Motsetsi-Kraals zu nehmen. Auch wenn man durch den tiefen, hellen Sand waten musste. Aber auf keinen Fall barfuß. Der Sand war zu heiß und barg scharfe Objekte.
Zu meiner Enttäuschung gab es keinen traditionellen Markt in Palapye. Das einzige was man als Dorfzentrum bezeichnen konnte, war die kurze gemauerte Hausreihe, die wir die Mall nannten. Das Botsalo Hotel war weit davon entfernt. Auf der anderen Seite der vielen Kraals.
Die einzigen zwei Läden waren der Gemüsehändler, wo man vor allem Kohlköpfe, Spinat und Kürbis erstehen konnte und ein Laden, der die notwendigsten Lebensmittel verkaufte, wie Brot, Crosse & Blackwell Mayonnaise und H-Milch.
Daneben war eine Shebeen, eine afrikanische Kneipe, wo man einen Happen essen konnte. Tswanas suchten Shebeens gewöhnlich für einen Humpen Hirsebier auf. Neo Moletsane hatte uns dort stolz zu einer Mahlzeit Pap mit fettigem Kochfleisch und Tomatensoße eingeladen.
Wir setzten uns an einen der wackeligen Tische, die mit geblümtem Wachstuch bedeckt waren. Das bestellte Essen kam auf viel benutzten Plastiktellern mit Rote-Beetesalat und mit unsauberem Besteck.
Kein Liebhaber von fettigem Fleisch, hielt ich mich an den Pap und rote Beete. Ich versuchte das ungewohnte Hirsebier nicht gleich wieder auszuspucken. Neo bemerkte mein Unbehagen und bestellte eine Cola.
Mein Einkaufsausflug endete angenehm, als Alfred, der gerade Mittagspause machte, mich zum Komplex zurückfuhr.
Als das Auto wieder fahrtüchtig war, fuhr Tony mit mir nach Serowe und Selebi Phikwe. Die Speisekammer musste aufgefüllt werden.
Es gab dort richtige Supermärkte! Sie hatten Kühlschränke und man bekam frische Milch, Obst und Gemüse.
“Endlich,” stöhnte ich. “Ich hab’ Dosenfutter so satt.”
“Deshalb brauchen wir Kühlboxen. Im heißen Kofferraum kann ein Salat schon mal zu Brei werden. Wie gekochter Spinat.”
“Klasse. Und statt Joghurt gibt’s dann Käsekuchen.”
“Ja genau. Aber das wäre gar nicht so schlecht.”
“Claire liebt Käsekuchen.”
“Mhm.”
Das war alles was er sagte. Es war einen Versuch wert gewesen, aber wie lange würde das noch so weitergehen?
Tony hatte keine schlechte Laune oder so und wir gingen nach dem Einkaufen ins Museum für Tswana-Kultur. Der Eingang zu dem einfachen Gebäude war verschlossen.
Auf dem Schild stand aber deutlich, dass das Museum am Samstag geöffnet war. Tony fragte ein paar Männer auf der Straße.
Sie sprachen ein wenig gebrochenes Englisch und meinten, dass der Museumsdirektor um die Ecke wohnte. Sie boten an, ihn zu holen und bald hastete er herbei.
“Ich hatte um diese Jahreszeit noch gar keine Touristen erwartet,” entschuldigte sich der Museumsdirektor. Die flexiblen Regeln gefielen mir. Wenn in England ein Museum geschlossen war, war es eben geschlossen und Schluss
“Schau dir das an, Tony.“
Ich war von den Khoi San Schnitzereien in der winzigen Eingangshalle fasziniert. Ein hölzernes Brettchen mit flachgeklopften Nägeln auf denen man mit dem Daumen spielen konnte, lag auf einem Podest.
“Das ist ein Buschmannklavier,” erklärte uns der Museumsdirektor. “Alles hier wird von Buschmännern aus der Kalahari Wüste handgearbeitet.”
Buschmänner. Ich hatte etwas über Buschmänner gelesen.
Der Mann war noch ganz außer Atem und bezog Stellung hinter der Theke. Von hier aus nahm er zwei Pula Eintritt pro Person entgegen. Eine Gruppe Amerikaner hatten sich ebenfalls zum Museum verirrt und stellten sich hinter uns an.
“Toll Mann, es gibt hier mitten in der Wüste ‘n Museum, hey Bob?”
“Yeah, kann man die Figur da kaufen? Brauche noch’n Mitbringsel für Meg.”
Nachdem wir uns die spärliche Ausstellung von Hütten, Kochgeschirr aus Ton und geflochtenem Gras angesehen hatten, erzählte uns der Museumsdirektor alles was man über die Bierzubereitung der Tswanas wissen musste. Die Amerikaner uuhten und aahten und fotografierten andauernd.
“Bier - genau’s richtige für mich, hey Bob?”
Als Nächstes gingen wir in ein bunt bemaltes Restaurant an Serowes staubiger Hauptstraße. Der Besitzer des Lokals waren ein verschwitzter Schotte und seine dicke Tswana-Frau. Es gab einen einfachen aber herzhaften Fleischeintopf mit Samp, einen groben Brei aus ganzen weißen Maiskörnern. Es schmeckte erstaunlich gut.
Wir saßen oben, direkt am großen Glasfenster. Von hier aus hatte man die beste Aussicht auf Serowe. Man sah eine Unmenge kleiner Häuser, die grün oder pink angemalt waren. Karren wurden von Eseln im Schneckentempo durch den hupenden Verkehr gezogen.
Babys machten die Reise durch das Verkehrschaos in großen Handtücher auf den Rücken ihrer Mütter gebunden.
Wie Serowe hatte ich mir Afrika auch nicht gerade vorgestellt. Wie sah es wohl in Bobonong aus, und im Tuli Block? Ich durfte mich nicht zu sehr von meinem Ziel in Botswana ablenken lassen!
Aber ich ließ mich ablenken.
Tony und ich wurden zu Barbecues eingeladen, die hier Braais hießen Unsere Gastgeber waren meist gesellige Südafrikaner, die an der Mine in Selebi Phikwe arbeiteten. Ein amerikanischer Lehrer, der in einem Hippiehaus, weit ab von der Hauptstraße in den Hügeln wohnte, war der bemerkenswerteste Gastgeber.
Jeder dachte natürlich ich sei Tonys Freundin und zog uns unbarmherzig wegen unseres unverheirateten Daseins auf.
In diesen engen Kreisen waren Frauen entweder verheiratet oder verlobt. Nicht die Zwillingsschwestern von verschwundenen Freundinnen. Wir sagten wenig und lächelten. Menschen im südlichen Afrika - schwarz oder andersfarbig - waren recht gastfreundlich. Sie waren auch recht religiös, im christlichen Sinne des Wortes.
Am Wochenende konnte man Tswanas in langen Gewändern und ‘Kirchenuniformen’ daher schreiten sehen. Sie versammelten sich im Schatten ausladender Bäume, wo gesungen und getrommelt wurde.
Violett war die Farbe der Katholiken, und grün und weiß für die Anhänger der apostolischen Kirche reserviert. Frauen in hellroter Kleidung versammelten sich oft in Gruppen an den Bushaltestellen, aber ich fand nie heraus welcher Religion sie nun eigentlich angehörten. Einige weiße Frauen trugen auf dem Weg zur Kirche Spitzendeckchen auf dem Kopf. Erstaunlich.
Der Spätfrühling ging in den Frühsommer über und ich stellte fest, wie schmerzhaft es sein konnte tagsüber keinen Sonnenschutz und Hut zu tragen.
Nach einem Ausflug in eine verlassene Siedlung der McAlpine Company in den Hügeln westlich von Palapye, nahmen meine Arme eine tomatenrote Farbe an. Hals und Gesicht sahen auch nicht besser aus, und es dauerte ein paar Tage bis meine Haut aufhörte sich zu schälen. Eine schmerzhafte Lektion.
Die Zeit verging und ich fragte mich, ob es eine gute Idee war, meine Identität zu verbergen. Vielleicht hatte ja jemand Informationen über Claire, die mich weiterbrachten. Aber es war zu spät um meine Story zu ändern. Es musste einen anderen Weg geben.
Ich sollte allerdings bald Kontakt mit Gaborone aufnehmen. Mit der zentralen Polizeistelle dort und der britischen High Commission. Aber die Verständigung mit Gaborone war nach wie vor schwierig.
Mr. Poppelmeyer ließ über das Telefon im Berufszentrum einfach keine Privatgespräche zu. Ich schaffte es einmal die British High Commission vom Botsalo Hotel aus anzurufen.
Nach fünf Minuten Greensleeves gab ich auf. Dazu kam noch, dass sich Einzelheiten nicht besprechen ließen, ohne dass jemand mithörte. Mir blieb nichts anderes übrig als zu warten bis Tony dazu bereit war nach Gaborone zu fahren.
Ich musste nicht lange warten. Am folgenden Wochenende entschloss Tony sich einen Tagesausflug nach Gaborone zu unternehmen. Endlich!
Gabs wäre in England als Kleinstadt durchgegangen. Aber es hatte die Aufmachung und die vornehme Haltung einer Hauptstadt. Der Verkehr floss gemächlich dahin. Die Straßen waren zwar staubig, aber breit und geteert. Es gab ab und zu eine Ampel und sogar den gelegentlichen Kreisverkehr.
Wir tourten durch die Stadt und ich bekam eindrucksvolle Häuser mit üppigen Palmengärten zu sehen.
Bougainvillea Büsche mit massenhaft pinken, lila und roten Blüten ergossen sich über Gartenmauern und kletterten in würdevolle blau-blühende Jacaranda Bäume. Ich war von der Schönheit Gaborones wie berauscht. Viele der Pflanzen kannte ich nur von englischen Blumentöpfen her und hier wuchsen sie draußen an der frischen Luft.
Im Stadtzentrum lag die Shoppingmeile, einfallsreich auch ‘Die Europäische Mall’ genannt. Mit unserer Mall in Palapye hatte sie aber wenig gemein. Diese ‘Mall’ erstreckte sich von einem Denkmal im Osten bis zu den Verwaltungsgebäuden im Westen.
Es gab Banken, einen Buchladen, einen Supermarkt, ein Kino, ein paar Kleidergeschäfte, eine Eisenwarenhandlung und einen Souvenirladen. Büros und Konsulate vervollständigten das Bild. Die britische High Commission lag nur über die Straße. Kleinere Malls waren in Gaborone hier und da auch vorhanden, aber das Stadtleben fand zweifellos in der ‘Mall’ statt.
Claire ist hier entlanggelaufen, dachte ich wehmütig. Sie hatte sicher in einem dieser Geschäfte ihr warmes Bettzeug gekauft.
Etwa in der Mitte der ‘Mall’ überblickte das mehrstöckige ‘President Hotel’ gelassen die geschäftige Fußgängerzone. Breite Treppen führten zum gut besuchten Restaurant auf der schattigen Terrasse hinauf. Die belebte Mall kam meiner Vorstellung von einem afrikanischen Markt schon etwas näher. Der Buchladen war erstaunlich gut bestückt. Ich erstand günstig zwei Jane Austen Klassiker. Es gab sogar eine Kopie von Grandpas frühem Werk ‘El Jadida’ auf dem Regal für Historische Belletristik und ich kaufte die Kopie.
Auf dem Weg nach draußen, stieß ich mit einem beleibten Herrn in hellblauem Safarianzug zusammen. Es war zwar meine Schuld gewesen, aber der Mann entschuldigte sich trotzdem. Wie höflich. “Ah sorry, no Matata”, sagte er. Das bedeutet soviel wie ‘kein Problem’. Das Wort sorry ließ sich vielfältig einsetzen.
Im Corners Supermarket rollte mein Einkaufswagen aus Versehen in einen gepolsterten Hintern und die Antwort auf meine gestammelte Entschuldigung war ‘Ah sorry, Madam, no matata.’
Leute auf der Straße zu grüßen war ein wichtiger Bestandteil der Tswana-Etiquette. Und selbst in der Hauptstadt durfte man nicht einfach unhöflich vorbeigehen.
Ich grüßte wohlerzogen zwei ältere Damen, die in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarkts neugierig Blickkontakt gemacht hatten. Das Signal zu grüßen!
“Dumelang, bo-mma.”
“Dumela, mma.” Die Matronen nickten zufrieden und gingen weiter.
Ich hätte gerne mit Claires früheren Kollegen oder der High Commission Kontakt aufgenommen. Aber es war Wochenende und für Tony stand der Einkauf notwendiger Dinge im Vordergrund. Zum Abschluss gab es noch ein Mittagessen etwas abseits der ‘Mall’, im Gaborone Sun Hotel. Dann ging es auch schon wieder nach Palapye zurück.
Ich traute meinen Augen kaum, als direkt vor uns eine Kuhherde im Stadtverkehr durch die Straßen getrieben wurde. Tony meinte, sie seien wahrscheinlich auf dem Weg zum Schlachthaus in Lobatse.
“Wo hast du eigentlich mit Claire gewohnt, hier in Gabs?” fragte ich Tony auf einmal.” Wo steht das Firmenwohnhaus?”
“Oh irgendwo da drüben —” er winkte mit seiner Hand ohne hinzusehen.
“Ich würde mir das gerne ansehen. Können wir nicht schnell mal vorbeifahren?” Wahrscheinlich dachte ich, dass ich dort Claires Spur aufnehmen oder so eine Art Geistesblitz haben würde.
“Lieber nicht. Nächstes Mal vielleicht,” murmelte er.
Ich wusste, dass Tony den anderen Ausländern noch aus dem Weg ging. Das Verschwinden meiner Schwester hatte in diesen Kreisen einen mittleren Skandal verursacht. Außerdem ging er allem aus dem Weg, das mit Claire zu tun hatte.
“Was mache ich bloß?” jammerte ich, als wir im Verkehr warteten. “Ich komme überhaupt nicht voran mit meiner Suche.”
“Du kannst ja mal allein nach Gabs kommen und für ein paar Tage bei Uli Winckler und seiner Familie übernachten,” schlug Tony vor.
Wir sahen das Hinterteil der letzten Kuh hinter ein paar Bäumen verschwinden und fuhren weiter.
“Uli ist ein hohes Tier am Automotive College und seine Frau Rita ist unheimlich nett. Die beiden haben sicher nichts dagegen, wenn du bei ihnen wohnst. Nächste Woche kannst du mit einem der Minenleute nach Gabs mitfahren. Ich hol’ dich dann am Wochenende wieder ab. Das heißt, wenn Poppelmeyer mich nicht braucht.”
Das hörte sich ganz so an, als wolle Tony mich loswerden.
“Was, und einen neuen Heiratsantrag riskieren?”
“Ja —” Tony lachte kurz auf.
“Was ist denn mit dir, willst du nicht auch mitkommen?”
Wir hielten an einer Ampel an.
“Ich, Ich kann nicht…nicht…noch nicht,” stotterte er auf einmal.
“Was ist, wenn ich was wichtiges über Claire herausfinde?” Ich ließ nicht locker. Irgendwann mussten wir ja schließlich darüber reden.
“Ich muss arbeiten und kann damit jetzt einfach noch nicht umgehen, okay?”
Ich hatte es satt das zu hören, aber was sollte ich tun? Ich wollte mich nicht streiten. Ohne Tony war ich aufgeschmissen.
“Wir müssen doch endlich mal darüber reden, Tony.”
Wir waren auf der Hauptstraße.
“Ich weiß Aber nicht gerade jetzt.” Oh, es war zum Auswachsen mit ihm!
“Okay, dann geh’ ich eben. Was ist mit Montag?” drängte ich. Wozu noch warten?
“Ich ruf’ die Wincklers am Montag an,” versprach Tony.
Aber daraus wurde nichts. Am Montag hatte sich die Englischlehrerin immer noch nicht eingefunden. Sie wohnte in einem Dorf im Okavango Delta. Ohne Telefon.
Tony war ihr direkter Vorgesetzter. Er konnte nicht länger warten und flehte mich geradezu an, ihre Klassen zu übernehmen. Das letzte Semester des Jahres war schrecklich wichtig und Abschlussprüfungen standen an.
“Wir brauchen dringend eine Vertretung,” sagte er.
“Was ist wenn diese Lehrerin auch verschwunden ist?” fragte ich ängstlich. Wer weiß, was da draußen im Busch alles passieren konnte.
“Wohl kaum. Wahrscheinlich musste sie zu irgendeinem Begräbnis oder zu einer Hochzeit gehen. Vielleicht hat sie auch einfach keine Lust mehr hier zu arbeiten. Zeit hat hier in Botswana eine ganz andere Bedeutung, weißt du.”
“Das habe ich schon gemerkt, das mit der Zeit. Aber was ist mit den Studenten, interessiert die Lehrerin das denn gar nicht?”
Tony zuckte nur mit den Schultern. “Wer weiß, was sie sich dabei denkt. Hier kommt nichts gegen eine ordentliche Beerdigung an. Wahrscheinlich taucht sie irgendwann vor den Examen wieder auf.”
“Aber Tony, Ich hab’ doch noch nie unterrichtet. Noch niemanden,” stöhnte ich.
“Macht nichts. Du hast eine Sprachausbildung. Das reicht hier als Qualifikation vollkommen aus.”
“Ich weiß nicht so recht — ”
“Bitte spring’ ein, bitte,” bettelte er.
Was blieb mir da anderes übrig? Ich konnte Tony nicht im Stich lassen.
Oh well, no matata. Mein Besuch bei den Wincklers in Gaborone musste eben aufgeschoben werden. Stattdessen bereitete ich meinen Lehrplan vor. Ich konnte nur hoffen, dass ich mich nicht zum kompletten Idioten machte.
Ein paar Nächte vor der ersten Unterrichtsstunde wachte ich plötzlich auf und musste mich überall kratzen. Ich tastete mich an den Wecker. 1:34 Uhr. Autsch!
Ich sprang wie von Furien gejagt aus dem Bett und schaltete die Nachttischlampe an.
Eine wahre Armee roter Ameisen marschierte schnurgerade die Mitte meiner Matratze entlang und auf dem Boden hinunter. Und sie waren überall auf mir!
Ich riss mir den Pyjama runter und wischte verzweifelt an Armen und Beinen. Die grässlichen kleinen Feuerameisen bissen unerbittlich.
Mutig schälte ich das Bettzeug ab und schmiss alles in die Badewanne. Dann bombardierte ich die Viecher mit Wasser - Ameisen hassten Wasser - und stellte mich selbst unter die Dusche. Was war nur mit dem Wasser los, konnte das nicht schneller laufen?
Ich sah zufrieden wie die letzten rot-braunen Teufelchen mit dem Seifenschaum im gurgelnden Abfluss verschwanden. Meine Haut juckte zwar immer noch, aber ich konnte jetzt wenigstens einen neuen Pyjama anziehen.
Insektenspray musste her! Die knallgelbe Sprühdose mit ‘Sofort Tot’ stand auf dem Kühlschrank, wo Tony auch die grünen Spiralen aufbewahrte, die gegen Moskitos nachts abgebrannt wurden.
Ich nahm das Spray an mich und rannte ins Zimmer zurück, obwohl ich alles hasste, was mit Gift zu tun hatte. Das hier war eine Notsituation. Ich schob das Bett von der Wand weg und sah wie die Ameisen durch ein Loch in der Wand direkt über der Fußleiste krabbelten.
Tonys verschlafenes Gesicht erschien im Türrahmen. Der Tumult hatte sogar ein Murmeltier wie ihn geweckt. Na wunderbar, er konnte mir dabei helfen die Ameisen loszuwerden!
“Was machst du’n da?” fragte er und gähnte ausgiebig.
“Rote Ameisen!” Ich klang hysterisch. “In meinem Bett, überall.” Ich konnte noch immer die brennenden Bisse am ganzen Körper spüren.
Tony gähnte. “Oh sorry. Spray is’ auf’m Kühlschrank.” Damit drehte er sich um und taumelte in sein Zimmer zurück.
“Na vielen Dank auch,” sagte ich als seine Tür hinter ihm ins Schloss fiel. “Für gar nichts”.
Ich besprühte die Fußleiste ausgiebig mit ‘Sofort Tot’. Der Geruch allein war genug um totumzufallen. Ich öffnete das Fenster und zog ins Gästezimmer um.
Zum Glück waren es nur rote Ameisen gewesen und nicht etwa eine große Spinne, ein Skorpion oder eine Schlange. Meine Vorstellung von Normalität war schon lange ins Wanken geraten.
Während meiner fast insektenfreien Existenz in Cambridge hätte ich beim bloßen Anblick einer winzigen Spinne im Badezimmer einen Herzanfall bekommen.
Ich vergaß die Ameisen, die Schlangen und Skorpione und schlief wieder ein - und erwachte an einem neuen afrikanischen Morgen wie gehabt zu Hahnengekrähe und Eselsgeschrei.
Ein glühend heißer Tag kündigte sich an.
Ich sprang aus dem Bett, um das beste aus den kühleren Morgenstunden zu machen.
Bald summte Tonys Wordprocessor und druckte fleißig ein Arbeitsblatt nach dem anderen aus.
Da waren noch stapelweise Dokumente durchzugehen und der erste Unterrichtstag rückte unaufhaltsam näher.