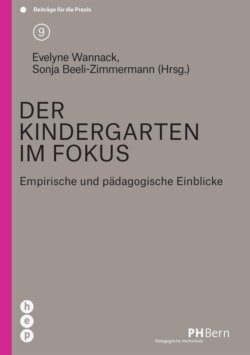Читать книгу Der Kindergarten im Fokus (E-Book) - Evelyne Wannack - Страница 6
Оглавление3Die Studie in Kürze
Evelyne Wannack, Sonja Beeli-Zimmermann
Die empirischen Erkenntnisinteressen der Studie zur Situation des Kindergartens im Kanton Zürich konzentrierten sich auf drei Themenbereiche:
—die Unterrichtsgestaltung,
—den Kompetenzerwerb bei Kindern,
—die Übergänge in den Kindergarten und in die Primarschule.
Die leitenden Fragestellungen werden jeweils zu Beginn der entsprechenden Kapitel aufgeführt.
3.1Untersuchungsdesign
Auf der Grundlage des Rahmenkonzepts und der Erkenntnisinteressen (vgl. Kapitel 2) wurde ein multimethodisches Untersuchungsdesign entworfen, das verschiedene Teilprojekte beinhaltet. Abbildung 3.1 zeigt auf, welche Erhebungsmethoden in den einzelnen Teilprojekten zur Anwendung kamen und in welchem Zeitraum die Erhebungen stattfanden.
Wie aus Abbildung 3.1 ersichtlich ist, wurden im Rahmen der Studie vier Teilprojekte mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt. Die Kindergartenlehrpersonen sowie die Klassen wurden ausschliesslich im Rahmen der ersten Erhebungswelle untersucht. Bei den Kindern und ihren Eltern wurden die Daten in zwei Wellen erhoben: Im Rahmen der ersten Erhebungswelle standen alle Eltern sowie die Kinder des zweiten Kindergartenjahres im Zentrum, also diejenigen, die kurz vor dem Übertritt in die Schule standen. Im Rahmen der zweiten Erhebungswelle wurden Kinder und ihre Eltern fokussiert, die soeben in den Kindergarten eingetreten waren.
Im Verlauf der empirischen Studie ergab sich aus ersten Ergebnissen der Bedarf, bestimmte Themen umfassender zu erheben. Aus diesem Grund initiierte die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine quantitative Befragung der Kindergartenlehrpersonen (vgl. Abbildung 3.1). Diese wurde von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich inhaltlich verantwortet und vom Forschungs- und Beratungsunternehmen INFRAS technisch umgesetzt. Die quantitative Befragung fand rund ein Jahr nach den qualitativen Interviews statt (vgl. dazu Imlig, Bayard & Mangold 2019).
Abbildung 3.1: Untersuchungsdesign (in Anlehnung an Edelmann, Wannack & Schneider 2018a, S. 34)
Nachfolgend werden die Stichproben und die einzelnen Erhebungen ausführlicher dargestellt.
3.2Stichprobe
Die Bestimmung der Stichprobe, die 20 Kindergärten im Kanton Zürich umfassen sollte, folgte dem Vorgehen der gezielten Stichprobenziehung gemäss Patton (1990). Damit verbunden war die Absicht, innerhalb der angestrebten Gruppe eine maximale Varianz zu erreichen. Daher sollten sich in der Stichprobe möglichst heterogene und in Bezug auf spezifische Merkmale kontrastierende Fälle befinden, sodass die Vielfalt der Kindergärten im Kanton Zürich entsprechend erfasst werden kann. Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der Bildungsdirektion wurden die folgenden drei Merkmale bestimmt:
Gemeindetyp: Das Bundesamt für Statistik (www.bfs.admin.ch) stellt eine Gemeindetypologie zur Verfügung, die wie folgt adaptiert wurde: (1) Zentrumsgemeinden (zentrale regionale Funktion in kultureller und ökonomischer Hinsicht), (2) Arbeitsplatzgemeinden (hoher Anteil Erwerbstätige von auswärts), (3) suburbane Wohngemeinden (dichte Besiedelung, hoher Wohnanteil), (4) periurbane Wohngemeinden (lockere Besiedelung, Wohnfunktion), (5) reiche Gemeinden (wohlhabende Steuerpflichtige, grosses Gemeindebudget), (6) ländliche Gemeinden (mindestens 13 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft) und (7) gemischte Gemeinden (unterschiedlich strukturiert, keine eindeutige Zuordnung möglich). Wie der Tabelle 3.1 zu entnehmen ist, wurden die Gemeindetypen 3 und 4 sowie 6 und 7 zusammengefasst.
Mischindex: Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich berechnet den Mischindex aus dem Anteil der Schülerinnen und Schüler ausländischer Nationalität (Deutschland, Österreich und Liechtenstein sind davon ausgenommen) sowie dem Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Erstsprache. Der Mischindex reicht von 0.0 bis 0.9. Für die Studie wurde der Mischindex in vier Kategorien eingeteilt und zwar von 0 bis < 0.2, 0.2 bis < 0.4, 0.4 bis < 0.6 und > 0.6.
Dienstalter der Kindergartenlehrpersonen: Die Studie wurde bewusst mit berufserfahrenen Kindergartenlehrpersonen durchgeführt. Gemäss berufsbiografischen Ansätzen (z.B. Keller-Schneider 2010) gelten Lehrpersonen ab 5 Jahren als berufserfahren, was zur Definition von drei Kategorien führte. Kategorie 1 (K1) umfasst Kindergartenlehrpersonen mit 6 bis 9 Jahren, Kategorie 2 (K2) Kindergartenlehrpersonen mit 10 bis 19 Jahren und Kategorie 3 (K3) Kindergartenlehrpersonen mit mehr als 20 Dienstjahren.
Tabelle 3.1: Angestrebter Stichprobenplan Klassen nach Mischindex, Gemeindetyp und Dienstalterskategorie (Edelmann, Wannack & Schneider 2018a, S. 37)
Von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wurden dem Forschungsteam die entsprechenden Daten für das Schuljahr 2016/17 zur Verfügung gestellt. Auf dieser Datengrundlage wurde die Stichprobe rekrutiert. Kompromisse mussten hinsichtlich der Mischindizes in Gemeindetyp 5 eingegangen werden, da für diesen Typ lediglich Klassen mit Mischindizes > 0.4 vorhanden waren sowie der Berufserfahrung der Kindergartenlehrpersonen, die im Vergleich zur gesamten Gruppe überdurchschnittlich hoch war. Insgesamt wurde die angestrebte Breite an kontrastierenden Fällen und somit eine Repräsentanz in Bezug auf maximale Varianz erreicht. Nachfolgend findet sich die Beschreibung der Stichprobe anhand der Kindergärten und Kindergartenklassen, der Kindergartenlehrpersonen, der Kindergartenkinder sowie der Eltern der Kindergartenkinder. Da die Beschreibung der Stichproben knapp ausfällt, finden Interessierte die ausführliche Dokumentation in Edelmann, Wannack und Schneider (2018b).
Kindergärten: Die Stichprobe umfasste sieben Einzel-und dreizehn Doppelkindergärten. Von den sieben Einzelkindergärten befanden sich drei auf einem Schulgelände. Zwei der übrigen vier Einzelkindergärten waren in Wohnungen untergebracht. Die anderen zwei Einzelkindergärten standen als Einzelbauten im Dorf oder Quartier. Sechs der Doppelkindergärten waren auf einem Schulgelände, und sieben Doppelkindergärten befanden sich als Einzelbauten im Dorf oder Quartier, wobei einer dieser Doppelkindergärten ebenfalls in einem Wohnhaus angesiedelt war.
Kindergartenklassen: Beschrieben werden die Kindergartenklassen anhand ihrer Klassengrösse, der Zusammensetzung hinsichtlich des ersten und zweiten Kindergartenjahres sowie der Anzahl Kinder, die Anspruch auf Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) haben. Aus Tabelle 3.2 ebenfalls ersichtlich ist die Zugehörigkeit zum Gemeindetyp sowie der Mischindex. Die durchschnittliche Klassengrösse betrug 21 Kinder, wobei eine Klasse lediglich 14 Kinder (Minimum) und vier Klassen 24 Kinder (Maximum) umfassten. In zehn Klassen war der Anteil der Kinder im zweiten Kindergartenjahr grösser als der Anteil der Kinder im ersten Kindergartenjahr. Erwartungsgemäss fanden sich in Klassen mit einem Mischindex A (< 0.4) weniger Kinder mit Anspruch auf DaZ als in Klassen mit einem Mischindex B (> 0.4).
Kindergartenlehrpersonen: Das Alter der Kindergartenlehrpersonen bewegte sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung zwischen 29 und 61 Jahren bei einem durchschnittlichen Wert von 48 Jahren. Es handelte sich dabei ausschliesslich um Frauen. 3 Kindergartenlehrpersonen verfügten über einen Bachelor-Abschluss einer Pädagogischen Hochschule, 17 Kindergartenlehrpersonen wiesen eine seminaristische Ausbildung auf; 11 der 20 Kindergartenlehrpersonen verfügten über eine Weiterbildung auf Niveau Certificate of Advanced Studies oder Master of Advanced Studies; 13 Kindergartenlehrpersonen arbeiteten Vollzeit und 7 Teilzeit (≥ 50 %) im Kindergarten.
Tabelle 3.2: Stichprobe der Kindergärten im Frühling 2017 (Edelmann, Wannack & Schneider 2018a, S. 40)
Kindergartenkinder: Im Frühling 2017 befanden sich 217 Kinder im zweiten Kindergartenjahr, im Herbst 2017 waren 180 Kinder im ersten Kindergartenjahr. In diesen zwei Gruppen wurden zu den angegebenen Zeitpunkten die sprachlichen Kompetenzen1 sowie die Exekutiven Funktionen erfasst. Diese Ausgangsstichprobe von insgesamt 397 Kindern verringerte sich für die in diesem Band dargestellten Resultate, weil einerseits bei 41 Kindern die Eltern ihre Zustimmung zur Erfassung des Sprachstands respektive der Exekutiven Funktionen nicht gegeben hatten, und andererseits, weil an den Erhebungstagen einzelne Kinder nicht anwesend waren. Von der Erhebung der Exekutiven Funktionen wurden 19 Kinder des ersten Kindergartenjahres aufgrund ihrer geringen Deutschkenntnisse ausgeschlossen. Grundlage dafür war das Abschneiden im Sprachtest. Insgesamt konnten Daten von 133 Kindern aus dem ersten Kindergartenjahr und von 193 Kindern aus dem zweiten Kindergartenjahr für die Analyse verwendet werden. Die Gruppe der Kinder im ersten Kindergartenjahr setzte sich aus 67 Jungen und 66 Mädchen zusammen. Ihr Durchschnittsalter betrug 4.74 Jahre. Im zweiten Kindergartenjahr befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung 103 Jungen und 90 Mädchen mit einem Durchschnittsalter von 6.59 Jahren.
Eltern: Die Fragebogenerhebung im Frühling 2017 richtete sich an alle Eltern, jene im Herbst 2017 ausschliesslich an diejenigen, deren Kind neu in den Kindergarten eingetreten war. Insgesamt gingen von 600 verteilten Fragenbogen 504 Fragebogen ein. Hinsichtlich der Familienformen zeigte sich, dass 91.2 Prozent der Kinder mit beiden Eltern in einem Haushalt aufwuchsen; 6.2 Prozent der Kinder lebten mit einem Elternteil zusammen; 2.4 Prozent der Kinder lebten bei beiden Eltern in jeweils getrennten Haushalten und 0.2 Prozent der Kinder wuchsen bei einer anderen Person als den Eltern auf. 84.4 Prozent der Kinder hatten Geschwister. 54.5 Prozent der Väter und 50.3 Prozent der Mütter wurden in der Schweiz geboren. Die im Ausland geborenen Eltern waren im Durchschnitt seit rund vierzehn Jahren in der Schweiz. Des Weiteren gaben 40.1 Prozent der Eltern an, mit dem Kind zu Hause ausschliesslich Deutsch zu sprechen, bei den anderen 59.9 Prozent kommt mindestens eine weitere Sprache hinzu. Am häufigsten wiesen die Eltern einen tertiären Bildungsabschluss (Berufs-, höhere Fachprüfung, Bachelor, Master etc.) auf, gefolgt von Abschlüssen auf der Sekundarstufe II wie etwa einer Berufslehre, Fachmaturität, Berufs- oder gymnasialer Maturität. Unter 10 Prozent belief sich der Anteil an Vätern und Müttern, die einen Abschluss auf Sekundarstufe I aufwiesen. Wie beschrieben, wurden die Kindergärten mit dem Ziel der maximalen Varianz ausgewählt. Trotz diesem Vorgehen zeigte sich, dass die Zusammensetzung der Teilstichproben Kinder und Eltern als repräsentativ bezeichnet werden darf.
3.3Erhebungen
Die Studie weist vier Teilprojekte mit je eigenen Erhebungsmethoden auf (vgl. Abbildung 3.1). In den folgenden Abschnitten werden die Teilprojekte in derselben Reihenfolge, wie sie in Abbildung 3.1 dargestellt sind, kurz beschrieben. Ausführlichere Informationen sind in den entsprechenden Kapiteln in diesem Band zu finden.
Videobasierte Unterrichtsbeobachtung in den Kindergärten
Um den Unterricht zu erfassen, wurden die Kindergartenlehrpersonen gebeten, einen ihrer Auffassung nach «typischen Kindergartenmorgen» zu gestalten. Dieser wurde mit jeweils zwei Kameras pro Klasse gefilmt. Die Filmaufnahmen begannen beim Eintreffen des ersten Kindes und endeten, als das letzte Kind den Kindergarten verliess. Eine Kamera war während des gesamten Morgens auf die Kindergartenlehrperson gerichtet. Damit die Gespräche deutlich zu hören waren, wurde die Kindergartenlehrperson mit einem Funkmikrofon ausgerüstet. Mit der Klassenkamera wurde angestrebt, das gesamte Klassengeschehen zu erfassen. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten wie beispielsweise verschiedener Raumnischen, Garderoben oder Aussenbereiche, die für Kindergärten kennzeichnend sind, stellte dies eine Herausforderung dar. Während der Filmaufnahmen führte eine Projektmitarbeitende ein Verlaufsprotokoll, in dem die Anzahl der anwesenden Kinder und Erwachsenen, besondere Vorkommnisse sowie der grobe Ablauf des Morgens notiert wurden.
Speziell beachtet wurde der Umgang mit Kindern, deren Eltern der Aufnahme der Kinder nicht zugestimmt hatten. Je nach Kindergarten wurden dafür verschiedene Lösungen gefunden. So etwa, dass diese Kinder den Morgen im benachbarten Kindergarten verbrachten oder sie mit einem Tuch gekennzeichnet waren, damit die Kameras entsprechend geschwenkt werden konnten.
Die Aufnahmen in den Kindergärten dauerten zwischen 3 Stunden 43 Minuten und 4 Stunden 2 Minuten. Gesamthaft resultierte 77.5 Stunden Filmmaterial, das für die Analyse in die Software Transana (Woods & Dempster 2011) eingelesen wurde. In einem ersten Durchgang wurde eine sogenannte Segmentierungsanalyse (Dinkelaker & Herrle 2009) vorgenommen, mit der die Aufnahmen in Segmente mit möglichst unterschiedlichen Merkmalen unterteilt wurden. Dieses Vorgehen erlaubte es, einen Überblick über den Unterrichtsverlauf zu gewinnen. In einem nächsten Schritt konnten die definierten Segmente in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse mittels Extraktion (Schreier 2014) vertieft bearbeitet werden. Sämtliche Unterlagen zur videobasierten Unterrichtsbeobachtung sind in Edelmann, Wannack und Schneider (2018b) dokumentiert.
Analyse von Sprachhandlungen in ausgewählten Videosequenzen
Für die Analyse der Sprachhandlungen der Kindergartenlehrpersonen wurden je Kindergarten Videoausschnitte von 30 Minuten zusammengestellt. Referenzpunkt war die erste Sequenz mit einem Unterrichtsgespräch mit der ganzen Klasse im Sitzkreis. Es wurden jeweils 15 Minuten vor dieser Plenumssequenz sowie die ersten 15 Minuten der betreffenden Plenumssequenz herausgeschnitten. Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse von Videomaterial (vgl. Mayring, Gläser-Zikuda & Ziegelbauer 2005) wurden die Interaktionen zwischen Kindergartenlehrperson und Kindern mithilfe der Kategorien «Art der Frage», «Sprachhandlungsanregung», «Gesprächsorganisation», «Handlungsorganisation» sowie «Sprachhandlungen der Kindergartenlehrperson» ausgewertet. Dazu wurden die Videoausschnitte in die Software ELAN eingelesen und codiert, was nebst der inhaltlichen Analyse auch erlaubte, die Dauer je Sprachhandlung zu erfassen (vgl. dazu auch Edelmann, Wannack & Schneider 2018a; 2018b).
Problemzentrierte Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen
Die Methode des problemzentrierten Interviews (Witzel 1985; 2000) eignet sich in besonderem Masse für die leitfadengestützten Gespräche mit den Kindergartenlehrpersonen, da diese aufgrund der Offenheit der Methode ihre Perspektiven als Expertinnen ihres Berufsfelds umfassend einbringen konnten. Das Interview fand in der Regel in den Kindergärten statt und wurde mit einem digitalen Voicerecorder aufgezeichnet. Die 20 Interviews, die mehrheitlich in Mundart geführt wurden, dauerten zwischen 105 Minuten und 170 Minuten. Im Rahmen der vollständigen Transkription wurden die Ausführungen in Standardsprache im Sinne einer «literarischen Umschrift» (Mayring 2002) übertragen. Wegleitend waren die Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz, Dresing, Rädiker et al. (2008). Anschliessend wurden die Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die Kodierung erfolgte mithilfe der Software MAXQDA entlang den Themen des Interviewleitfadens. Zusätzlich zu den aus den theoretischen Grundlagen deduktiv abgeleiteten Kategorien erarbeitete das Forschungsteam für die von den Kindergartenlehrpersonen individuell eingebrachten Themen induktive, aus dem Material gewonnene Kategorien und Unterkategorien. Sowohl der Interview- als auch der Kodierleitfaden sind in Edelmann, Wannack und Schneider (2018b) zu finden.
Quantitative Befragung der Kindergartenlehrpersonen
Aufgrund der Erkenntnisse aus den problemzentrierten Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen entschied sich das Projektteam der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, eine Online-Befragung aller Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich mittels Fragebogen durchzuführen. Dieser bestand aus geschlossenen Fragen, die auf einer vierstufigen Antwortskala hinsichtlich ihrer Zustimmung respektive Ablehnung von den Kindergartenlehrpersonen eingeschätzt wurden. Insgesamt wurden 2227 unbefristet angestellte Kindergartenlehrpersonen an öffentlichen Kindergärten des Kantons Zürich angeschrieben. Der Rücklauf belief sich auf 66 Prozent. Der Fragebogen umfasste die Themenbereiche «Kindergartensituation», «Lehr-/Lernverständnis», «Bedeutung des Spiels», «Sprache und Sprachförderung», «Eintritt in den Kindergarten», «Zusammenarbeit im Kindergartenalltag», «persönliche Angaben» sowie «Potenziale und Herausforderungen». Die statistischen Auswertungen der Fragebogen erfolgten mit nonparametrischen Verfahren (vgl. Imlig, Bayard & Mangold 2019).
Erfassung der Exekutiven Funktionen der Kinder
Unter Exekutiven Funktionen werden kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse verstanden. Für die Erhebungen der Exekutiven Funktionen bei den Kindern wurde das Erhebungsinstrument «Minnesota Executive Function Scale» (MEFS) eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes und validiertes Verfahren, das am Institute of Child Development an der University of Minnesota entwickelt wurde (Carlson 2017). Es wird zur Messung der Exekutiven Funktionen bei Kindern zwischen zwei und dreizehn Jahren eingesetzt und umfasst sieben Niveaus, deren Schwierigkeitsgrade zunehmen. Die verschiedenen Zuordnungsaufgaben (Farben, Grössen und Formen) wurden den Kindern mittels App auf einem Tablet (iPad) gestellt, wobei das Einstiegsniveau abhängig vom Alter des Kindes gewählt worden war. Jedem Kind wurde einzeln erklärt, wie die Aufgaben funktionieren und wie es die App bedienen kann. Die Einzelerhebung dauerte fünf bis sieben Minuten. Um das Erhebungsinstrument zu nutzen, mussten sich die Untersuchungsleiterinnen zertifizieren lassen. Für die vorliegende Studie wurde die deutschsprachige Version verwendet, die im Rahmen einer Deutschschweizer Interventionsstudie (Röthlisberger, Neuenschwander, Cimeli et al. 2012) erprobt worden war.
Quantitative Befragung der Eltern
Der Elternfragebogen erfasste soziodemografische Angaben der Familien der Kindergartenkinder sowie Informationen aus Sicht der Eltern zu den folgenden Themenbereichen: dem Entwicklungsstand ihrer Kinder, dem Verlauf des Übergangs in den Kindergarten und in die Primarschule sowie der Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson. So weit als möglich wurden validierte Frageskalen eingesetzt, die den lokalen Bedingungen entsprechend angepasst wurden. Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass es den Eltern möglich sein sollte, ihn in zwanzig bis dreissig Minuten auszufüllen. Der Fragebogen wurde nebst Deutsch in elf weiteren Sprachen (Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Tamilisch, Tigrinisch und Türkisch) erstellt. Diese Sprachen werden im Kanton Zürich von den Eltern am häufigsten gesprochen. Die Eltern erhielten den Fragebogen von der Kindergartenlehrperson, die ihn den Kindern nach Hause mitgab. Die Eltern retournierten den ausgefüllten Fragebogen in einem geschlossenen Couvert an die Kindergartenlehrperson. Alle Eltern hatten die Möglichkeit, bei Fragen oder Bemerkungen das Forschungsteam telefonisch oder per Mail zu kontaktieren. Ausgewertet wurden die Fragebogendaten mit deskriptiven, nonparametrischen und parametrischen Verfahren (vgl. Edelmann, Wannack & Schneider 2018a; 2018b).
Einverständniserklärung und Datenschutz
Das Einholen der informierten Einwilligungen der an der Studie beteiligten Personen wurde schrittweise angegangen. Im Frühling 2017 informierten die Projektverantwortlichen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich schriftlich die Schulleitungen derjenigen Kindergärten, die für die Stichprobenziehung infrage kamen. Anhand der konkreten Auswahl der Kindergärten nahm das Forschungsteam mit der entsprechenden Schulleitung Kontakt auf, um das Einverständnis zur Teilnahme der vorgesehenen Kindergartenlehrperson einzuholen. Lag dieses vor, wurde die Kindergartenlehrperson telefonisch oder per E-Mail angefragt, ob sie bereit wäre, an der Studie teilzunehmen. Bei einem positiven Entscheid der Kindergartenlehrperson wurden die Eltern schriftlich kontaktiert. Sie erhielten ein Informationsschreiben und eine Einverständniserklärung zur Teilnahme ihres Kindes an der Studie. Auch diese Unterlagen waren in die elf im Kanton Zürich am häufigsten gesprochenen Sprachen übersetzt worden. Im Rahmen der Videoaufnahmen wurde sowohl von allen Lehrpersonen als auch von anderen während der Aufnahmen anwesenden Fachpersonen ihr schriftliches Einverständnis eingeholt. Seitens des Forschungsteams wurde zuhanden der Bildungsdirektion des Kantons Zürich das Dokument «Informationen zum Datenschutz Kindergartenstudie Kanton Zürich» verfasst. Sämtliche Unterlagen sind in Edelmann, Wannack und Schneider (2018b) dokumentiert.
Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum Untersuchungsdesign und den damit verbundenen Erhebungen und Stichproben werden in den folgenden Kapiteln (4 bis 11) nun spezifische Fragestellungen fokussiert und die damit verbundenen Ergebnisse präsentiert. Diese Kapitel sind in sich geschlossen gestaltet und können unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Zur Erinnerung: Eine Kurzübersicht zu den einzelnen Themen findet sich in Kapitel 1.