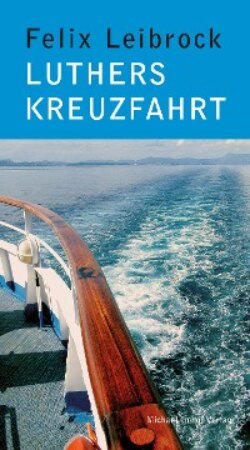Читать книгу Luthers Kreuzfahrt - Felix Leibrock - Страница 7
III
ОглавлениеAls Kind kannte Didi das Gefühl, besser nicht geboren zu sein. Auch wenn er ihr einziges Kind war, hatten seine Eltern eigentlich keine Zeit für ihn. Sein Vater, Erich Dollmann, betrieb einen Ein-Mann-Sanitärbetrieb in Bruchköbel, einer hessischen Kleinstadt. Die Aufträge, die er bekam, waren mehr als bescheiden. Hier mal ein verstopftes Abflussrohr bei einer alten Witwe, da mal ein tropfender Wasserhahn, das war zum Leben zu wenig. Ein paar Mal hatte er versucht, bei größeren öffentlichen Aufträgen mitzuhalten. Die neuen Sanitäranlagen der städtischen Grundschule, die Gemeinschaftsdusche in der Kreis-Sporthalle. Er plante, Arbeitskräfte zumindest befristet einzustellen, um den Auftrag auszuführen. Didi saß im Peugeot-Lieferwagen, wenn der Vater zur Gebotseröffnung in die Stadtverwaltung oder ins Landratsamt fuhr. Er wartete im Auto und sah schon am schleppenden Gang des Vaters, dass es wieder mal nicht geklappt hatte. Auf der Rückfahrt war der Vater einsilbig, murmelte etwas von illegalen Absprachen und griff zu Hause immer häufiger zur Cognacflasche. Das waren die Augenblicke, in denen Didi höchst wachsam sein musste. Mehr als einmal hatte der Vater den ersten Anlass genutzt, um seinen Frust an ihm abzureagieren. Nicht nur mit Worten. Auch die Hand rutschte ihm das ein oder andere Mal aus, wie er euphemistisch die Tracht Prügel beschrieb, die er dem Sohn verabreichte. Aus schlechtem Gewissen heraus nahm er ihn dann am nächsten Tag mit zu einem Auftrag, gab ihm einen Groschen für das Halten des Rohres oder das Tragen der Wasserpumpenzange und erlaubte ihm, für ihn die Knöpfe des Spielautomaten in den Kneipen zu drücken, die sie auf der Heimfahrt aufsuchten und in denen Vater Erich nicht nur ein Pils trank. Obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnten, fuhr der Vater mit Didi einige Jahre im Sommer für ein, zwei Wochen zu einem Bauernhof in der Nähe des oberbayerischen Wolfratshausen. Der Vater half dem Bauern, einem entfernten Verwandten, gegen freie Kost und Logis bei der Ernte, während Didi an der Isar entlangzog, ohne wirklichen Kontakt zu den Kindern des Ortes zu finden. Am Abend pichelte der Vater mit dem Bauern selbstgebrannten Schnaps. Didi blieben nur die Katzen, Schweine, Kühe und Bobo, der Hofhund, als Bezugswesen. Wen er schmerzlich bei diesen Urlauben vermisste, war die Mutter. Hier hätte er vielleicht eine innigere Beziehung zu ihr gefunden! Sie wäre mit ihm gemeinsam an der Isar spazieren gegangen, hätte ihm Käfer und Gräser erklärt und ihm gezeigt, wie man Steine auf dem Wasser hüpfen lässt. Aber seine Mutter war nie dabei. Sie musste Geld verdienen, um die Existenz der Familie abzusichern. Die wenigen Einnahmen des Vaters wanderten zunehmend in seinen Alkoholkonsum.
Christel Dollmann war in jungen Jahren eine schöne, sportliche Frau. Mit ihren eingedrehten blonden Locken und ihrer natürlichen Eleganz erinnerte sie nicht wenige an die damals von allen bewunderte Grace Kelly. Erich Dollmann hatte Christel beim Tanz kennengelernt. Es imponierte ihr, wie aufgeschlossen er den neuen Tänzen Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll gegenüber stand. Wild warf er sie bei diesen Tänzen hin und her und bei innigen Tangoschritten zu Freddy Quinns Die Gitarre und das Meer hauchte er ihr ins Ohr, er möchte mit ihr alt werden. Die Hochzeit fand in großer Bescheidenheit statt, alles Geld wurde gespart für die Flitterwochen am Lago Maggiore, wo man dem Brautpaar in einem kuscheligen Albergo das schönste Zimmer gab, mit Blick auf den See.
Didi kam ein Jahr später zur Welt. Die Ehe ging sehr schnell in Routine über, in ein Zusammensein, das geprägt war von Streiten über fehlendes Geld, Trunkenheit des Vaters und Gesprächen nur noch an der Oberfläche. Die Familie, das zeigte sich bald, brauchte ein zweites, ein sicheres Einkommen. Christel Dollmann erwarb als eine der ersten Frauen in Bruchköbel den Führerschein. Mit Hilfe eines Kredites kauften sie einen VW-Bus T1, den sie zu einem Verkaufswagen umbauten und mit dem fortan Christel Dollmann über die Dörfer fuhr, um Brot, Eier, Wurst und andere frische Lebensmittel zu verkaufen. Vor allem die alten, nicht automobilisierten Leute auf dem Dorf waren dankbar für diesen Service. Der Service funktionierte aber nur, so dachte Didis Mutter, wenn sie 365 Tage im Jahr immer zur gleichen Zeit bei Wind und Wetter die Dörfer anfuhr. Verlässlich zu sein war das A und O, sonst überließen die alten Leute zunehmend den Kindern die Versorgung. Und die, die fuhren in die wie Pilze aus dem Boden schießenden Supermärkte. Dort fanden sie eine größere Auswahl, und die Preise waren auf Grund der Massenkontingente beim Einkauf günstiger. Darum fuhr die Mutter nie mit nach Oberbayern. Darum war Didi immer alleine an der Isar unterwegs. Urlaub war für seine Mutter, die selbst an Heiligabend über die Dörfer fuhr, ein Fremdwort, und er musste sich alleine beibringen, wie Steine auf der Isar hüpfen.
An die Schulzeit dachte Didi nie gerne zurück. Jede Klasse hat mindestens einen Außenseiter, und manchmal gab es auch einen Außenseiter für die ganze Schule. Didi war so einer. Oft war er Gesprächsthema in allen Schulklassen des von ihm besuchten Knaben-Realgymnasiums. So einmal, als ihm einige Jungs der höheren Klassen mit Nägeln seine neue Windjacke, auf die er so stolz war, auf einer der Holzbänke unter der alten Linde des Schulhofs festtackerten. Der Schulgong ertönte. Er bemühte sich, eilig in den Unterrichtsraum zu kommen, ergriff die Jacke im Rennen. Mit einem großen Ratsch riss sie mitten entzwei. Natürlich war das keiner der Jugendlichen gewesen, als es zur Gegenüberstellung beim Direktor kam. Sie gaben sich gegenseitig ein Alibi. Didi stand alleine da mit seiner kaputten Jacke – und musste ein häusliches Donnerwetter vom Vater zusätzlich fürchten. Tagelang sah er in grinsende Gesichter der höherklassigen Schüler. Als er einmal auf einen losstürmte und ihm die Faust ins Gesicht schlagen wollte, stürzten sich die anderen auf ihn und lieferten ihn beim Direktor ab. Mehrere Tage Nachsitzen!
Demütigend war vieles in der Schule. In den Hofpausen bildeten sich mehrere Teams, die mit einem Tennisball auf verschiedenen Feldern des Schulhofs Fußball spielten. Nicht, dass er davon ausgeschlossen war. Aber am Anfang stand die Wahl der Mannschaften. Die beiden Anführer bildeten einen Abstand von einigen Metern und gingen dann, abwechselnd Fuß vor Fuß setzend und Schnick-Schnack rufend, aufeinander zu. Wer den Fuß am Schluss auf den Fuß des anderen setzte, begann mit der Wahl. In Form eines neuzeitlichen Sklavenhandels gingen zuerst die guten und beliebten Spieler weg. Zwar war Didi gar kein so schlechter Fußballer. Aber warum sollten sich die Mitschüler diese Gelegenheit entgehen lassen, ihn zu demütigen? Also wählten sie auch die schwächeren Spieler in die Teams und ließen ihn am Schluss alleine schmoren. Obwohl klar war, dass er nun zu dem Team kam, das als letztes an der Wahl war, sagte deren Anführer demonstrativ: „Nee, lieber spielen wir mit einem weniger als mit DEM da.“ Erst nachdem sich alle eins abgelacht hatten, durfte er gnadenhalber mitspielen. Oft ging er dann ruppig zur Sache, was ihm die kollektive Wut der gegnerischen, manchmal sogar der eigenen Spieler bescherte. In ihm stieg in solchen Situationen ein schwarzes Tier auf, ein unbändiger Hass auf die Mitschüler, das Leben überhaupt. Warum, so fragte er sich, wenn er einsam nach Hause trottete, bin ich auf der Welt?
Oft überlegte er, warum er in diese Außenseiterrolle geraten war. Ihm kam dabei stets die verwundete Katze in den Sinn. Sie war ihm und einigen Klassenkameraden über den Weg gelaufen, humpelnd, da ihr ein Bein fehlte. Die anderen machten sich einen Spaß daraus, das geplagte Tier durch den Park neben der Schule zu jagen, nach ihm zu treten und es mit übelsten Schimpfworten zu belegen.
„Halt, hört auf, lasst sie in Ruhe!“, war er, Didi, damals vehement dazwischengegangen. Er hatte den Klassenkameraden sogar gedroht, es ihren Eltern zu sagen. Mit Katzen hatte er auf dem Bauernhof bei Wolfratshausen geschmust, sie waren ihm lieb und wertvoll. Verächtlich hatten ihn die anderen angeschaut. Einer, Kalle, spuckte ihm ins Gesicht. Am nächsten Tag machte das Erlebnis die Runde in der Klasse, dann in der Schule: Didi, das Weichei! Der Katzenfreund!
Einige Wochen später, bei einer Exkursion, versuchte Didi, sein Image aufzupolieren. Sie kamen an einen Tümpel voller Frösche. Der Biologielehrer, Herr Weschke, war mit einem Teil der Klasse bereits weitergegangen. Didi zog den Strohhalm aus seiner Caprisonne, grapschte nach einem Frosch, steckte ihm vor den verwunderten Augen seiner Mitschüler den Strohhalm in den Hals und blies ihn kräftig auf. Erst als das Tier zu platzen drohte, warf er es ins Wasser zurück. Erwartungsvoll sah er auf die Umstehenden, die sogleich murmelnd in Gruppen davongingen. Er trottete alleine hinterher. Am Ende der Exkursion bat ihn Weschke zu einem Einzelgespräch. Ob es stimme, dass er einen Frosch gequält habe und so weiter. Eine Woche Nachsitzen und alleiniger Tafeldienst. Die Aktion war danebengegangen. Nichts mehr konnte ihn aus der Außenseiterrolle herauskatapultieren. Er hatte das Kainsmal auf der Stirn, unwiderruflich. Weil er keine Katzen quälte.
Doch es gab auch lichte Momente in seiner Jugendzeit. Mit zwölf Jahren hatte er Geld angespart und kaufte sich eine gebrauchte Gitarre. Lange hatte er davon geträumt. Sogar sein Vater steuerte fünf Mark für ein Lehrbuch zum Selbstunterricht bei; denn für den Unterricht in der städtischen Musikschule reichte sein Geld nicht. Stundenlang saß er in seinem Zimmer oder am Schmelz-Weiher und übte Griffe. Manchmal gab ihm sein Musiklehrer am Gymnasium, Herr Leyser, ein paar Tipps. Er begeisterte sich für Jimi Hendrix an der Gitarre und die Liedtexte von Jim Morrison. Beide genial als Musiker, aber jung gestorben. Morbide Anwandlungen. Träume von Jamsessions mit Gleichgesinnten. Der Reiz der Drogen. Erstmals taten sich ihm Auswege aus seinem tief empfundenen Verlorensein in dieser Welt auf. Seine erstaunlichen Fortschritte brachten ihm auch kleinere Auftritte bei Schulfesten. Gelegentliche Versuche, eine eigene Band zu gründen, scheiterten an fehlender Disziplin der Mitspieler, die oft die Proben schwänzten. Live fast, love hard, die young, das war die Lebensmaxime nicht nur von Hendrix und Morrison. Auch er nahm sich mehr und mehr vor, schnell und intensiv zu leben, aus der Isolation auszubrechen, heftig zu lieben und jung zu sterben. Ohne genau zu wissen, wie ihm geschah, hatte er eines Tages seinen ersten Samenerguss. Verwundert sah er auf die milchige Flüssigkeit und fragte sich, wie er wohl diesen Teil des Dreiklangs erfüllen sollte: Love hard, heftig lieben. Noch nie hatte sich ein Mädchen für ihn, den Außenseiter, das Spottobjekt der Schule interessiert. Mit seinem kastenförmigen Kopf und den damals stark abstehenden Ohren, mit seinen vielen Pickeln auf der blassen Gesichtshaut war er alles andere als ein Schönling. Auch sein Interesse am anderen Geschlecht war noch nicht erwacht. Im Gegenteil. Bei einer Klassenfahrt nach Mannheim mit einer Übernachtung in der Jugendherberge kam es im Schlafsaal eines Nachts zu einer homoerotischen Orgie. In der Dunkelheit gab einer aus der Klasse das Kommando vor. Alle zogen sich aus und langten sich in wildem Durcheinander an ihre schon bald erigierten Glieder. Auch er war Teil dieses juvenilen Erlebnisses, weil ihn niemand erkannt hatte und der Kick des Abenteuers die Lust am Demütigen seiner Person überwog. Die Mitschüler hatten schlicht und einfach vergessen, dass auch er an der Orgie teilnahm. Für ihn ein positives Erlebnis, auch wenn am nächsten Tag alle betreten beim Frühstück saßen und sich ihrer Ausgelassenheit schämten. Die Wochen darauf waren die Zeit der Paarbildung. Die Penisorgie verletzte die Mannesidentität. Mädchen erobern, das war der Weg, das Selbstbild zu korrigieren, vor sich selbst und den anderen. Die Jungen seiner Klasse eilten nach Schulschluss zum nahe gelegenen Mädchengymnasium. Schon bald gingen sie mit einer Auserwählten Händchen haltend zur Eisdiele oder in das Eye, den Jugendclub, in den nur reinkam, wer gute Beziehungen zum Türsteher hatte. Didi gehörte nicht dazu. Wütend drosch er zu Hause die Akkorde in die Gitarre. Auch er sehnte sich jetzt plötzlich nach einer Freundin, die er von ganzem Herzen liebte und die ihm diese Liebe erwiderte. Doch die Beutezüge ans Mädchengymnasium liefen ohne ihn ab.
Wie ein Wunder erschien es ihm, als sie plötzlich in seinem Leben auftauchte: Ulrike Braunholz. Nie zuvor hatte er sie gesehen. Den Namen las er auf ihrer Schultasche, als sie vor ihm in den Bus stieg. Er empfand sie überirdisch schön. Einmal erhaschte er an der Bushaltestelle einen Blick in ihre dunkelbraunen Augen. Für ihn war es der Blick in die Tiefe seines Lebens. In ihr, Ulrike, lagen alle Antworten auf seine existenziellen Fragen verborgen. Sie, nur sie war die Frau, mit der zusammen ein Weiterleben einen Sinn hatte. So dachte der Fünfzehnjährige. Wie aber sollte er, der, von einer langweiligen Cousine bei Familienfeiern abgesehen, noch nie mit einem Mädchen gesprochen hatte, wie sollte er sie kennenlernen? Er hatte keine Ahnung, wie man anmacht, anbaggert, aufreißt. Begriffe, die er von Klassenkameraden aufgeschnappt hatte. Ulrike ansprechen, allein der Gedanke bereitete ihm Schweißausbrüche. Aber sie war sein einziger Ausweg. Für sie war er in die Welt gekommen. Und sie, hoffentlich, hoffentlich, für ihn. Sie kennenlernen. Nichts essen konnte er in dieser Zeit, an Schlaf war nicht zu denken. Er war krank, herzkrank, ulrikekrank. Dann war sie da. Die Idee, wie sie anzusprechen war.