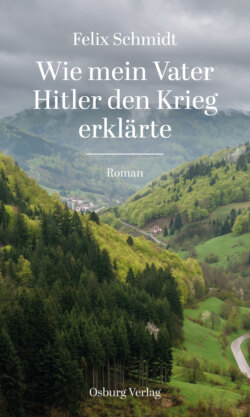Читать книгу Wie mein Vater Hitler den Krieg erklärte - Felix Schmidt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеEigentlich wollte ich gar nicht aus der Mutter in die Welt schlüpfen.
Es war fünf Uhr morgens an einem Donnerstag, als die Wehen einsetzten und die Hebamme geholt wurde. Aber weder sie noch die Großmutter schafften es, mich aus der dunklen Höhle im Bauch der Mutter zu zerren. Doktor Gutenberg, der Hausarzt, wurde alarmiert. Er hatte eine Praxis nur ein paar Häuser weiter und kam auf Zuruf. Dem Doktor gelang es, mich mit einiger Mühe und einer Zange ans Licht des schon sonnigen Apriltages zu holen.
Ich war nicht das rosige Baby, das erwartet worden war. Ich war blau – wie der Vater, der offenbar vorzeitig einen zu großen Willkommensschluck aus der Schnapsflasche genommen hatte und nun am Türrahmen lehnte und dumme Fragen stellte, bis die Großmutter ihn aus dem Zimmer warf. Weil ich mich weigerte, richtig zu atmen, schüttelte und tätschelte sie mich, redete leise auf mich ein, flehte mich an: »Komm, komm.« Schließlich hob sie mich in die Höhe, schwenkte mich durch die Luft, und endlich kam der erste Schrei. So hat sie es mir einmal erzählt. Ihre wärmenden Hände haben mir auch in späteren Jahren die Liebe und den Halt gegeben, die ich von den Eltern nicht bekam.
Aber Familie ist Schicksal. Auf die Entscheidung, zu wem wir gehören, haben wir keinen Einfluss.
Die Geschehnisse der frühkindlichen Tage, an die ich mich entsinne – oder waren es die Erzählungen der Großmutter von den Geschehnissen, an die ich mich erinnere –, waren mit Lärm und Geschrei verbunden. Es war tief in der Nacht, als mich das Klirren von Glas und Geschirr aufweckte, das zerschmettert wurde. Mein Bett stand in einem kleinen Zimmer, das an die Küche angrenzte. Von dort kam das Klirren. Die Stimmen, die in den kurzen Pausen zwischen den Aufschlägen gegeneinander kämpften, waren mir vertraut: das Geschrei des Vaters und das Schluchzen der Mutter. Ich war viereinhalb Jahre alt, und es war das erste Mal, dass ich einen der vielen Jähzornausbrüche des Vaters erlebte, mit denen er die Familie immer wieder in Schrecken versetzte und mir große Angst einjagte. Mein kleiner Bruder, der ohne jede Schwierigkeit zwei Jahre zuvor geboren worden war und neben mir schlief, bekam von dem verstörenden Radau nichts mit. Auch später hat ihn der Unfriede in der Familie nicht sonderlich berührt, er konnte die Querelen von sich abschütteln. Er hatte einen günstigen Wind in seinem Lebenssegel.
Wochen später klirrte und brüllte es wieder in der Nacht. Der Lärm kam jedoch nicht aus der Küche. Er kam vom Nachbarhaus, von Männern in Uniformen – heute weiß ich, dass es braune waren –, die mit Brechstangen und Vorschlaghämmern Scheiben und Türen einschlugen. Es war das Haus einer vielköpfigen Familie, zu der die gutnachbarliche Beziehung eine Selbstverständlichkeit war.
Die Schreie des Vaters über die Straße hinweg, »Aufhören! Aufhören!«, gingen im Gejohle und im Zerstörungsrausch der Horde uniformierter Männer unter. Er hatte Glück, dass er nicht gehört wurde. Immerhin hatte er, wie mir später klar wurde, Zivilcourage bewiesen, denn er wusste genau, wogegen er protestierte.
Als er am Morgen danach im Volksempfänger die Nachrichten hörte, erfuhr er, dass im ganzen Deutschen Reich bei Einbruch der Dunkelheit die Geschäfte der Juden von SA-Leuten geplündert, ihre Häuser zum Teil zerstört und sie selbst eingesperrt worden waren. So hat er es der Mutter und der Großmutter erzählt. Im Großdeutschen Rundfunk hatte das sicher anders geklungen. Nun musste er sich auch nicht mehr darüber wundern, dass jüdische Nachbarn, mit denen er befreundet war, die Kleine Stadt am Rhein schon vor Wochen verlassen hatten, ohne sich von den Nachbarn zu verabschieden.
Die Synagogen brannten noch, als am zehnten November 1938 in den evangelischen Kirchen Luthers Geburtstag gefeiert wurde. Ich war mit meinen viereinhalb Jahren noch zu jung, um diese frühen Eindrücke richtig zu deuten. Das Klirren des Geschirrs in der Küche und das Splittern der Scheiben in der damals sogenannten Reichskristallnacht flossen ineinander und vermischten sich mit dem Bild der Großmutter, die, als draußen der Pogrom tobte, Perlen, die an einer Schnur aufgereiht waren, durch Daumen und Zeigefinger schob und dazu vor sich hinmurmelte.
Später, als ich schon begreifen konnte, dass man mit Gebeten Schaden abzuwenden versucht, bläute sie mir ein, der Rosenkranz sei die beste Medizin gegen die Zumutungen des Lebens und die wichtigste Waffe gegen das Böse. Mein Seelenfrieden war, wenn ich den Rosenkranz mit ihr betete, meist wiederhergestellt, noch bevor die neunundfünfzig Perlen am Schnürchen durch meine Finger geglitten waren. Beim zweiten oder dritten der zehn Ave-Marias war ich bereits eingeschlafen.
Als ich einmal starke Bauchschmerzen hatte und auch der zweimal gebetete Rosenkranz keine Wirkung zeigte, empfahl sie mir, stattdessen beide Ohren mindestens eine Minute lang mit den Händen zu massieren – ein Vorschlag, den heute sogar Mediziner machen. Sie war nicht nur fromm, sondern auch pragmatisch. Sie hat mir nicht nur das Beten beigebracht, sie hat mir auch gezeigt, wie man mit Messer und Gabel isst und sich den Hintern richtig abwischt.
Damals in der Nacht, als in der elterlichen Küche die Scherben klirrten, hat mein kindliches Gemüt ersten Schaden genommen. Vage spürte ich, dass die häusliche Eintracht einen Riss bekommen hatte. Es waren sicher Angsttränen, die ich weinte, als mich die Großmutter, die den tobenden Vater nicht beruhigen konnte, aus dem Bett holte und zu sich in ihre Wohnung nahm. Dort blieb ich, bis sie starb. Sie war ins oberste Stockwerk gezogen, als der Vater geheiratet und das Geschäft übernommen hatte. In diesem Rückzugsgebiet hat sie, so gut sie konnte, ausgeglichen, was die Eltern mir an Liebe nicht geben konnten.
Die Großmutter war eine kleine zierliche Frau mit einem gütigen Gesicht und klaren Augen. Sie war eine auf naive Art tiefreligiöse Katholikin, die sicher das Vaterunser rückwärts beten konnte. Selbst bei Anlässen, bei denen man es nicht vermutete, hatte sie ein Gebet auf den Lippen. Ich habe einmal beobachtet, wie sie den Hühnern, die im großen Obsthof umherliefen, ein Vaterunser vorbetete. »Man muss den Herrgott bei allem, was man tut, vor sich haben«, hat sie mich belehrt, als ich sie darauf ansprach.
Immer deutlicher empfand ich, dass mich mit ihr mehr verband als mit den Eltern. Ich war froh, sie als Verbündete zu haben, wenn es sein musste auch gegen den Vater. Ich schlief neben ihr im Bett, bis ich mein eigenes Zimmer, eine Mansarde, bekam. Wenn ich Sorgen hatte, schlechte Noten aus der Schule brachte oder im Kaufmannsladen beim Klauen erwischt worden war, suchte ich Trost bei ihr. Mutter und Vater sah ich eigentlich nur bei den Mahlzeiten – und auch bloß, weil die Großmutter mit am Tisch saß. In meiner Erinnerung ging sie immer leicht vorgebeugt, den Rücken gekrümmt, vielleicht trug sie immer noch an der Schinderei auf den Feldern und in der Werkstatt ihres Mannes, und an der Last der Schicksalsschläge.
Auf einem unserer Spaziergänge über den Friedhof zeigte sie mir das Grab ihrer Zwillinge, die im Alter von sechs Jahren an einer Gehirnhautentzündung verstorben waren. Wenn die Großmutter von den Toten, von Krankheit und Unglück sprach, waren immer Trauer im Ton und Tränen in den Augen. Manchmal, wenn sie von den schweren Tagen der Vergangenheit erzählte, stemmte sie die Hände in die Seiten ihres schmächtigen Körpers, als wollte sie sich mit dieser Geste nachträglich noch gegen die Schicksalsschläge zur Wehr setzen.
Als ich eines Abends vom Milchholen in der Milchzentrale der Kleinen Stadt zurückkam, stand sie, die Hände fest an die Lenden gepresst, als wolle sie sich gegen etwas abschirmen, in ihrer geblümten Schürze in der Küche vor dem Radio, der Vater neben ihr. Er hatte die Hand hinter das rechte Ohr geschoben, damit er besser verstehen konnte, was gesagt wurde. Es war die Stimme Adolf Hitlers, die den Einmarsch der deutschen Truppen in Polen bekanntgab. »Jetzt geht der Schrecken wieder los«, sagte sie. Sie hatte den Ersten Weltkrieg erlebt. Soeben hatte der Zweite begonnen.
Mit dem Namen Hitler konnte ich schon etwas anfangen. Der Vater hatte ihn öfter erwähnt und mir mit einem abfälligen Zungenschlag erklärt, dass er der Reichskanzler sei und der Führer einer Partei, die sich NSDAP nenne. Offensichtlich mochte er sie nicht.
Es war der erste September 1939. In der Kleinen Stadt am Rhein war es ein nieseliger Tag, der mit schwerem Regen in die Nacht überging. »Ich habe mir gedacht, dass der Hitler einen Krieg anfangen wird«, sagte die Großmutter.
Am selben Abend warf mich der Vater aus der Küche, als ich ihn in einer merkwürdigen, geradezu lächerlichen Pose ertappte. Er saß auf einem Stuhl und hatte ein Tischtuch über seinen nach vorne gebeugtem Kopf gehängt, als würde er aus einer Schüssel heiße Kamillendämpfe inhalieren. Dabei schien es, als redete er mit sich selbst, bis ich merkte, dass die Sätze aus dem Radio kamen. Als ich ihn anstupste, tauchte er kurz unter dem Tuch auf und schrie: »Geh raus«, ganz so, als hätte ich ihn bei etwas erwischt, das man nicht tut. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis mir klar wurde, dass er die in deutscher Sprache gesendeten Nachrichten der britischen BBC hörte. Nach der mit Paukenschlägen verbundenen Ankündigung »Hier ist London« konnte man auf dieser Welle erfahren, was man in den Nachrichten des Reichssenders nicht hörte: wie es um Deutschland wirklich stand, wie die Front im Osten und später im Westen tatsächlich verlief und was mit den Menschen geschah, die von den Nationalsozialisten verschleppt wurden.
Ich war alt genug, um zu begreifen, was Krieg bedeutete. Ich hatte in einem Bildband über den Ersten Weltkrieg aus Großmutters kleiner Bibliothek Fotos gesehen, die mich erschreckten: Kanonenrohre, aus denen dunkle Rauchwolken kamen, Soldaten, die sich die Ohren zuhielten, wenn eine Salve abgefeuert wurde, ein Offizier mit blutiger Stirn, der beide Hände Hilfe suchend einer Schwester in Rot-Kreuz-Kleidung entgegenstreckte.
»Das steht uns alles wieder bevor«, sagte die Großmutter, als sie mich wieder und wieder im Kriegsbuch blättern sah, und griff zum Rosenkranz.
Ein Bild, das nicht in Großmutters Fotoband war, das ich erst Jahrzehnte später bei meinen Recherchen im Archiv der Kleinen Stadt am Rhein entdeckt habe, lässt mich vermuten, dass der neue Krieg die Kleine Stadt rasch aus der Stille und Behaglichkeit herausgerissen hat. Das mit den Jahren verblichene Foto zeigt eine Ansammlung von Männern in graugrünen Uniformen mit Tornistern und Stahlhelmen und Frauen, die offensichtlich von ihren Männern Abschied nehmen. Möglicherweise war der Vater auch darunter. Er ist jedenfalls in den ersten Kriegstagen oder vielleicht sogar schon vorher eingezogen worden. Er war damals um die vierzig Jahre alt. Den Einberufungsbefehl habe ich nach seinem Tod im Keller in einem Karton gefunden, den die Mäuse schon so zerfleddert hatten, dass man auf den Papieren nicht mehr viel entziffern konnte, auch nicht das Datum. Nur der Name Olmütz war noch zu lesen.
Der Vater hat sich später geweigert, über die Militärzeit zu sprechen. Wenn ich ihn danach fragte, verschränkte er seine Hände auf dem Rücken und fertigte mich mit dem Satz ab: »Im Krieg geht alles drunter und drüber, ich kann mich an nichts mehr richtig erinnern.«
Ich kann nur vermuten, dass er in den Tagen, in denen er eine Uniform trug, mit Dingen konfrontiert wurde, die seine Abneigung gegen den Hitler-Staat verstärkten und ihn schließlich in die totale Ablehnung trieben.
Ich habe auch nie aus ihm herausbekommen, ob er vielleicht nicht wie die meisten Deutschen am Anfang, als Hitler die Autobahnen baute und sechs Millionen Arbeitslose von der Straße holte, der NSDAP einige Sympathie entgegengebracht hat – wie sein Vater. Er war gleich bei Hitlers Machtübernahme 1933 in die Partei eingetreten und trug das runde Abzeichen mit dem Hakenkreuz am Revers des Sonntagsanzugs.
War es noch im Winter 1939 oder schon Frühling des folgenden Jahres, als der Vater überraschend wieder nach Hause kam? Er hatte zwar in einem dieser grauen Feldpostbriefe geschrieben, dass er im Lazarett liege, aber nicht wo und warum.
Niemand hatte mit ihm gerechnet. Die Mutter hantierte am Herd, und die Großmutter las im »Heimatboten«, als er aus dem Halbdunkel des Flurs in die Küche trat. Er nahm die Mütze ab und sagte: »Ich bin wieder da.« Er wirkte fremd. Die Haare waren ihm ausgefallen, er war bis auf die Knochen abgemagert, er hustete furchterregend. Noch in der Küche sackte er in sich zusammen. So hat es mir jedenfalls die Großmutter erzählt. Die nächsten Monate verbrachte er vorwiegend im Bett. So gut es ging, steuerte Doktor Gutenberg, der alle zwei Tage nach ihm sah, mit Medikamenten der lebensbedrohenden Rippenfellentzündung entgegen, die er im Lazarett nicht richtig auskuriert hatte. Sie war auf dem Heimweg wieder voll ausgebrochen. Es dauerte und dauerte, bis er wieder auf die Beine kam. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen.
Die Mutter hatte es nicht leicht mit ihm. Wenn der Vater nach ihr rief, weil er Durst hatte oder auf die Toilette musste, sprang sie sofort auf. Sie seifte ihn, auch wenn er es nicht wollte, mit ihren kräftigen Händen ab. Sie wechselte einmal am Tag das durchgeschwitzte Bettlaken. Ich habe ihr dabei einmal zugeschaut und an ihren Händen die vielen Schrunden gesehen, die noch aus den Tagen stammten, als sie auf dem elterlichen Bauernhof im Renchtal hart anpacken musste. Sie war Tag und Nacht um ihn. Nur am Sonntag verließ sie das Haus, um in die Messe zu gehen. Dafür legte sie die Kittelschürze ab, zog das dunkelblaue Kostüm an, das sie im örtlichen Bekleidungshaus gekauft hatte. Dann flocht sie ihre tiefschwarzen Haare zu einem mächtigen Zopf, den sie unter einem Kapotthütchen nur mühsam verstecken konnte.
Der Aufenthalt in der Kirche und der anschließende Gang auf den Friedhof zu den Gräbern der Familie war nicht nur eine Verschnaufpause im aufreibenden Alltag, der Weihrauch, der Sing-Sang der lateinischen Messe, das Gold des Hochaltars waren auch gut für das ramponierte Seelenheil.
Die Pflege des Vaters hat sie nicht nur körperlich erschöpft, sondern auch seelisch. Der Vater zeigte so gar keine Dankbarkeit für das, was die Mutter tagein, tagaus rund um die Uhr leistete. Im Gegenteil. Wenn ihm etwas nicht passte oder sie nicht schnell genug war, fing er sofort an zu schimpfen und zu fluchen, er versetzte ihr richtige Seelenhiebe.
»Ja, geht’s denn nicht schneller?« Oder: »Bist du denn zu gar nichts fähig?« Und so ging’s weiter.
Die Mutter hat nie dagegen aufgemuckt. »Um des lieben Friedens willen«, wie sie sich später einmal rechtfertigte.
Manchmal habe ich an der Tür zum Schlafzimmer gelauscht, aus dem ein lustvolles Stöhnen kam, hinter dem ich in meiner kindlichen Naivität etwas Harmonisches vermutete. Es war ein geheimnisvolles Spiel, das ich noch nicht zu deuten wusste. Da war der Vater schon einigermaßen hergestellt und arbeitete wieder in der Werkstatt. Ein anderes Mal schnappte ich beim Lauschen ein Wort auf, unter dem ich mir nichts vorstellen konnte: »Konzentrationslager«. Was es damit auf sich hatte, hat er nur geflüstert. Ich konnte nur so viel verstehen, dass es sich um Häuser handeln musste, in die man Menschen einsperrte. Als ich ihn Tage später fragte, was ein Konzentrationslager sei, das Wort hatte ich mir gemerkt, schüttelte er mürrisch den Kopf. »Weiß ich nicht, wo hast du denn das her?«
Die vierziger Jahre schritten voran. In meinem Gedächtnis läuft da vieles zusammen, was sich zu einem Gefühlsgebirge auftürmt, Wolkenwülsten vergleichbar, die aussehen, als habe Rubens sie an den blauen Sommerhimmel des Jahres 1942 gemalt. Der Vater hatte wieder zurück ins Alltagsleben gefunden, ganz erholt hat er sich jedoch nie mehr. Das lässt sich schon an den immer wiederkehrenden Infektionen und den vielen Arztbesuchen ablesen, von denen er stets abgeschlagen und mutlos zurückkehrte.
Er stellte dann sein Fahrrad an der Haustür ab und schlurfte, als würde ihn bei jedem Schritt der Schmerz einer Wunde quälen, in die Schnapsbrennerei, die der Werkstatt angegliedert war und die er als Nebenerwerb betrieb. Sie brachte ein schönes Sümmchen auf sein Konto bei der Vereinsbank. Sein Kirschwasser und sein Mirabellenschnaps waren begehrt und wurden in verschiedenen Wirtshäusern angeboten, in denen der Vater auch ein guter Gast war.
Ich habe oft neben dem großen Brennkessel gehockt und zugeschaut, wie der Vater dicke Holzscheite in den Ofen unter dem Kessel schob und den nicht trinkbaren Vorlauf, der wie der Leim aus seiner Werkstatt roch, für andere Verwendungen abfüllte. In einem zweiten Brennvorgang rieselte dann der Feinbrand in einem dünnen Strahl aus dem Kessel in eine der bauchigen Korbflaschen. Einmal beobachtet ich ihn dabei, wie er ein paar Handvoll Nüsse, die noch in den grasgrünen Schalen steckten, in einer der großen Pullen versenkte, Zucker dazuschüttete und den noch warmen Trester-Schnaps darübergoss, bis sie zu drei Vierteln gefüllt war. Die Buddel blieb den ganzen Sommer auf dem Sims vor dem großen Werkstattfenster in der prallen Sonne stehen, mit einer dicken Schnur vertäut. Im späten Herbst wurde das Gebräu abgeseiht und als Nusslikör zur Verdauung eines kräftigen Sonntagsessens serviert.
Die Großmutter mochte es nicht, wenn ich mich in den Alkoholschwaden der überhitzten Brennstube aufhielt. »Das vernebelt dir den Kopf, davon wirst du betrunken«, sagte sie, wenn sie mich aus dem Dunst der Brennerei herausholte und dem Vater einen bösen Blick zuwarf. Das galt nicht für den Samstag. Da roch es nicht nach Schnaps, da duftete es nach frisch gebackenem Brot. Neben dem Brennkessel stand ein aufgemauerter Backofen, den die Großmutter schon am Morgen so stark heizte, dass sie mittags den zu großen Laiben geformten Teig auf einem Backbrett mit einem langen Stiel in die Glut des Ofenschlunds schieben konnte.
Der Vater war kein Genussmensch, aber auf den Leckerbissen des selbst gebackenen Brotes wollte er nicht verzischten. Es kam ihm kein Brot aus einer Bäckerei auf den Tisch. Er hielt es für ungesund. »Man weiß nicht, was da wirklich drinnen ist«, wetterte er, wenn die Mutter ihm mal eine Scheibe Bäckerbrot dazwischenschmuggelte. Er aß das selbst gebackene Brot, zum Frühstück mit Butter und Kunsthonig, zur Vesper mit Speck, den er mit dem Taschenmesser in kleinen Brocken von der Schwarte schnitt. Abends genoss er das Brot zur Suppe, selbst wenn es eine Brotsuppe war.
Zwei Scheiben vom selbst gebackenen Brot mit Bibeleskäs, wie der Quark im Alemannischen heißt, packte mir die Großmutter regelmäßig in den Schulranzen, nachdem ich an Ostern 1940 mit noch nicht ganz sechs Jahren eingeschult worden war. Eigentlich ging das nicht. Aber weil ich schon ein wenig lesen und schreiben konnte und Freude an den Buchstaben und Ziffern hatte und überhaupt ein aufgewecktes Bürschchen war, habe der Schulleiter ein Auge zugedrückt, erzählte die Großmutter, als sie mich in eine Hose steckte, die sie für den ersten Schultag nach einem Schnittmusterbogen auf ihrer Singer-Maschine genäht hatte. Ich erinnere mich daran, dass ich stundenlang vor einem Blatt Papier sitzen konnte und die großen und kleinen Buchstaben aus Großmutters Gebetbuch abmalte. Ich hatte bald heraus, dass es sechsundzwanzig Buchstaben gab. Die Großmutter brachte sie für mich auf einem Blatt in eine Reihe, die sie Alphabet nannte. Auch die Sache mit den Beistrichen, Punkten und Fragezeichen, von denen das Gebetbuch nur so voll war, erklärte mir die Großmutter so, dass ich damit etwas anfangen konnte.
Als der ersehnte Tag der Einschulung endlich da war, brachte mich die Großmutter in die Volksschule. Wir gingen so langsam wie beim Sonntagsspaziergang, weil die Großmutter immer wieder stehen blieb. Sie wechselte mit Bekannten ein paar Worte oder machte vor einem Baum halt und rief: »Ist der aber gewachsen.« Ein paar Mitschüler mit ihren Eltern überholten uns. Ich war traurig, dass ihre Tüten mit Schokolade und Bonbons, die sie im Arm hielten, größer, bunter und viel besser gefüllt waren als die, die mir die Großmutter hergerichtet hatte.
Als wir dann endlich vor dem Schulgebäude standen, überkam mich ein eigenartiges Gefühl. Irgendetwas störte mich. Es war die abstoßend braungraue Farbe, mit der der Klotz angestrichen war. »So braun wie die meisten Lehrer, die hier unterrichten«, sagte die Großmutter. Damit konnte ich noch nichts anfangen.
Der Lehrer setzte mich in die erste Bank. Nur einen Schritt vor mir hing eine kleine Tafel an der Wand auf der etwas stand, das ich trotz meiner Lese- und Schreibkenntnisse nicht entziffern konnte. Der Spruch war in Sütterlinschrift verfasst, die wir nun rasch erlernten. Mancher Zacken, manche Rundung der deutschen Schrift, wie Sütterlin auch genannt wird, hat sich bis zum heutigen Tag in meiner lateinischen Handschrift erhalten, was die Lesbarkeit ein wenig erschwert.