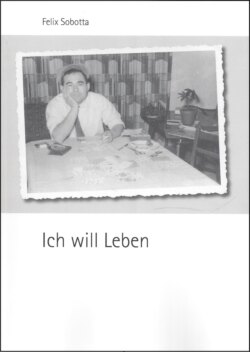Читать книгу Ich will leben - Felix Sobotta - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3: Weihnachten 1944; die Front kommt immer näher
ОглавлениеWeihnachten 1944 steht fast unmittelbar bevor. Aber es wollte so keine richtige weihnachtliche Stimmung aufkommen. Ursachen dafür gab es viele. Die Schwester Bärbel ist klein gestorben. Anderthalb Jahre zuvor war es der kleine Bruder Reinhard. Wahrscheinlich hat das was uns laut Lebensmittelkarten zustand nicht mehr gereicht, um junges Leben wachsen zu lassen, denn von Magermilch und Weizenschrot kann man kaum ein Kleinkind großziehen. Obwohl ich jeden Tag frühmorgens in der Kindermilchküche fertig bereitete und abgekochte Kindernahrung abgefüllt in milchähnlichen Flaschen geholt habe. Diese Milchküche war in einem kleinen Schlösschen auf der Eisenbahnstraße, in einem etwas verwilderten Park, gegenüber des Güterbahnhofs gelegen. Die Rationen auf den Lebensmittelkarten wurden immer kleiner. Besonders die Portionen der Tierischen Fette und die wöchentlichen Fleischrationen weniger und weniger. Und dann, was man sich so rumtuschelte, so hinter vorgehaltner Hand war gerade nicht aufmunternd. Wie gut, das Tante Rut und Tante Hedwig uns wieder paar Gänse besorgen konnte, die im Keller von Muttern gemästet und vor Weihnachten geschlachtet wurden. Ein fette Gans war wie auch in den letzten Jahren für Tante Rut, die andern für uns. Wenn dieses Gänsefett und die Stückchen Räucherspeck, die Tante Hedwig auch organisiert hatte, nicht wären; wie hätte dann mittags und abends die Einbrennsoße geschmeckt? Das Gänsefett kam in einem schmalen und hohen Bunzeltopf mit einem Tuch zugebunden in ein Loch im Holzkeller und wurde hauptsächlich für die Einbrennsoße benutzt. Da im Loch im Holzkeller war es recht kühl und das Gänsefett langte bis fast zum nächsten Jahr. Aber diesmal sollte alles anders kommen!
Das Gänsefleisch wurde wie üblich gebraten und in 2 Liter Gläser eingekocht. Es sollte das Jahr über die kläglichen Fleischrationen ein bisschen ergänzen. Aber auch das sollte im kommenden Jahr anders werden!
Aber zurück zu den gedrückten Weihnachtsvorfreuden! Der große Weihnachtsbaum stand an der Ecke beim Centralkino, aber er erstrahlte nicht im festlichen Weihnachtslicht. Offiziell hieß es, es müsse überall für den Endsieg gespart werden, außerdem erlaube die Verdunklungsvorschrift eine Beleuchtung nicht. Auch sollte Papa und Bruder Franz diese Weihnacht nicht zu Weihnachten zu Hause sein; Papas letzter Feldpostbrief kam aus Ostpommern. Bruder Franz war irgendwo bei den Sturmpionieren. Wo wussten wir nicht. Er konnte es uns nicht schreiben, „denn der Feind sollte nicht wissen, wo sie sich aufhielten“, hieß es offiziell. Bruder Klaus hatte Heilig Abend Dienstbereitschaft. Er durfte dafür an den Feiertagen für paar Stunden nach Hause.
Zum andern: Die Pfefferkuchen waren zwar pünktlich gebacken, aber diesmal nur aus selbst geschrotetem Weizen, den wir, meine Mutter und ich, im Rucksack aus Zabelkau von den Bauern Klyschtsch und Solich Franz bekamen. Mein Rucksack packte so ungefähr 10 kg, der von unsrer Mutter etwa 25 kg. Damit mussten wir von Zabelkau bis Annaberg zum Bahnhof gehen, ungefähr 2,5 km, um dann mit der Bahn nach Ratibor zu fahren. Aber auch aus Reigersfeld, nahe Heydebreck, bekamen wir einen halben Zentner Weizen, den meine Muter und ich mit Vaters Hilfe im Spätsommer nach Ratibor brachten.
Mit dem Reigersfelder Weizen ging es so: Mein Vater war nach seiner Einberufung zur Wehrmacht zunächst Zugführer bei einem Scheinwerferzug, der mit der Heimatflack = Kaliber 8,8 cm eine Einheit bildete. Die Scheinwerfer sollten bei Nachtangriffen die Geschütze der Heimatflack unterstützen. In der Regel kamen die Amis am Dienstag und Freitag gegen Mittag über die Alpen in die Reigersfelder Ecke, um die Hermann Görings Werke bis zum Nachmittag zu bombardieren, obwohl die eigentlichen produzierenden Werke längst bombensicher unter der Erde verschwanden; oberirdisch waren nur noch potemkinische Scheinfassaden, aber auch die oberirdischen Gleisanlagen, die von den Amis zerstört wurden.
Als Chef dieses Zuges war er bei einem Bauern in Reigersfeld einquartiert. An einem Samstag im September 1944, mein Vater durfte nach Dienstschluss nach Hause fahren und Sonntag Abend musste er wieder in seinem Quartier in Reigersfeld sein, das telefonisch mit dem Stab der Heimatflack verbunden war.
An diesem Samstag holte meine Mutter und ich unsern Vater in Reigersfeld ab, bewaffnet mit drei Rucksäcken. Wir brachten auf unserm Buckel fast einen dreiviertel Zentner Weizen heim. Ohne diese Schwarzweizenlieferungen wären die Tagesrationen sicher um einiges kleiner ausgefallen und die morgendliche Mehlsuppe viel dünner geraten!
Mit dem Schroten ging das so: Unter der Kellertreppe war ein Fotolabor eingerichtet, das für Fotozwecke nicht mehr genutzt wurde, da es ja kein Filmmaterial etc. gab. Unter der Treppe in dem Kämmerchen war ein stabiler Holztisch, Millimeter genau eingebaut. Auf diesem Tisch wurde eine größere gusseiserne Kaffeemaschine festmontiert. Bis auf die stabile Holztür war alles massiv gemauert, so dass keine Geräusche während des Mahlens nach außen dringen konnten. Angefangen bei Bruder Klaus, der bis zu seiner Einberufung zur Heimatflack, Schwester Käthe, Marianne und ich, haben wir jeder unsere Weizenportion geschrotet und es sah aus, als wenn der Vorrat nie zu Ende gehen wollte; irgendwo wie kam immer etwas Nachschub her. Wir haben bis zum Einmarsch der Roten Arme in Ratibor nicht hungern müssen, aber was die Wurst- und Fleischrationen anbelangt, auch nicht gerade üppig gelebt. Oder, die Fleischportionen am Sonntag und Donnerstag bisschen größer hätten sein können. Wie schon erwähnt, zumal ein selbstgefütterter 1,5 kg schwerer geschlachteter Stallhase zu Mittag für 15 Leute, später für 11 reichen musste.
Zurück zu den Vorweihnachtstagen! Die Pfefferkuchen waren schon gebacken mit selbstgekochten Sirup wie im Vorjahr. Aber für den Weihnachtskuchen langte das Weizenmehl nicht mehr, es müsste noch einiges unter der Kellertreppe geschrotet werden. Also Käthe, Janne und ich, jeden Tag einen Töpfchen; die Kaffeemaschine war auf ganz fein gestellt, feiner als für die morgendliche Mehlsuppe. Für den Weihnachtskuchen sollte möglichst nichts Grobes sein.
Aber der Weihnachtskarpfen, wo bekommen wir den her? Morgen am 23.12. sollte der Weihnachtskuchen gebacken werden und vom Weihnachtskarpfen gab es noch keine Spur. Irgendwie brachte jemand die Kunde, dass es morgen, am 23.12. gegen Mittag in der Hauseinfahrt des Kaffees Residens in Ratibor, Ecke Oberwall-Neue Straße Karpfen geben soll.
Herr Rzytki, ich glaube so hieß der Inhaber des Kaffees Residenz , er hatte in Ottiz einen Karpfenteich, der morgen früh abgefischt werden soll. Gegen Mittag, wenn nichts dazwischen kommt ist er in der Einfahrt. Bald nach dem Frühstück bin ich mit dem Eimer losgezogen, um auch einen großen Karpfen zu bekommen. Ich war zwar nicht der erste, ich glaube das ich der fünfte war und habe meinen Platz tüchtig verteidigt. Und es klappte, ich habe einen gut 3,5 kg schweren Karpfen erwischt, und das ganz ohne Karten, den ich daheim putzte was sonst Mutter immer machte; aber heute mit den Schwestern Kuchen backte. Danach hat Muttern den Karpfen in Portionen zerlegt, eingesalzen und ruhen lassen bis zum nächsten Tag, dem Heiligen Abend. Weihnachten war gerettet, nur fehlte Vater und die zwei ältesten Brüder; wir wussten nur wo Bruder Klaus ist, in Plania bei der Heimatflak, Vater irgendwo in Ostpommern und Bruder Franz, von dem wir keine Ahnung hatten.
Am nächsten Tag, die Weihnachtsvegil, wir hatten wie immer versucht den ganzen Tag zu fasten, um am Abend das „Goldene Kalb“ am Dach zu sehen. Aber wir haben es nie gepackt bis zum dunklen Abend mit dem Fasten durchzuhalten. Irgendwie war die Versuchung doch größer als der Wunsch das Kälbchen auf dem Dach zu sehen, das zu Weihnachten in Bethlehems kalten Stall das Jesuskind mit seinem warmen Atem nicht erfrieren ließ; und wenn es nur ein oder zwei Streusel waren, die wir zum Ärger der Mutter vom Kuchenblech im Keller zupften. Oder es fehlten gerade noch einpaar Minuten zur völligen Dunkelheit. „Schade“, sag ich heute, „dass wir es nicht doch mal durchgehalten haben !“ Es war halt zu schön um wahr zu sein.
Der Heilige Abend war fast wie immer so wunderbar. Der Weihnachtstisch war gedeckt, doch vier Gedecke blieben leer, das des Vaters und der zwei Brüder und der Anuschka. Zur Einleitung des Festessens gab es wieder die gute Erbstrohsuppe, die Mutter immer wieder wunderbar kochte. Und der Weihnachtskarpfen, der schmeckte wie immer, wenn Muttern ihn zurechtmachte mit viel Wurzelzeug und Gewürzen gekocht, Salzkartoffeln, braune Butter und, dreimal dürft ihr raten, das gute Sauerkraut. Zwei Butterstücke, zusammen 1 Pfund haben wir auf den Lebensmittelkarten für dieses Weihnachtsereignis gespart. Und als Nachtisch gab es Trockenobstkompott. Nach der Bescherung, die wieder aus gestrickter Kleidung und aus Gebirgsjägerähnlichen aber dunkelblauen Schildmützen bestand, die wieder Tante Magda fürs Christkind organisierte Für Mutter habe ich damals ein Bildchen gemalt und ein kleines Weihnachtsgedicht mit meiner bald unleserlichen Handschrift geschrieben. Mutter freute sich trotzdem und ich habe ihr fest versprochen mich zu mühen schöner zu schreiben. Die Weihnachtslieder haben wir diesmal fast ohne musikalische Begleitung gesungen; vielleicht weil drei Musikanten fehlten ! Die Kerzen am Weihnachtsbaum, der diesmal etwas kleiner war, waren heuer nicht echte Bienenwachskerzen, sondern ganz normale Wachskerzen. Wer, wie diese Kerzen organisiert hat weiß ich nicht mehr; ganz bestimmt nicht ich! Am 1. Feiertag kam Bruder Klaus am Nachmittag zum Blümchenkaffee, Mohn- und Magerquarkstreuselkuchen. Mutter hatte irgendwie etwas Rindertalg und Vanillebutteraroma für den Kuchen aufgetrieben, schmeckte große Klasse. Vielleicht hatte es wieder geklappt mit einem kleinen Gläschen vom eigenen Bienenhonig ? Tja, worüber haben wir uns so am 1. Weihnachtstag im Beisein unseres Bruders Klaus unterhalten? Zuerst stand Papa und Franz im Vordergrund. Wo mögen sie bloß sein und wie mag es ihnen jetzt gehen? Dürfen sie mal für kurze Zeit den Krieg vergessen und Weihnachten feiern und wie und wo? Auch über das Essen wurde gesprochen. Bei uns gab es am 1. Feiertag zu Mittag gebratenes Kaninchen, das in einem Weckglas eingekocht war. Es war bestimmt nicht zuviel Fleisch, gerade soviel, wie mit Knochen in ein 11/2 Liter Glas hineinging. Hauptsache viel Soße war da, die die Mutter mit gequirlter Schlickermilch verfeinerte. Uns schmeckte sie wie Sahnensoße und dazu polnische Klöße mit Sauerkraut. Polnische Klöße, was war das schon wieder? Die größere Hälfte der Klößeteigmasse bestand aus geriebenen rohen Kartoffel, aus denen in einem Leinenähnlichen Säckchen das Kartofflewasser herausgedrückt wurde. Die sich im Wasser absetzende Stärke wurde der rohen Kartoffelmasse wieder zugegeben. Die zweite Hälfte, etwa die kleinere Hälfte der rohen Kartoffeln, wurden als Pellkartoffeln gekocht, gepellt, zerrieben. Mit ein zwei Eiern und Salz zusammen vermischt. Aus der Teigmasse wurden dann Bällchenähnliche Kugeln geformt, in Weizenmehl gewälzt und im kochenden Salzwasser gekocht. Uns Kindern schmeckten sie besonders, vielleicht, weil es diese Klöße höchstens zweimal im Jahr gab! Weihnachten ging vorüber und Bruder Klaus ließ uns wissen, dass er Sylvester über Nacht heimkommen darf. Mutter hat für den Sylvesterabend von den Fleischmarken für jeden ein Weißwürstchen gekauft und einen billigen Kartoffelsalat gemacht, gewürzt mit etwas Räucherspeck und aus Blaubeersaft ein falschen Punsch, abgeschmeckt mit den letzten Nelken und Zimt, gemacht. Zum Nachtisch gab es Pfefferkuchen. Irgendjemand von den Geschwistern fragte plötzlich nach Anuschka, was sie wohl jetzt machen würde. So verging der Sylvesterabend. Kurz vor Mitternacht fragte Bruder Klaus: „Wollen wir nicht den Schnee draußen ausnützen und das neue Jahr auf Schiern begrüßen?“ Bruder Georg und ich waren einverstanden. Da die Straßen nicht geräumt waren, konnten wir die Schier direkt vor der Haustür anschnallen und ab ging’s die Neugartenstraße herunter, über die Eichendorfstraße, an der Badeanstalt vorbei zum Gondelteich. Hier am Gondelteich fuhren wir die leichtabschüssigen Wiesen zum zugefrorenen Teich. Für mich war er vielleicht der für viele Jahre schönste Sylvesterabend. So einen Sylvesterabend, dieser Art, habe ich wohl nie wieder erlebt. W a r u m ?
Weihnachtsferien wie jetzt gab es nicht. Schon am 28. Dezember 1944 begann wieder der Unterricht, der abgesehen vom Neujahrstag nur noch 9 oder 10 Tage dauerte. Bruder Georg, der auch das Realgymnasium besuchte, hatte im Gegensatz zu mir vormittags Unterricht. Ich weiß es nicht mehr genau; aber ich glaube, es war der 6. Januar. Bruder Georg ging frühmorgens zum Unterricht und war eine Stunde später wieder zu Hause. Er sagte, die Schule sei geschlossen, die Russen seien auf dem Vormarsch! Peng ! Paar Tage später hörte man das Rollen oder Donnern der Kanonen, das immer näher kam. Vermutlich waren es SS-Soldaten, die die Bevölkerung aufforderte die Stadt in geordnetem Zustand zu verlassen. Was darunter zu verstehen ist „geordneter Zustand“ habe ich bis heute nicht erfahren. Ich hatte jetzt viel Zeit und habe viele Stunden an unserem Harmonium gesessen und aus Vaters Orgelbuch, „Weg zum Himmel“, Kirchenlieder gespielt. Es konnte so um den 10. Januar gewesen sein. Ich saß wieder am Harmonium und spielte Kirchenlieder. Plötzlich gab es ein lautes Krachen, die Fensterscheiben splitterten und ein kalter Luftzug erfüllte das Wohnzimmer. Was war passiert? Russische Doppeldecker mit 2 Mann Besatzung warfen Splitterbomben, dessen Trichter am oberen Rand etwa 1 m Durchmesser hatten, der nach unten spitz zuliefen und einen knappen ½ m tief war. Diese Doppeldecker flogen an manchen Stellen so tief über der Troppauer Straße zwischen den Häusern, dass sie mit ihrem Maschinengewehr in die Fenster schossen. Dieses grausige Schauspiel wiederholte sich in den nächsten Tagen, nur dass die Fenster schon kaputt waren. Eines Tages kam Bruder Klaus auf einen „kleinen Sprung“ nach Hause. Er erzählte so beiläufig, dass seine Flakeinheit von Plania zu den Lukawerken weiter nördlich, aber auch in Ratibor, verlegt wurde. Und bei diesem Werk war ein französisches Gefangenenlager, dass nach Westen ausweichen musste. Die abziehenden Franzosen haben unter anderem auch einen intakten Fußball zurückgelassen, den wir haben können. Wir müssten ihn aber selber holen. Die Lukawerke befanden sich östlich der Straße die nach Markowitz führt an der neuen Oder. Von den ehemaligen Lukawerken sieht man heute nichts mehr. Östlich von der ebenbeschriebenen Heimatflak, in Sichtweite, befanden sich einige Vierlingsgeschütze, die von Luftwaffenhelferinnen bedient wurden. Beide Einheiten sollten nicht nur im Luftkampf eingreifen, sondern auch im Bodenkampf.
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zu den Lukawerken, Bruder Georg, auch Kalle gerufen und ich, um den Fußball zu holen. Mutter sah das gar nicht gerne. Als wir da ankamen, hatten die Flakkanoniere gerade die nötigen Handgriffe für ihre kommenden Einsätze immer und immer wieder geübt, wobei laute üble Geräusche aus einem Lautsprecher ertönten. Diese Geräusche sollten die jungen Männer wahrscheinlich an Kampfgetümmel erinnern, um sich im Ernstfall von der Wirklichkeit nicht ablenken zu lassen. Mittags, nach der Vollzugsmeldung, dass alles ordnungsgemäß abgeschlossen sei, durften die jungen Männer zur Mittagspause. Bei dieser Gelegenheit bekamen wir den Fußball, es war tatsächlich ein echter Lederfußball, den wir unser eigen nennen durften. Den Heimweg legten wir fast im Dauerlauf, getrieben von einer unsichtbaren Kraft, zurück. Wir waren kaum über der Schlossbrücke in Richtung Neugarten, erschütterte ein lauter Donnerschlag unsere Umgebung und da wo eben noch die Schlossbrücke stand, befand sich eine riesige Staubwolke. Die Schlossbrücke gab es nicht mehr. Das mit der Sprengung war wohl eine Fehlzündung, denn auf der anderen Oderseite befanden sich nicht nur die eben erwähnten Flakzüge, die jetzt im Erdkampf mit eingreifen sollten, sondern auch einige Militäreinheiten. So verging der Januar. In der letzten Januarwoche wurde es mit dem Kanonendonner wieder etwas lauter. Ganz schlimm war es am letzten Januarsamstag. Ich meine es war der 30.01.45 donnerte es besonders nah. An diesen Samstag Nachmittag kam Bruder Klaus ganz aufgeregt nach Hause. Irgendwie kamen die beiden Flakeinheiten über die Oder. Bruder Klaus bestürmte Mutter, Ratibor sofort zu verlassen, denn in Plania brennen schon die Schornsteine! Mutter ließ sich wirklich dazu überreden, packte jedem sein Ränzlein, hauptsächlich Wäsche zum Wechseln, und ab ging’s in Richtung Ratibor Süd zum Bahnhof.. Der Hauptbahnhof lag schon im Einschussbereich der russischen Artillerie. Opa wollte nicht mit; er wollte das Haus bewachen, damit wenn wir zurückkämen, noch etwas da sei und einer müsse doch die zwei Kaninchen und die Tauben unter der Terrasse versorgen. Er richtete sich in der Waschküche im Keller sein Domizil ein, denn auch oben bei ihm war das Mansardenfenster zerplatzt, in der Waschküche war das Fenster noch bis morgen früh heil. Wir marschierten lautlos durch die Spätnachmittagsdämmerung und sprachen kaum miteinander. Hin und wieder drehte sich einer um und der Umdreher sagte: „Schaut nur wie es dahinten blitzt und donnert!“ Das war kein normales Gewitter, keine Gewitterblitze, dass waren Detonationsblitze und die entsprechende Begleitmusik. Langsam, es war noch immer schneeig glatt, kamen wir am kleinen Bahnhof in Ratibor Süd an. Der diensthabende Eisenbahner, ein Eisenbahner der schon viele Jahre pensioniert war, aber rückdienstverpflichtet wurde sagte uns, dass er nicht wisse ob, wann oder überhaupt noch ein Güterzug vorbeikommt. Er würde uns raten draußen zu warten, denn wenn ein Güterzug vorbei kommt, er bestimmt nicht anhalten wird, wenn keiner draußen steht. Also standen wir draußen am Bahnsteig, warteten und warteten und jeder hing so seinen Gedanken nach. Die Kirchenuhr von der nahen Kirche in Ratibor Süd schlug 12 Uhr Mitternacht. Plötzlich fiel mir etwas wieder ein, was ich sicher nicht geträumt hatte. „Ich ging in der letzten Novemberdekade an einem schulfreien Montag (Montag und Samstag hatten wir immer zu dieser Zeit schulfrei. Warum, habe ich im vorletzten Kapitel beschrieben), in die Stadt; um was und warum weiß ich heute nicht mehr. Es war ziemlich neblig und so um die 0 Grad. Ich ging diesmal nicht auf der Troppauerstraße sondern auf der Paralellstraße, der Verlängerung der Neugartenstraße zwischen Gondelteich und Badeanstalt. Hinter der Badeanstalt, schräg gegenüber vom Gondelteich war eine größere Wiese, tiefergelegen als die Straße und hinter dieser Wiese auf der rechten Seite standen zwei längliche Häuser mit Giebeldach und einstöckig, kurz vor der Gärtnerei Müller, die sich wiederum gegenüber vom Krankenhaus befand.
Kurz vor diesen zwei länglichen Häusern meinte ich eine innere Stimme zu hören, die mir sagte: „Ihr kommt wieder zurück, wenn hier Gras wächst!“ Dieser Satz ging mir damals auf dem Bahnsteig immer wieder durch den Kopf und half die fröstelnde Nacht irgendwie erträglicher zu machen. Anfangen konnte ich damals mit diesem Satz nicht viel, obwohl er mich bei unserem ersten Besuch 1980, als wir das erste Mal nach Ratibor in unsere Heimat fuhren, und Lydia und ich diesen eben beschriebenen Weg gingen, er mir immer wieder durch den Kopf ging. Später, als ich mich mit der Geschichte mehr und mehr auseinander setzte, glaubte ich den Gedanken, den mir meine innere Stimme damals sagte, sich nicht auf Jahre bezog, sondern Generationen dauern kann. Warum? Während der Völkerwanderung im 2.+ 3. Jahrhundert übernahmen die aus dem Osten kommenden Slawen intakte germanische Siedlungen, mit denen sie nicht viel anzufangen wussten. Sie lebten in den Holzhütten, bis sie auseinander fielen. Von Instandhaltung der Wohnhütten, Umgang mit den damaligen primitiven Arbeitsmaterialien, geregeltem Ackerbau und Viehzucht verstanden sie nicht viel. Sie lebten gerade von dem was draußen während der Wachstumszeit wuchs und in der kalten Jahreszeit von Fischen und allem was im Wasser ohne ihr Zutun herauszuholen war.
Woher ich das weiß ? Ich hatte ein interessantes Buch vom Pfarrer Knotek, der Presberger Pfarrer, der auch in meiner Presberger Schule den Kathechismus- unterricht erteilte. Dieses Buch hieß ‚Die Vita der heiligen Hedwig’, herausgegeben vom Erzbistum Berlin, dessen Sitz in Ostberlin ist und war und noch zu DDR-Zeiten erschien. Die schlesischen Ortsnamen wurden in diesem Buch alle nicht mit ihren deutschen Namen in deutscher Sprache geschrieben, sondern zwangsweise mit ihren polnischen Namen in der heutigen polnischen Schreibung. Besonders interessant ist der Abschnitt, in dem die ersten Lebensjahre der hl. Hedwig auf der Breslauer Burg beschrieben werden. Da heißt es: „Mit Widerwillen aß ich das was auf dem Tisch serviert wurde, nicht weil es unappetitlich war oder nicht geschmeckt hat, sondern weil ich wusste, dass das, was mir auf dem Tisch vorgesetzt wurde, nicht in der Burgküche gekocht, sondern aus der nächsten Kate, irgendwo an der Oder den Menschen weggenommen, manchmal regelrecht vom Tisch. Und dieses Essen wurde, wie eben beschrieben aus dem hergerichtet, was gerade die Natur hergab, im Sommer wilde Pflanzen und Körner, im Winter die Fische, Krebse und Frösche,“ was sie, die Slawen gerade habhaft werden konnten. Der hl. Hedwig gelang es mit Zustimmung ihres Gemahls, Heinrich dem Frommen, Siedler aus Deutschland zu holen: Landwirte aus den Flusstälern, Handwerker aus den Städten und Bergleute aus dem Harz. Alle drei Stände haben das Herzogtum Breslau sehr reich gemacht. Die Bergleute haben in Goldberg, einer Niederschlesischen Ortschaft Gold, ähnlich wie in Südafrika, regelrecht in der Erde, bergbaumäßig, abgebaut. Heute heißt dieser Ort Zlotoria, früher Goldberg und ist eine Stadt. Die beiden anderen Stände, Bauern und Handwerker versorgten sich gegenseitig und lebten nach dem Magdeburger Recht. Der Herr bekam den 10. Teil von allem was im Jahr erwirtschaftet wurde. Waren die Untertanen fleißig, waren die 90 % die ihnen verblieben viel, aber auch die 10 %, die der Herr von allem bekam, waren für den Herrn sehr viel; jedenfalls so viel, dass das Herzogtum Breslau bald das führende Herzogtum, nicht nur in Schlesien, sondern weit bis nach Polen hinein wurde. Bisschen später haben das Herzogtum Oppeln und Ratibor nachgezogen und Siedler und Handwerker aus dem Westen in ihre Gebiete geholt. Nur sie hatten keine Stadt, die Goldberg hieß und das schwarze Gold war damals noch nicht bekannt. Eine Ausnahme bildet Ratibor. Ratibor war eine urdeutsche Siedlung die schon im 11. Jahrhundert bestand, urdeutsch und so wohlhabend und nie anders hieß als Radibor oder Ratibor, dass der Herzog von Ratibor im 13. Jahrhundert nach der Rückführung von Kaiser Barbarossa aus Altenburg im Osten Mitteldeutschland nach Schlesien zu seiner Hauptstadt erkoren hat. Barbarossa hat Polen gezwungen auf ewige Zeiten auf Schlesien zu verzichten. Die von Barbarossa nach Schlesien zurückgeführte Piasten Familie hatte drei Söhne. Und Schlesien wurde dementsprechend unter diesen drei Söhnen aufgeteilt. Angeblich hat auch Auschwitz damals zu Oberschlesien/Ratibor gehört. Der Piasten Sohn, der Oberschlesien zugeteilt bekam, machte Ratibor, vermutlich wegen seines geregelten Wohlstands, zu seiner Hauptstadt, denn der Zehnte, der an ihn entrichtet wurde war nicht gering. Ab Ende des 13. Jahrhunderts kamen immer mehr Slawen aus der umliegenden Gegend, angelockt durch den Wohlstand der Stadt, in die Stadt. Doch durch den Zuzug der Slawen mehrte sich der Wohlstand nicht. Je mehr Slawen zuzogen, um so schlechter ging es der Stadt. Die Urkunden des Herzogs von Ratibor die er der Stadt zukommen ließ waren noch ca. 1415 in deutscher Sprache geschrieben. Danach in böhmischer. Dementsprechend war auch der 10., der dem Herzog entrichtet werden musste, immer geringer. Er war Ende des 15. Jahrhunderts so gering, dass der Herzog in Existensschwierigkeiten geriet. Die Einnahmen waren so gering, dass er bei Nacht und Nebel Menschen, die nach Geld aussahen einfach entführen ließ und die Angehörigen durch ein hohes Lösegeld sie frei kaufen konnten. Erst als die zugezogenen Neubürger lernten, dass man vom Mundraub = fischen bei Nacht und Nebel in der Oder oder der Pschinna, Betteln, ernten bei Nacht und Nebel und Gelegenheitshandgriffen allein nicht gut leben kann, versuchten sie das eine oder andere zu lernen und einer geregelten Arbeit nachzugehen. Bei einigen war es in der dritten Generation so weit, bei anderen erst in der vierten oder fünften. Nachlesen kann man das eben geschriebene in „Geschichte Ratibor“ bei Dr. Welzel, seinerseits Pfarrer in Tworkau.
Aber zurück zum Bahnsteig am Bahnhof in Ratibor Süd. Abwechselnd gingen wir in den kleinen Wartesaal im Bahnhof, um nicht zu erfrieren, obwohl es da drinnen auch nicht viel Wärmer als draußen war. Es konnte so gegen 5 Uhr morgens sein; irgendeiner meiner Geschwister, ich weiß nicht mehr wer es war, sagte ziemlich laut: „Lasst uns wieder heimgehen. Ihr seht ja, dass das Blitzen da hinten nachgelassen hat.“ Bald waren es 3 und vier Stimmen, die da fürs Heimgehen waren. Da hörte ich wieder meine innere Stimme, die mich regelrecht schreien ließ: „Nein, nicht heimgehen, nicht heimgehen, ich will leben, ich will leben!“ Wie Recht ich hatte mit meinem Schrei haben wir etwa 5 Wochen später erfahren, als wir aus Wernersdorf zurückkamen. Dazu später mehr! Es konnte zwischen 6 und 7 Uhr gewesen sein. Ich wartete draußen am Bahnsteig und hörte, dass ein Zug sich näherte. Noch bevor ich schreien konnte dass ein Zug kommt, kamen die restlichen Sobottaner aus dem Wartesaal auf den Bahnsteig, vermutlich hat der diensthabende Eisenbahner telefonisch mitgeteilt bekommen dass ein Güterzug den Bahnhof passieren wird. Jedenfalls hielt der Güterzug, wir konnten in einem Güterwagen einsteigen und ab ging die Fahrt. Wir saßen im Güterwagen auf dem Boden und wussten nicht in welche Richtung wohin wir fuhren. Normalerweise führte die Strecke nach Katscher. Irgendwann hielt der Zug; durch die Ritze des Güterwagenfensters konnte man sehen, dass es schon dämmerte. Unsere Wagentür wurde geöffnet und wir mussten aussteigen. Man sagte uns wir wären in Bauerwitz. Und auf die Frage wohin wir wollten sagte Mutter wohl weil ihr nichts Besseres einfiel: „Nach Wernersdorf bei Leobschütz.“ Da lebte eine Cousine der Mutter, die mit einem Studienkollegen meines Vaters verheiratet war und in Wernersdorf Lehrer an einer einklassigen Volksschule war.
„Nach Wernersdorf wiederholte der Eisenbahner, nach Wernersdorf, da habt ihr aber Glück, heute Nachmittag fährt von Bauerwitz ein Zug in Richtung Leobschütz und weiter, und wenn ihr brav seid“, sagte er augenzwinkernd zu uns Kindern, „nimmt er euch mit und lässt euch in Wernersdorf aussteigen.“ An Essen hat keiner gedacht, nur hundsmüde waren wir. Ich weiß noch, Mutter saß auf einem Stuhl im doch recht behaglichen Wartesaal, und an ihre Beine angelehnt schliefen wir am Boden sitzend, ich und alle nach mir kommenden Geschwister. Ob Mutter während dieser paar Stunden ein Auge zubekommen hat, ich glaube nicht. Sie hat, wie eine Mutter eben ist, über ihren Kindern gewacht. Am frühen Nachmittag wurden wir geweckt. Es hieß, der versprochen Zug kommt und nimmt uns mit nach Wernersdorf. So geschah es auch. Der Wernersdorfer Bahnhof lag etwas außerhalb des Ortes und wir dann ungefähr 20 Minuten bis zur Dorfmitte laufen mussten. Tante Martel war nicht wenig erstaunt als wir neun Persönchen vor der Tür standen; Marta Jeschke war schon zu Beginn der 2. Januardekade mit den Ratiborern getürmt.
Die Lehrerwohnung war sehr geräumig, größer als die Lehrerwohnung in der einklassigen Volksschule in Espenschied. Auch das Klassenzimmer in Wernersdorf war etwas geräumiger. Die Stimmung bei Tante Martel war nicht die beste, überhaupt in der ganzen Familie. Bald erfuhren wir warum, was passiert war. Onkel Viehweger war aufgrund seiner Verletzungen aus dem 1. Weltkrieg nicht Kv geschrieben und deswegen nicht eingezogen. Da auch von Wernersdorf die Front nicht allzu weit schien, mussten die Wernersdorfer Großväter ihren Dienst im heimatlichen Volkssturm ausüben, der daraus bestand, dass sie mit dem geladenen Karabiner im Dorf patrouillieren mussten. Am Ende ihres Rundgangs brachten sie das Gewehr in die Schule, machten Meldung über eventuelle oder keine Vorfälle, stellten das Gewehr in den ausgeräumten Schulschrank , versicherten, dass es ordnungsgemäß entladen und die Munition in der Munitionskiste verwahrt ist. So auch vor einer Woche. Die Gewehre waren wohl im Klassenschrank. Klassenschrank und Klassenzimmer waren aber nicht abgeschlossen. Und so eine kinderleere aber noch komplett eingerichtete Schulklasse war doch der idealste Spielplatz, wenn es draußen wettermäßig nicht sehr einladend war, so auch vergangene Woche. Ein „Volkssturmler“, der seinen Patrouilliergang beendet hat, stellte die Knarre in den Schrank und versicherte dem Onkel, dass sie nicht geladen sei. Es dauerte gar nicht lange, und Günter und seine Geschwister spielten in der Klasse. Günter, der älteste Sohn der Familie Viehweger ging an den Schrank, holte eines der abgestellte Gewehre aus dem Schrank und zielte auf seine jüngere Schwester Maria und sagte zu ihr: „Was würdest du machen, wenn ich jetzt abdrücke?“ Maria lachte und sagte: „Drück doch ab, es ist doch nicht geladen!“ Günter drückte ab und es knallte fürchterlich, wie es eben knallt in einem geschlossenen Raum. Tante Martel kam nach dem lauten Knall ins Klassenzimmer gelaufen; auf der Erde lag Maria und hinter ihr der jüngste Bruder . Da Günter auf die kleinere Schwester von oben zielte, durchschlug die Kugel ihren Hals und Wirbelsäulenpartie, fast ein Genickschuss von vorne und dem hinter ihr stehenden kleinen Bruder einen Durchschuss durch das Gehirn, auch von oben nach unten. Beide waren auf der Stelle tot. Wer war hier schuld? Mit einer Kugel wurden zwei junge Menschenleben so mal „zwischendurch“ ausgelöscht.
Ich war bestimmt als Kind ein hässlicher Vogel im Gegensatz zu Maria. Warum? Ich war mit meinem Vater des öfteren in Wernersdorf. Auf der Rückfahrt hat Vater fast immer bisschen Weizen im Rucksack heimgebracht, den Onkel Viehweger in Wernersdorf organisiert hat. Bei diesen Besuchen kam ich mit Maria prima zurecht, was ich von den Mädchen auf der Neugartenstraße in Ratibor nicht sagen konnte, ausgenommen von der Juta Schwirz, die 1944 an Diphtherie starb. Auf der anderen Seite kann man auch sagen: „Lieber Gott, was hast du diesen Kindern vielleicht alles erspart ?“ Mutter, Käthe und Janne halfen tüchtig im Haushalt bei Tante Martel mit. Wir beide, Kalle (gleich Bruder Georg) und ich erkundigten mit Günter und einigen Wernersdorfern die Umgebung, bewunderten die Soldateneinheiten, auch junge SS-Einheiten, die auf dem Marsch an die Front in Wernersdorf Rast machten. Mir gingen damals schon so komische Gefühle durch den Bauch, als ich die jungen Soldaten da sah, von denen die meisten nicht älter waren als Bruder Franz. Von zuhause kannte ich den Begriff „Kanonenfutter“. Sollten diese halbwüchsigen Männer auch nur noch Kanonenfutter für die Bonzen sein, die im Berliner Reichstagsbunker nicht krepieren wollten und wenn, es die letzten sein wollten, die sterben mussten an ihrem Größenwahn!
Der Februar wurde immer angenehmer, was das Wetter anbetrifft. Irgendwoher hat Günter einen Fußball aufgetrieben und wir durften hinter Bauer Puschkes Scheune auf der Wiese spielen. Das Wetter war so angenehm und tagsüber so warm, dass wir bar Fuß und nur im Dresshemd, fast oberkörperfrei spielten. Eines Tages hielt eine kleine Einheit im Dorf. Sie führte auch einige Wagen mit sich, die von panjeähnlichen Pferden gezogen wurden. An einem der Wagen war hinten ein Pferd angebunden, dass unten an den Vorderbeinen, im unteren Bereich, verletzt war. Wir Kinder kamen mit den Soldaten, die auf dem Weg nach Leobschütz waren, also weg von der Front ins Gespräch. Ich fragte den Soldat was mit den hinten angebunden Pferd passieren soll? Er fragte uns etwas scherzhaft, warum wir fragen, ob wir es etwa verwursteln wollen. Wir merkten bald, dass das Pferdchen recht zahm war und antworteten ihm „Jain“. „Und wo wollt ihr es bis dahin unterbringen, doch nicht etwa bei Mutti, die auch so allein ist?“ fragt er. Im Moment wussten wir keine richtigere Antwort, als ihm zu sagen, dass bei Mutti im Schlafzimmer zur Zeit kein Platz sei, denn da schlafen wir. Aber Günter, unser Großcousin hatte die richtige Antwort parat: „Wir bringen das Pferd bei Bauer Puschke unter und pflegen es gesund, tja und dann haben wir ein eigenes Reitpferd!“ Bauer Puschke fiel im ersten Moment aus allen Wolken, als wir da ankamen. Offensichtlich wollte er kein Spielverderber sein, der auch icht mehr an den Endsieg geglaubt hat, denn für die Landwirtschaft war dieses Dreiviertelpony zu nichts zu gebrauchen. Auf der anderen Seite ahnte er wohl, dass dieses Pferdchen nichts mehr kaputtmachen kann, denn die Front kam auch Wernersdorf immer näher.
Jedenfalls wuschen wir unter Aufsicht von Herrn Puschke am Spätnachmittag die Wunden unseres Pferdchens mit Sagrotanwasser. Trotzdem waren am nächsten Tag einige Verletzungen mit dicken Eiterblasen versehen, die Bauer Puschke , als wir nach dem Frühstück beim Pferdchen auftauchten mit seinem Messer aufschnitt. Es hat Hansi beim Öffnen der Eiterblasen sicherlich keinen Schmerz bereitet; beim anschließenden Waschen mit Sagrotanwasser zuckte es schon zusammen. Bauer Puschke sagte uns jeden Tag mit vollem Ernst, dass wir dem Hansi, so haben wir es getauft nur ein zwei Hände Hafer früh und abends geben sollten, ansonsten langt das Heu und das Wasser. Wenn es wieder laufen kann, dürft ihr ihm mehr Hafer geben. Warum wir ihm nur jeweils zwei Hände Hafer geben sollten sagte Bauer Puschke uns nicht. Heute weiß ich es. Hafer gibt den Pferden ungemeine Kraft die unser genesender Hansi in der Fülle nicht gebraucht hat, um übermütig zu werden.
Es konnten so zwei weitere Tage vergangen sein, nach dem Frühstück gingen wir zu Hansi. Die Wunden an den Füßen sahen recht gut aus und Bauer Puschke war nicht zusehen. Die Sonne schien vom fast blauen Himmel und die Temperaturen waren für einen Februar recht angenehm. Wir banden ihm einen Strick um den Hals und führten ihn hinaus auf den Hof. Kaum war Hansi draußen an der Luft, blieb er stehen, schnupperte mit erhobenen Nüstern ob die Luft da draußen auch so sicher ist wie im Stall und ging dann mit uns durch die Scheune auf die dahinter liegende Wiese, die wir bisher als unseren Bolzplatz genutzt haben. Jeder durfte nun Hansi am Strick halten und mit Ihm eine Runde um die Wiese drehen. Günter, Tante Martels ältester Sohn, unser Cousin 2. Grades war der Älteste in der Klicke und meinte, er dürfe als erster auf dem Rücken von Hansi sitzen. Nur klappte es so gar nicht ohne üblicher Hilfe, Sattel und Steigbügel, auf den Rücken von Hansi zu gelangen. Meine gefalteten Hände haben den Steigbügel ersetzt und Bruder Kalle half mit beiden Händen seinen Po in die richtige Höhe zu drücken. Nach mehreren Versuchen saß er auf Hansis Rücken. Während dieser Aufsteigeprozedur stand Hansi ganz ruhig, so als ob er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hätte als ein Spielzeug für heranwachsende Jugendliche zu sein. Er drehte auf Hansis Rücken, von uns geführt, eine Runde nach der anderen. Die Glocke der Wernersdorfer Kirche läutete 12 Uhr mittags und Günter saß noch immer auf dem Rücken von Hansi. Wir waren so tief in das Geschehen vertieft, dass wir gar nicht merkten, dass Bauer Puschke unser Tun beobachtete. Gegen halb Eins rief er zu unserem Schrecken, dass wir so langsam Pause machen können, Hansi habe bestimmt Hunger. Also führten wir Hansi mit seinem Reiter Günter in den Stall. Bauer Puschke führte seine Hand über den Hals und den Rücken und sagte zufrieden: „Ihr habt Hansi nicht überfordert; ihr dürft ihm zu Mittag auch drei Hände Hafer geben, wenn ihr am Nachmittag ihn auch auf der Wiese spazieren führt. Bald nach dem Mittagessen waren wir drei wieder bei Hansi im Stall. Wir meinten Hansi habe schon auf uns gewartet. Glücklich führten wir ihn aus dem Stall durch die Scheune auf die dahinter liegende Wiese. Jetzt durfte ich mit Günters und Kalles Hilfe auf Hansis Rücken. Günter und Kalle führten es wie am Vormittag am Strick. Nach etwa zwölf Runden stieg ich ab und Bruder Kalle wurde auf Hansis Rücken gehievt. Günter führte Hansi, während ich im Hof ein stärkeres Kaliber von Pferd führen durfte. Bei Bauer Puschke arbeiteten zwei Ukrainer als Knechte. Der ältere war bisschen von gedrungener Statue und nicht zu groß geraten, aber recht gutmütig. Er kam zu uns und fragte mich, der gerade den Zuschauer spielte, ob ich mit Max im Hof spazieren wollte? Ich nickte und ging mit ihm in den Hof zum Pferdestall. Max war ein knapp zweijähriger Hengst, der vor ein paar Tagen sterilisiert wurde. Max war mit seiner fast zwei Meter Stockhöhe um vieles höher als ich kleiner Knirps. Und da kam Max aus dem Stall und man sah auf dem ersten Blick was für ein stolzer Kerl er im Gegensatz zu unserem fast kleinen Hansi war. Der Knecht gab mir die Leine in die Hand und schärfte mir noch ein, dass ich ihn ja ganz fest halten soll und er mir nicht abhaut. Ich kleines Wichtelchen kam mir furchtbar stolz vor als ich dieses große Prachtexemplar an der Leine führen durfte. Ich hab schon bestimmt fünf oder sechs Runden um den länglichen Misthaufen im Hof gedreht, immer ehrfurchtvollen Abstand zu Max gehalten; hautnah wie bei Hansi habe ich es bei Max nicht gewagt. Irgend was muss der Knecht, der an einer Ecke beim Misthaufen an einem Wagen etwas reparierte gemacht haben. Was habe ich bis heute nicht erfahren. Plötzlich wie von der Tarantel gebissen setzte Max zum Sprung an und diagonal, quer durch den Misthaufen an die andere Ecke. Wie sagte doch der Knecht bevor er mir Max übergab. „Und immer festhalten, dass er nicht abhaut!“ So tat ich es auch. Für den kräftigen Max war’s kein Problem mich durch den Misthaufen zu ziehen. Gemäß der Devise, immer festhalten, landete ich an der anderen Ecke des Misthaufens in einer Jauchenpfütze. Max blieb ganz ruhig stehen, als genösse er es das Bild. Ich sah und roch mehr nach Mist und Jauche als nach einem Menschenkind. Der Knecht schüttelte sich vor Lachen und lachte Tränen, als er das erbärmliche Bild, der erhabene Max und mich armseliges Bündel vor dem Pferdestalleingang sah. Ich war trotzdem stolz, dass ich bei all dem Mist die Leine fest in der Hand hielt. Ich ging nicht mehr zu den andern auf die Wiese, sondern zur Mama, die mich gleich in den Keller in die Waschküche verfrachtete. Nicht nur die mistverschmutzten Klamotten, auch ich wurde eingeweicht und geschrubbt. Da ich die Sonntagsklamotten nicht anziehen durfte musste ich in den Schlafanzug und der Tag war für heute für mich gelaufen. Hansi haben die Wernersdorfer Buben und Kalle für heute versorgt.
Am nächsten Morgen waren die gestern gewaschenen Klamotten trocken und ich konnte mit Günter und Kalle nach dem Frühstück rüber zu Hansi gehen. Nach der üblichen Fütterungs- und Putzprozedur führten wir Hansi wieder auf die Wiese und es dauerte nicht lange und es waren etliche gleichartige Wernersdofer Jugendliche dabei und jeder wollte natürlich auch auf dem Rücken des Pferdes sitzen; dementsprechend waren die Runden, die jeder einzelne noch reiten durfte immer weniger. Als wir mittags mit Hansi wieder in den Stall kamen, kam Bauer Puschke mit einem großen Lappen in den Stall und meinte wir müssten Hansi nach dem Ausflug feste putzen; dass würde Ihm sehr gut tun. Beim Putzen war die Begeisterung der anwesenden Buben nicht so groß wie beim Reiten. Wir durfte Hansi zu Mittag sogar vier Hände Hafer geben. Als wir drei nach dem Mittagessen beim Bauern auftauchten, brachte er uns ein komplettes Halfter mit Gebissstange und kurzer Leine. Er zeigte uns, ich glaube es war dreimal, wie man es Hansi anmachte. Nach etlichen Versuchen hat Günter und ich es gepackt. Von nun musste keiner mehr Hansi am kurzen Strick um den Hals herumführen. Bauer Puschke stand eine Weile auf der Wiese und schaute uns zu wie das mit der Reiterei so klappte und wie immer mehr Buben aus dem Dorf sich zugesellten. Er ermahnte uns noch, es jetzt mit der Reiterei nicht zu doll zu treiben. Er möchte nicht das da was passiert und er der Schuldige sei. Mich nahm er gleich mit. Ich durfte wieder mit Max im Hof spazieren gehen. Diesmal drehte ich die Runden nicht mehr direkt neben dem Misthaufen, sondern in der anderen Hofhälfte. Auch war der Abstand zu Max nicht mehr so respektvoll, aber gestreichelt habe ich ihn noch nicht. Der Respekt zu ihm war doch noch bewunderungsvoll. Diesmal, ohne Zwischenfall, habe ich Max zu seinem Stall geführt, wo ihn Bauer Puschke in Empfang nahm und in seinen Stall brachte. So vergingen die Tage mit Hansi am Vormittag und Max am Nachmittag; das Spazieren gehen mit ihm wurde täglich etwas länger. Eines nachmittags, es konnte der 26. oder 27. Februar gewesen sein, fragte der Bauer mich beim Spazieren gehen mit Max, ob ich morgen Nachmittag mit ihm nach Bauerwitz mit dem Pferdewagen mitfahren möchte. Er müsse bei der Raiffeisen Futtermittel holen. Ich war sofort einverstanden. Auch Mutter hatte nichts dagegen. Am nächsten Vormittag, die übliche Prozedur: Frühstücken, Hansi abrubbeln mit dem Lappen und mit der Bürste ausputzen. Dabei hat Hansi seinen Hafer, heute waren es fast fünf Hände, und das Heu gefrühstückt und das Wasser getrunken. Nach seinem Frühstück bekam er das Halfter angepasst. Ich durfte als erster reiten, denn es war an den letzten Nachmittagen so üblich, dass ich Max im Hof spazieren führen durfte. Dass ich heute Nachmittag mit dem Bauern nach Bauerwitz auf dem Pferdewagen fahren durfte, wusste vermutlich außer dem Bauern, der Bäuerin, mir und meiner Mutter keiner. Als wir mittags mit Hansi in den Stall kamen, mussten die andern Hansi allein versorgen. Bauer Puschke hat mich gleich in die Küche mitgenommen. Da stand eine große Pfanne Rühreier, ein Topf Kartoffeln und Sauerkaut, alles zum Sattessen. Soviel Rührei mit Räucherspeck hatte ich bis dahin in meinem ganzen Leben zusammen noch nicht gegessen, wenn ich so denk an die Rühreierchen daheim. Auch die beiden Ukrainischen Knechte saßen am Tisch und haben tüchtig mitgegessen. Während ich bei Puschkes zu Mittag aß, haben die Wernersdorfer Buben Hansi allein versorgt. Günter musste heute um 12 Uhr die Kirchenglocke läuten. Nach dem Essen haben die Knechte einen Platowagen mit vier Gummirädern mit zwei vor Kraft protzenden Pferden bespannt.. Mit lautem Peitschenknall lenkte der Bauer das Gespann aus dem Hof. Dann durfte ich weiter den Kutscher spielen! Ich glaube, dass die Pferde mehr auf die Geräusche des Bauern reagierten als auf die Leine, die ich in der Hand hielt und auf meine Zurufe. Jedenfalls kamen wir ohne Schwierigkeiten in Bauerwitz an. Der Bauer hatte noch an drei vier Stellen etwas zu erledigen, bevor wir in das Raiffeisenlager gelangten. Ich durfte mit den Pferden auf einen Abstellplatz im Hof fahren, heute würde man Parkplatz dazu sagen, um die Futtermittel zu orten. Er war schon eine ganze Weile drinnen. Doch, was waren das eben für Geräusche? Die kamen mir irgendwie bekannt vor. Die hab’ ich doch schon mal wo gehört und die waren bestimmt nicht ohne!! Da, jetzt hört man es ganz deutlich. Das waren doch die fliegenden Nähmaschinen, wie wir die russischen Doppeldecker mit zwei Mann Besatzung nannten, die ohne Bedachung darin saßen. Diese Doppeldecker hatten ihren Flugplatz bald hinter der Front, auf einer Wiese, flogen in Haushöhe, warfen kleine Splitterbomben ab, dessen Trichter etwa einen Meter Durchmesser hatte und ca. ¾ Meter tief war. Das Gefährliche war, dass sie bei breiteren Straßen so tief flogen, dass sie in die Fenster gucken konnten und auch mit ihren Maschinengewehr da hineinschossen. Die Soldaten saßen hintereinander.
Da, das gleiche Krachen, die gleichen Detonationen wie damals in der ersten Januardekade, als beim Harmonium spielen die Fenster vom Luftdruck platzten. Von diesem Detonationslärm und dem lautern Rattern der Nähmaschinen aufgeschreckt rasten die Pferde los in Richtung Landstraße ins freie Feld. Da flogen sie links neben mir, in Straßenkirschbaumhöhe, vielleicht 7 oder 8 Meter entfernt, gaben Gas und knatterten mit ihren Maschinengewehren, nicht auf uns, sondern so in die Luft, um die Pferde noch wilder zu machen. Ich sah wie die im Doppeldecker sich schüttelten vor Lachen. Und je mehr „Brrrrrr“ ich schrie und an der Leine zog, um so mehr mühten sich die Pferde aus dieser Gefahrenzone herauszukommen. Gott sei Dank! Bei dieser verringerten Geschwindigkeit hatte der Pilot seine Mühe, die fliegende Nähmaschine, andere nannten sie die fliegende Mähmaschine wegen der geringen Geschwindigkeit, auf der Höhe zu halten. Sie gaben Gas und flogen davon. Die beiden russischen Piloten hatten so ihren Spaß, die Pferde und ich ihre Angst. Ich weiß nicht wie weit ich schon von Bauerwitz weg war. Jedenfalls gelang es mir die Pferde zum Stehen zu bringen, zu wenden und den Gleichen Weg zurückzufahren. Der Bauer und die übrigen Mitarbeiter warteten ängstlich auf mich und waren riesig froh, dass weiter nichts passiert ist. Es war schon dunkel als wir mit den Futtermitteln aus dem Hof des Lagers fuhren. Schweigend hörte der Bauer zu als ich ihm alles das erzählte was vorgefallen ist, auch die Ratiborer Januarerlebnisse mit diesen Nähmaschinen. Er hörte schweigend zu und dachte sicherlich auch, wozu dieser sinnlose Krieg. Er hatte zwei Söhne, beide irgendwo an der Front. Tochter Monika, eine sehr hübsche junge Frau, vielleicht 18 oder 19 Jahre alt war daheim. Wenn wir, Günter und ich sie sahen, haben wir oft das Lied: „Lebe wohl du kleine Monika“, gesungen. Dabei huschte, so meinten wir, ein leichtes errötendes Lächeln über ihr hübsches Gesicht und es verfärbte sich leicht, manchmal mehr, manchmal weniger. Vielleicht war das auch nur Einbildung bei uns, oder Möchtegerngehabe !
Und zurück zum Bauerwitzer Zwischenfall. Ich habe es den beiden russischen Fliegern hoch angerechnet, dass sie mit ihrem Maschinengewehr nur in die Luft geschossen und nicht auf die Pferde und mich.
Die Heimfahrt verlief ohne irgendwelche Zwischenfälle. Im Hof in Wernersdorf angekommen rangierte Bauer Puschke den Wagen vor das Futtermittellager und ich ging erst jetzt zu den Pferden, streichelte sie und klopfte ihnen dankbar an den Hals. Ich glaube dass die Pferde mich verstanden hatten, denn sie nickten mit dem Kopf beim Liebkosen. Die Knechte und der Bauer lagerten die Futtermittel im Futterdepot und kamen in die Küche, wo es eine deftige Abendmahlzeit gab. Von dem Tag an hatte ich bei Puschkes einen Stein im Brett, sie waren fast wie Großeltern zu mir. Mutter daheim war sehr erschrocken, als ich ihr mein heutiges Erlebnis in Bauerwitz erzählte. Ich versuchte sie zu beruhigen und fragte sie ob sie sich noch erinnern könne als ich am Bahnsteig in Ratibor Süd gerufen habe: „Ich will leben!“ Siehst du, heute hat der liebe Gott es wieder wahr werden lassen. Mein Schutzengel hat das Maschinengewehr der russischen Soldateska in eine andere Richtung gelenkt, als sie geschossen haben.“ Beim Abendgebet habe ich meinem Schutzengel sehr gedankt dass er heute so fürsorglich über mich gewacht hat und die Schutzengel der Familie Puschke gebeten auch über ihnen zu wachen und sie zu beschützen.
Vielleicht noch etwas zur Verpflegung in Wernersdorf! Lebensmittelkarten haben wir keine von Ratibor mitgebracht. In den Geschäften in unseren Breiten gab es sowie so nichts mehr und überhaupt, ich glaube für den Monat Januar hatten wir überhaupt keine Lebensmittelkarten mehr bekommen. Und trotzdem wurden wir bei Tante Martel mehr als gut versorgt. Zu der Mehlsuppe allmorgendlich gab es auch mit Hausmacherwurst belegte Brote. Woher kam der himmlische Segen?
Früher gehörte zu den ländlichen Schulgemeinden oder den Schulen auf dem Lande einige Acker- und Wiesengrundstücke, die dem Schulleiter zur Verfügung standen; denn noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Schullehrer nebenberuflich Bauersmann und wurde hauptsächlich mit Naturalien bezahlt. Auch Hauptlehrer Garus in Zabelkau hatte einen Kuhstall und eine kleine Scheune am südlichen Rande des Schulhofes, die er aber in den dreißiger Jahren nicht mehr benutzte. Er war nur Lehrer, die Schuldner = Bauern, bearbeiteten die Schulgrundstücke in Pacht. Die Pachtgebühr ging zunächst noch an den Schulleiter, die bar oder in Naturalien erfolgte. So auch in Wernersdorf. Onkel Viehweger spielte keinen Bauer mehr. Die Felder bewirtschaftete ein Bauer in Pacht aus dem Dorf. Die Pacht in Naturalien bekam er in Getreide und Kartoffeln. Normaler weise wurden die Naturalien von den Lebensmittelkarten abgezogen, aber dem Pächter gelang es immer wieder ein bisschen mehr von allem zu liefern, als auf dem Papier stand. Es blieb soviel übrig von den Naturalien, dass ein Schwein fettgefüttert, dass aber bei der Kontrolle immer weniger wog als tatsächlich, so dass die Fleischmarken nicht zu sehr gekürzt wurden. Der eine oder andere Sack Getreide konnte auch so zusätzlich in der Mühle zu Mehl gemahlen werden, „auch zusätzlich“ zu den Brotmarken, die es ja jetzt nicht mehr gab. Jedenfalls reichte das und nicht zu knapp, was noch da war, 9 Ratiborer und 5 Wernersdorfer Mäuler täglich zu stopfen. Ich hoffe, das der liebe Gott den Viehwegern all das vergolten hat, was wir da erleben durften! Auf der anderen Seite, wenn wir nicht mitgeholfen hätten, die Vorräte konnten sie nicht mit nehmen bei ihrer Flucht aus Wernersdorf. Sie wären den Russen in die Hände gefallen. Die Tage vergingen. Wir waren schon im Monat März und der Kanonendonner kam immer näher nach Wernersdorf. Da tauchte in der Schule in Wernersdorf ein Goldfasan (Nazi in SA_Uniform) auf, der uns überredete in Richtung Westen zu fahren, um nicht den Russen in die Hände zu fallen. Mutter und Tante Martel vertrösteten ihn noch auf ein zwei Tage zu warten, da das eine oder andere was wir nicht mitnehmen können noch im Keller vergraben werden muss. Denn wir versicherten ihm, dass wir fest überzeugt sind, dass wir nach dem Endsieg wieder zurückkommen werden und das vorfinden werden, was wir bei unserer Ausreise vielleicht verloren hätten. Er ermahnte uns noch, damit nicht allzu lange zu warten. Mutter fuhr darauf so schnell sie konnte nach Ratibor Süd, was auch klappte und kam am nächsten Tag wieder zurück und hatte viel zu erzählen. Wir packten unsere Utensilien zusammen, ohne mich vom Bauern Puschke, seiner Frau, Monika, den zwei Knechten und den Wernersdorfer Buben zu verabschieden. Auch von Hansi, unserm Reitpferd, das uns so viele frohe Stunden bescherte, konnten wir uns, Kalle und ich, nicht mehr verabschieden. Mit der Fahrt nach Ratibor Süd klappte es prima. Wie üblich im Güterzug kamen wir noch bei Tageslicht in Ratibor Süd an. Während der Fahrt nach Hause erzählte Mutter ausführlich was Opa am Sonntag früh nach unserm Exodus erlebt hat und wie es ihm so erging. Es war der Sonntag, an dem wir im Zug nach Bauerwitz saßen, so gegen 8.30 Uhr. Opa wohnte in der Waschküche. Da stand der eiserne Ofen auf vier Beinen, in dem Opa oft Feuer machte, wenn es sehr kalt wurde, oder er sich was zum Essen kochte. Kartoffeln, Sauerkraut und in Einmachgläsern war einiges vorrätig. Und auf dem Ofen lagen immer einige Ziegelsteine, die beim Feuer im Ofen so nebenbei heiß wurden und die Waschküche wärmten, auch wenn das Holz schon im Ofen verbrannt war. Neben bei, außer dem Holzkeller waren noch alle Kellerscheiben ganz im Gegensatz zu den Zimmerfensterscheiben.
Also Opa kam an dem Sonntag, so gegen 8.30 Uhr aus der Waschküche in den Kellerflur, schloss die Kellertür zum Vorkeller unter der Terrasse auf und will die Kellertür öffnen. Da tut es einen Riesenschlag . Wie von einer unsichtbaren Faust getroffen fällt Opa rücklings in den Kellerflur zurück. Als Opa wieder zu sich kam und der Staub sich verzogen hat, sah Opa die Bescherung: Eine Granate hatte den mittleren Pfeiler, der die Terrasse abstützte, genau gegenüber von der ebengeöffneten Kellertür, weggerissen und ein Granatsplitter ging durch seinen Pepita Hut und kratzte dementsprechend die Kopfhaut der verlängerten Stirn auf. Ein anderer Splitter dieser Granate schlug durchs Holzkellerfenster und zerriss das Heizungsrohr. Unser Haus wurde fernbeheizt, war eines von mehreren Häusern. Die Folge war, dass das ganze Wasser aus den Heizungen aller Häuser bei uns durch das defekte Rohr in den Holzkeller lief. Die Kopfhaut war wieder verheilt. Die Löcher im Hut aber blieben. Ich glaube, Opa hat den Pepita Hut sogar 1956, als er mit seiner Tochter, unsrer Tante Magda, nach dem Westen als Deutscher rausfahren durfte mit genommen. Dazu später mehr.