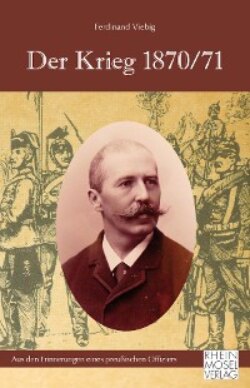Читать книгу Der Krieg 1870/71 - Ferdinand Viebig - Страница 7
ОглавлениеKriegszeiten.
Von Düsseldorf bis Gravelotte
»Gestellungs-Ordre (Gestellungsbefehl). Der Uffz Viebig, Ferdinand Carl Heinrich Herrmann zu Düsseldorf wird hierdurch angewiesen, sich den 20. Juli 1870 vormittag 9 Uhr auf dem grossen Exerzierplatz hinter der Infantriekaserne unfehlbar zu gestellen, wo er weitere Befehle zu gewärtigen hat. Im Falle des ungehorsamen Ausbleibens steht ihm die Strafe nach der Strenge des Gesetzes bevor. Düsseldorf, den 16. Juli 1870. Landwehrbezirkskommando.« –
Die wenigen Tage bis zum Ausmarsch vergingen wie im Traum. Einer meiner ersten Gänge war mit meiner Mutter zum Meister Einbrod in der Bahnstrasse, um mir noch schnell ein paar tüchtige Marschierstiefel mit hohen Schäften machen zu lassen. In der Tat lieferte mir der brave Schuster ein wahres Meisterstück. In einem Briefe vom 13. Oktober konnte ich berichten, dass sie erst einmal neu besohlt seien, obwohl ich die gelieferten Kommisstiefel (Anm. 11), die mich entsetzlich drückten, bis dahin nur zweimal getragen hatte. Ausserdem gab er mir gratis noch einen ganz besonderen Segen mit auf den Weg. Das sogenannte Zungenreden (Anm. 12) ist doch kein leerer Wahn. Einbrod gehörte zu irgendeiner religiösen Sekte und war sonst ein stiller, in sich gekehrter Mann. Jetzt aber packte ihn die patriotische Begeisterung, er geriet vollständig in Verzückung und fing an zu predigen wie ein Apostel und Prophet. Die wundersamsten Worte strömten ihm nur so von den Lippen, und wenn ich mich auch des Inhalts nicht mehr erinnere, so ist mir doch der Eindruck eines seltenen Erlebnisses geblieben, dem ich aus meinen Erfahrungen nichts Aehnliches an die Seite zu stellen wüsste. –
Etwas realistischer ging es in der Kaserne zu. Ich wurde gleich wieder in die 4. Kompagnie eingestellt und hatte so den Vorteil, mich nicht erst an lauter fremde Gesichter gewöhnen zu müssen. Hauptmann von Asmuth blieb samt seinem bisherigen Feldwebel Kleinert beim Ersatzbataillon zurück. Ein neuer Herr, der Premierleutnant (Oberleutnant) Bernecker, der die Stammmannschaften noch gar nicht kannte und erst am 22. August zum Hauptmann und Kompagniechef befördert wurde, übernahm die Führung, und eine neue »Mutter« in Gestalt eines soeben erst aus der Unteroffizierschule entsprungenen, demnächst bei Spichern gefallenen Sergeanten Paasche, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, wurde der Kompagnie zugeteilt. Beide waren daher von vornherein in mancher Beziehung auf mich angewiesen, und doch wäre ich um eines Haares Breite überhaupt nicht ins Feld gezogen. Der alte Feldwebel war mir nicht gewogen, seitdem ich mit seinem intimsten Feinde, dem Bataillionsschreiber Leist auf vertrautem Fusse stand. Während des Dienstjahres hatte er mir nicht viel anhaben können, da ich pünktlich meinen Dienst besorgte, mir keine Blössen gab und keine besonderen Vergünstigungen beanspruchte; aber wenn er mich irgendwo schikanieren konnte, so tat er es gern. Nun hatte das Bataillon vor dem Ausrücken einen federgewandten Unteroffizier zu stellen, der als Schreiber beim Bezirkskommando in Düsseldorf zurückbleiben sollte, und dass die Wahl auf mich, den Offizieraspiranten fiel, das glaube ich heute noch den Bemühungen des intriganten Feldwebels zuschreiben zu müssen. Ich steckte mich hinter den mir wohlgesinnten Regimentsadjutanten Premierleutnant Fleischhammer, jetzt Oberst a. D. in Berlin, den Onkel der netten Frau von Bunsen auf Haus Leppe bei Engelskirchen, und diesen gelang es, mich bei dem Bezirkskommandeur Oberst Mensing durch persönliche Vorstellungen wieder loszubetteln. Der Feldwebel rächte sich durch eine letzte Tat, aber schaden konnte er mir nicht mehr. Als am letzten Nachmittag von der 4. Kompagnie ein Unteroffizier kommandiert werden musste, der am Morgen des 24. Juli das Verladen der Bataillonsfahrzeuge auf dem Bahnhof in Obercassel zu leiten hatte, so erschien ich ihm natürlich als die geeigneteste Persönlichkeit. Ich kam so um den einem Triumphzug gleichenden Ausmarsch durch Düsseldorf und musste schon um 5 Uhr morgens drüben sein, während der Extrazug des Bataillons erst um 7 Uhr abgehen sollte; aber das half mir vielleicht über den Abschied vom Elternhause nur umso schneller hinweg. –
Im Morgengrauen lief meine Mutter noch in den Garten, um mir eine weisse Rose auf den Helm zu stecken – ein Motiv, das Clara Viebig im 25. Capitel der »Wacht am Rhein« (Anm. 13) verwertet hat – und dann gings hinaus ins feindliche Leben. »Die gute Frau hat dir noch lange nachgeweint da droben am Fenster«, so schrieb mir Klostermann nach einem Besuch bei meinen Eltern. –
In Obercassel begrüsste mich noch der Regierungsrat Richter, ein Freund meiner Eltern, der später ein hohes Tier in der elsasslothringischen Schulverwaltung geworden ist, und wenn unterwegs in unserem Zuge eine Kupplung riss und bei der Ankunft in Stolberg unsere Kompagniekarre eine Böschung hinunter fiel und dem armen Kutscher ein Bein zerbrach, so war ich wenigstens nicht schuld daran. –
Ich bin der Königlichen Vierten während des ganzen Feldzugs treu geblieben, habe 11 verschiedene Kompagnieführer kommen und gehen sehen, und so ist es denn kein Wunder, dass ich mit dieser Kompagnie besonders verwachsen bin. –
In Stolberg bei Aachen besuchte ich den Pfarrer Spiess, des Trierer Pfarrers (Anm. 14) ältester Sohn, um mich nach meinem Freunde Rudolph zu erkundigen, der in Neuwied beim Ersatzbataillon NO 40 stand, und von Stolberg aus begannen wir am 25. Juli den Vormarsch an die Saar, der nur durch eine Abschwenkung zur Beobachtung der Luxemburger Grenze unterbrochen wurde. Mit frohem Mut waren wir in Stolberg angekommen und fanden überall den gleichen freundlichen Empfang, aber die heissen Marschtage durch das hohe Venn und die unwirtlichsten Teile der Eifel gehören zu den fürchterlichsten Erinnerungen. Neues Schuhzeug, ungeübte Reservisten, kümmerliche Quartiere und noch kümmerlichere Verpflegung. In dem Staub und der Schwüle fielen die Leute wie die Mücken, und gleich am ersten Tage hatte die 250 Mann starke Kompagnie nicht weniger als 30 Marode (Anm. 15). Premierleutnant Bernecker war der jüngste Kompagnieführer und deshalb bekamen wir die entlegensten Quartiere und hatten die weitesten Märsche. Schon am ersten Marschtage jagte der Kompagnieführer den unbrauchbaren Feldwebelaspiranten, der nicht einmal Rotten abzählen und Sektionen abteilen konnte, Knall und Fall zum Teufel. »Scheren Sie sich in die Front! Unteroffizier Viebig, Sie übernehmen von heute ab die Feldwebelgeschäfte!« Aber was verstand ich von Feldwebelgeschäften? Es ist zwar kein Kunststück, aber man muss es doch kennen. Ich hatte nach den erschöpfenden Märschen gerade genug zu tun, um für das Unterkommen der Leute zu sorgen und die von meinem Vorgänger hinterlassenen schriftlichen Arbeiten zu erledigen und hatte z. B. keine Ahnung davon, dass ich in jedem Marschquartier mit den Ortsvorstehern wegen der Verpflegung abzurechnen hatte. Noch im Jahre 1871 kamen die Reklamationen, die ich dann nur annähernd nach Gutdünken beantworten konnte. –
Am 26. Juli passierten wir mit klingendem Spiele die romantisch gelegene Kreisstadt Montjoie (Monschau) (vergl. das »Kreuz im Venn«) (Anm. 16) und nach 18-stündigem Marsche von Lammersdorf gelangte die Kompagnie gegen 5 Uhr nachmittags nach Wollenberg, »einem miserabelen Neste von wenigen Häusern auf hohem schroffen Berge.« –
Die letzten Nachzügler trafen erst um 09:30 Uhr abends ein, und inzwischen war ich nach dem Genuss von Kartoffeln und Sauerkraut – das beste was die Leute hatten – längst wieder unterwegs zum Befehlsempfang in dem 1,5 Stunden entfernten Städtchen Hellenthal. Der Kompagnieführer requirierte zwar für mich ein Fuhrwerk, aber Pferde und Wagen gab es in Wollenberg nicht und so wurde ich auf ein mit zwei Kühen bespanntes Leiterwägelchen gesetzt, das auf dem abschüssigen und steinigen Karrenwege derart stiess und stolperte, dass ich es dann doch vorzog, die Equipage (vornehme Kutsche) wieder nach Hause zu schicken und mich auf meine eigenen Füsse zu verlassen. Ich war beauftragt, dem Bataillonskommandeur Major von Wichmann zu melden, dass die Kompagnie wegen der vielen Fusskranken dringend einiger Schonung bedürfe und voraussichtlich morgen nicht so früh zum Rendez-vous erscheinen könne; aber unbewegten Antlitzes hörte der hohe Herr, ein ebenso tüchtiger als rücksichtsloser Offizier, meine gehorsame Meldung an und schnarrte mit schneidender Schärfe: »Sagen Sie dem Herrn Premierleutnant, die Kompagnie ist morgen früh zur befohlenen Minute zur Stelle.« Das einzige, was ich erreichen konnte, war der Befehl, den Stabsarzt aufzusuchen, und ihn im Namen des Kommandeurs zum Besuche der Kranken in Wollenberg aufzufordern. Unterdessen aber kam ein Donnerwetter und der Arzt erklärte mir, es falle ihm gar nicht ein, bei solchem Wetter im Dunkeln den Berg hinaufzulaufen. Bei sinkender Nacht kam ich allein da oben wieder an und löffelte noch etwas von einer elenden Brotwassersuppe oder Wasserbrotsuppe, vermochte aber vor Aerger und Uebermüdung nicht zu schlafen und war in aller Herrgottsfrühe wieder auf den Beinen. Natürlich kamen wir bedeutend zu spät zum Rendez-vous, und nachdem Bernecker die Kompagnie zur Stelle gemeldet hatte, liess der Major stillstehen, die Offiziere eintreten und durch den Adjutanten die Kriegsartikel verlesen. Bernecker war über diese mindestens überflüssige Behandlung ausser sich und wollte sich allen Ernstes eine Kugel durch den Kopf schiessen.
Am Abend versammelten sich die Kompagnieoffiziere in seinem Quartier zu Manderfeld, wo heute das von meiner Schwester durch ihre Novelle »Auf dem Rosengarten« in der Kölnischen Zeitung angeregte Krankenhaus steht (Anm. 17). Auch meine Wenigkeit wurde auf Bernecker’s persönliche Einladung hinzugezogen und nur mit Mühe gelang es, den Kompagnieführer vor übereilten Entschlüssen, als da sind Abschiedsgesuch, Herausforderung zum Zweikampf, Beschwerde u.s.w. abzuhalten. Die Spannung zwischen Bernecker und von Wichmann sollte nur zu bald eine unvorhergesehene Lösung finden. –
Am 28. Juli passierten wir die Kreisstadt Prüm, wo der neue Regimentskommandeur Oberst Eskens (Anm. 18) bei drückender Hitze Parademarsch machen liess und sich anerkennend darüber auszudrücken geruhte, und am 29. Juli rückten wir in Bitburg, der Heimat meines bei der Garde Fussartillerie stehenden Freundes Limbourg (Anm. 19) ein. Ich besuchte schnell seinen Vater, der dort einen grossen landwirtschaftlichen Betrieb besass und u. a. einen vorzüglichen Schweizerkäse erzeugte, und widmete mich dann zum letzten Male den unseligen Feldwebelgeschäften. Bernecker hatte meinen fortgesetzten Bitten nachgegeben und die Abordnung eines berufsmässigen Vertreters beantragt, der in Bitburg zu uns stiess, und als wir nun in der Nacht herausgetrommelt wurden, nahm ich wohlgemut Gewehr und Tornister, die damals viel schwerer waren, von neuem auf den Puckel. Während der Feldwebelepisode hatte ich wenigstens den Affen auf die Kompagniekarre legen dürfen, und merkte nun doch, dass die letzten Tage auch ohne diese Last nicht spurlos vorübergegangen waren. –
Wir kamen am 30. vormittags nach Helenenberg (Anm. 20) ins Quartier und ich erinnere mich, wie ich hier als Student mit Limbourg bei seinen Verwandten zu Besuch gewesen war. Onkel und Tante Limbourg waren Geschwisterkinder und hatten zwei blühend aussehende, aber taubstumme Töchter, die an unserer übermütigen Laune Gefallen fanden und beide a tempo in Tränen ausbrachen, weil sie nicht gleiches mit gleichem vergelten konnten. Jetzt hätte ich diese Mädchen gerne wiedergesehen, aber es kam wiedermal anders. Kaum war ich ins Heu gekrochen, um zunächst die gestörte Nachtruhe nachzuholen, da wurde Generalmarsch geschlagen und um 13:30 Uhr mittags ging es ohne Mittagessen weiter. Die nötigen Leiterwagen für die Maroden wurden diesmal von vornherein mitgenommen, und die Stimmung war nichts weniger als begeistert. Als ich aber von der »Hohen Sonne« (heute Ortsteil von Aach an der B51) das alte Trier da unten im Moseltale liegen sah, da biss ich noch einmal die Zähne zusammen, um das Ziel des Tages glücklich zu erreichen. –
Beim Einzug um 7 Uhr abends merkte man gleich, dass hier in der Nähe der Grenze die allgemeine Stimmung doch noch eine viel gehobenere war, als ich es in dem nüchterneren Düsseldorf kennengelernt hatte. An einem Parterrefenster in der Brückenstrasse stand Frau Schleicher (Anm. 21) mit ihrer Tochter Ella und kredenzte aus einer Giesskanne Milchkaffee, und noch durch einen Brief vom 27. Juli 1910 hat Frau Ella, jetzt Witwe Geheimrat Buss mich nachträglich darüber beruhigt, dass jene Giesskanne ganz neu gewesen sei und ihren Zweck ausgezeichnet erfüllt habe. Erst auf dem Kornmarkt wurde Halt gemacht, und als ich dort vor dem Casino auf meinem Tornister an der Erde sass, da erschien auch schon der gute alte Oberst »Icke« (Oberst a. D. Modrach) (Anm. 22), um sich mit rührender Fürsorge meiner anzunehmen. Auch Mathieu’s (Anm. 23) fanden sich mit Frl. Fuxius (Anm. 24) ein und machten ältere Rechte geltend, und so zog ich denn mit Mathieu’s nach der Dampfschiffartsstrasse. Es gab ein für Mathieu’sche Verhältnisse sehr gutes Abendessen, aber schon während des Essens fielen mir die Augen zu. –
Am folgenden Vormittag, den 30. Juli, wurde auf dem Palastparadeplatz exerziert, weil bisher noch gar keine Zeit und Gelegenheit gewesen war, mit der kriegsstarken Kompagnie die üblichen Gefechtsformationen durchzunehmen. Dann war ich bei Modrach am Trierschen Hof zu Tisch und um 3 Uhr Nachmittags führen wir mit der Bahn bis Beurig, um die kriegsmässige Sicherung des wichtigen Defilees (Brückenengparade) von Conzerbrück mit möglichster Schnelligkeit durchzuführen. Am 01. August kam endlich bei Beurig in Irsch der ersehnte Ruhetag und ich benutzte ihn, um einmal gründlich Toilette zu machen und meinen fusskranken Burschen Breidenbach zu pflegen, der sonst immer alles »vermoost« d. h. famos fand, jetzt aber doch ziemlich kleinlaut geworden war. –
In den nächsten Tagen marschierten wir anscheinend zwecklos hin und her. Vermutlich galt es der näheren Zusammenziehung der unter dem Oberbefehl des Generals von Steinmetz gebildeten I. Armee bzw. des VII. Armeekorps unter General Zastrow und der 14. Division unter General von Kameke (Anm. 25). Jedenfalls aber bekam die Sache jetzt schon ein etwas kriegerischeres Aussehen. Es wurden Vorposten bezogen und Feldwachen ausgestellt, und meine Mutter hatte nicht unrecht, als sie mir am 04. schrieb: »Wenn Du diese Zeilen erhältst, stehst Du dem Feinde wahrscheinlich im Angesicht und kannst jeden Augenblick erwarten, dass Du die Schrecknisse des Krieges in seinem ganzen Umfange kennen lernst. Der liebe Gott und die Segenswünsche deiner Eltern begleiten Dich und die Gebete eines ganzen Volkes folgen den Kriegern auf ihren Wegen.« Ich selbst schrieb am 05. August auf einer Feldpostkarte, und zwar wie befohlen ohne Ortsangabe, an meinen Vater: »Unser Ziel ist bald erreicht. Vielleicht stossen wir morgen auf den Feind.« Woher ich das wusste? Im allgemeinen begreift man ja nicht viel vom Zusammenhang der Dinge, wenn man so als einer von Hunderttausenden im grossen Haufen mit marschiert, und den Gang der Ereignisse erfährt man manchmal erst aus späteren Briefen und etwaigen Zeitungen, die man selten genug zu sehen bekommt. An diesem 05. August aber wurde uns die erste Siegesnachricht von der Erstürmung Weissenburg’s und des Geissberges (Anm. 26) bekannt gemacht und mit lautem Hurra begrüsst, und auch bei uns lag etwas in der Luft, als ob wir ernsten Stunden entgegen gingen (Pfarrer Bodelschwingh schreibt dazu nach dem Gottesdienst für die 14. Division »Auch für uns wird nach dem Ruhetage ein Schlachttag kommen, an dem für manchen Kriegsmann der ewige Ruhetag anbricht.«)
Vom 05. zum 06. August biwakierte die 1. und 4. Kompagnie bei Landsweiler an der Strasse nach Saarbrücken. In der Nacht fiel starker Regen, Zelte gab es ausser den Offizierszelten damals noch nicht, und die in der Eile zusammengeflochtenen Laubhütten gewährten nur wenig oder gar keinen Schutz. So kam es, dass ich zwar mit dem Oberkörper im Trockenen, die Beine aber im Freien lagen und meine Tuchhose sich wie ein Schwamm voll Wasser sog, das mir noch bis zum Nachmittag des folgenden Tages immer am blossen Körper herunter rieselte. Gegen 11 Uhr vormittags erreichten wir mit der Vorhut der 14. Division St. Johann und überschritten die Saar auf der unteren Brücke, wo wir dem Kommandierenden des VIII. Armeekorps General von Goeben mit der historischen Brille begegneten (s. Anm. 25). Von dem übereilten Angriff der Franzosen auf Saarbrücken (Anm. 27) und von den Heldentaten des kleinen preussischen Detachements (vorgeschobener Truppenverband des Hauptheeres), das sich gegen die Uebermacht in den ersten Augusttagen dort gehalten hatte, wussten wir noch nichts und sahen mit Verwunderung die Spuren der französischen Granaten am Bahnhof in St. Johann. Saarbrücken selbst war in den letzten Tagen von deutschen Truppen völlig entblösst gewesen. Man nahm an, dass der Feind im Abziehen begriffen sei und die Spicherer Höhen (Anm. 28) nur noch mit einer Arrieregarde (Nachhut) besetzt halte. Bei unserem Einzug herrschte heller Jubel, die Regimentsmusik spielte lustige Märsche, von allen Fenstern winkten die Damen mit den Taschentüchern und wir wunderten uns nur, dass wir nicht Halt machten und in Saarbrücken einquartiert wurden. Die halbe Stadt lief neben uns auf der Strasse her, zu mir hatte sich der gute Landgerichtsrat von Westhofen gesellt, der mir in späterer Zeit noch näher treten sollte und begleitete mich bis zur Höhe des Exerzierplatzes jenseits der Stadt. –
Kaum hatten wir den Hohlweg vor dem Exerzierplatz erreicht, als eine Granate, vom roten Berge kommend, vorn ins Bataillon einschlug. Ein Splitter streifte die Flinte auf der Schulter meines Nebenmannes und alsbald verschwanden die Civilisten. Die Regiments-Musik, die sich noch immer an der Spitze befunden hatte, kam zurückgelaufen und verkroch sich unter der Führung des biederen alten Köllner in einen nahen Felsenkeller. Die hinter uns marschierende Batterie kam in voller Karriere den Berg herauf gerasselt, um auf dem Exerzierplatz abzuprotzen (das Geschütz vom Wagen lösen), ein schneidiger ermutigender Anblick. Wir selbst drückten uns instinktiv an die linke Wand des Hohlweges. »Nur ruhig, Kinder«, sagte der brave Unteroffizier Hausmann, »sie treffen nicht alle, ich kenne das von 66 (deutsch-österr. Krieg) her.« Da wurde ich auch schon zur ersten Kompagnie gerufen, denn der erste Verwundete – die Seite war ihm aufgerissen – war der lange Einjährige van Gelder, mit dem ich ein paar Stunden vorher während einer Pause auf dem Marsche nach Saarbrücken noch friedlich zusammen gefrühstückt hatte. Aber bevor ich noch dem Rufe folgen konnte, ging es weiter. Das dritte Bataillon setzte den Vormarsch in der Richtung auf das Stiringer Waldstück fort, das 1. Bataillon aber, in Kompagnie Kolonnen auseinandergezogen, bog links seitwärts aus und stieg längs des Repperts- und Winterberges nach der uns von den Spicherer Höhen trennenden Mulde hinab. –
Unten empfing uns ein ziemlich wirkungsloses Artilleriefeuer. Ein Granatsplitter schlug unter dem Pferde unseres Kompagnieführers ein, und der Gaul machte einen mächtigen Satz, hatte aber weiter nichts mitbekommen. Bernecker stieg ab und nun kam von der Höhe des Gifertwaldes auch das erste Chassepotfeuer (Anm. 29), bevor wir mit unseren veralteten Zündnadelgewehren überhaupt an eine Erwiderung denken konnten. Bald lag auch einer aus der Kompagnie am Boden, verdrehte die Augen und tastete mit den Händen in der Luft herum. Auch Leutnant von Forell, »die dicke Forelle«, bekam eine Kugel durch den Schnurrbart, zückte sein Taschenspiegelchen, besah sich den Fall und zog sich zurück. Einzelne Füsiliere warfen, um besser laufen zu können, das schwere Schanzzeug weg, ohne dass jemand sie daran hinderte, und mit möglichster Schnelligkeit suchte alles den unteren Waldrand zu erreichen. Dort waren wir im toten Winkel, die feindlichen Geschosse gingen über uns hinweg und dort legten wir in Reih und Glied die Tornister ab, um durch den Pfaffenwald zwischen Stifts- und Giffertwald die steil ansteigende Höhe zu erklettern. Die steilsten Stellen konnten nur dadurch erklettert überwunden werden, dass wir uns gegenseitig an den Gewehren hinaufzogen oder Bäume und Strauchwerk zur Unterstützung benutzten, aber dadurch löste sich natürlich der Kompagnieverband in lauter kleine Gruppen und Grüppchen auf, und als wir nun glücklich oben waren, wo sich die anderen Kompagnieen bereits im Feuergefecht befanden und der Dampf des damals nichts weniger als rauchlosen Pulvers sich bereits im Waldesdikicht festgesetzt hatte, da ging vollends aller Ueberblick und Zusammenhang verloren. –
Schon im Hohlweg beim Exerzierplatz hatte ich ein gelb und rotes Abzeichen, wie es die Franzosen auf den Tschako’s (Anm. 30) trugen, gefunden und mitgenommen, das ich heute noch besitze, und jetzt sah ich zwischen den Bäumen wieder etwas rotes am Boden schimmern. Ich ging mit einem Füsilier darauf zu und fand einen französischen Infanteristen in roten Hosen, der durch den Knöchel geschossen und mit dem Verbinden seiner Wunde beschäftigt war. »Ach nur a Tröpfle Wasser«, so redete der erste Franzose, den ich zu Gesicht bekam, mich in seiner elsässischen Mundart an, aber meine Feldflasche war bereits bis auf den letzten Tropfen geleert, und mein Begleiter hatte aus dem letzten Quartier nur noch etwas flüssigen Honig, den er dem armen Verwundeten einzuflössen versuchte. Weiter gings in den Wald hinein und dabei klatschten fortwährend die Kugeln gegen die Bäume und pfiffen einem um die Ohren, als ob einem jemand eine Hand voll Bohnen an den Kopf werfen wollte. An einer Lichtung stiess ich auf den Kompagnieführer, der zu mir sagte: »Sehn Sie doch mal, ob Sie irgendwo einen Tambour finden, er soll schlagen (d. h. die Trommeln rühren)«. Ich fand den Tambour und ging in gleichem Schritt und Tritt mit ihm von neuem vor. Der brave Tambour schlug aber nicht blos auf sein Kalbfell los, sondern haute mit seinen Trommelstöcken im Vorbeigehen auch auf den wohlgenährten Unteroffizier Sedig ein, der mit hochgerötetem Gesichte hinter einem Baume stand und nicht von der Stelle zu bringen war. Der mutige Ostpreusse, der wegen seiner »Blachbüchsen und seiner Arbsen mit Speck« schon im Frieden der Gegenstand allgemeiner Verhöhnung war, ist nachher überhaupt nicht wieder zum Vorschein gekommen und ich habe später nur noch gehört, dass er sich als unverwundeter Patient in irgendeinem Lazareth befinde. –
Am Waldrand angekommen, wo uns die feindlichen Schützen hinter einem Grabenrande gegenüberlagen, kniete ich hinter einem Baume nieder, zielte auf die im Pulverdampf zuweilen sichtbar werdenden Gestalten und verschoss so langsam einige Patronen, bis wir auf einmal aus der linken Flanke mit einem Hagel überschüttet wurden – es soll Mitrailleusenfeuer (Anm. 31) gewesen sein –, in dem sich einzelne Geschosse überhaupt nicht mehr unterscheiden liessen. Da kam plötzlich eine Rückwärtsbewegung in unsere schwachen Reihen. Von wo und von wem sie ausging, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass auf einmal alles lief, dass ich mitlief, und dass wir in wenigen Minuten wieder unten am Berge waren. Auf einmal sah ich meinen Freund, den Bataillonsschreiber Sergeant Leist mit dem schönen roten Vollbart neben mir laufen und wir wechselten wohl ein paar Worte, aber auf einmal sah ich ihn nicht mehr. Lautlos war er verschwunden, um nicht wieder aufzustehen. Unten am Berge – es wird zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags gewesen sein – pflanzte sich der Vicefeldwebel (Unterfeldwebel) Kuhn auf freiem Felde mit der zerschossenen Fahne auf, um das Bataillon zu sammeln und zum Stehen zu bringen. Ein schöner stolzer Anblick, aber eine ebenso grosse Dummheit, denn die Franzosen folgten uns auf den Fersen, und wenn nicht einer von den Offizieren den Fahnenträger fortgetrieben hätte, so war es um die Fahne geschehen. Premierleutnant Bernecker lag plötzlich am Boden und stiess einen lauten Schrei aus. Er war in den Oberschenkel geschossen worden und niemand vermochte sich seiner anzunehmen. –
Bis dahin war man gar nicht zur Besinnung gekommen, aber jetzt auf dem Rückzug erwachte der Selbsterhaltungstrieb und jeder suchte sich selbst, so gut er konnte, in Sicherheit zu bringen. Ich drückte den Helm in den Nacken und lief mit den anderen dem Winterberge zu, konnte es aber doch nicht lassen, mich an jeder Regenwasserpfütze auf den Boden zu werfen und wie das liebe Vieh die trübe Flüssigkeit einzuschlürfen, bis mich die ins Wasser einschlagenden Kugeln wieder auf die Beine brachten. Viele konnten überhaupt nicht mehr laufen und so wurde es 8 Uhr abends und später, bis die letzten Reste des Bataillons sich am Winterberge unweit des jetzigen Aussichtsturmes sammelten. Am Abhang lag ein Häuschen in einem Garten oder Weinberg, mit einer massiven Mauer umgeben. Hinter dieser Mauer suchten wir Schutz gegen das uns anfangs noch verfolgende Geschützfeuer. In das Häuschen aber hatte man den tödlich getroffenen Füsilier Butzmühlen gebracht, der bis dahin immer der Spassmacher der 4. Kompagnie gewesen war. Wenn auf dem Marsche alles die Köpfe hängen liess, dann wusste er durch ein Scherzwort immer die Stimmung zu retten, und das beliebte Soldatenlied von der schönen Müllerstochter mit dem Refrain:
»Lauf Müller, lauf Müller lauf,
Mein lieber Müller lauf«
wurde in der vierten nie anders als mit der Variante »Putzmüller lauf, Müller lauf« gesungen. Jetzt lag der arme Putzmüller da drinnen röchelnd in den letzten Zügen und niemand sang ihm mehr sein Lieblingslied. –
Das erste Wiedersehn des kleinen Häufleins auf dem Winterberg war niederschmetternd. Im ersten Augenblick meinten wir, es sei überhaupt fast niemand übriggeblieben – auch Sergeant Paasche, der unglückliche Feldwebelaspirant gehörte zu den Gefallenen – aber allmählich kamen die Versprengten einzeln heran, und man hatte, wenngleich zu Tode erschöpft, doch wieder Augen und Ohren für den Fortgang des Gefechts. »Wären im Gifert- und Pfaffenwalde rechtzeitig hinlängliche Unterstützung vorhanden gewesen, so hätte durch vollständige Besitznahme der Hochfläche dem Gefecht wohl zu einer früheren Stunde eine entscheidende Wendung gegeben werden können.« So drückte sich Hauptmann Rinteln auf Seite 501 seiner »Geschichte des Niederrheinischen Füsilier-Regiments NO 39« sehr zurückhaltend aus. Er hätte dreist auch sagen können, dass ohne das vorschnelle und unüberlegte Draufgehen unserer Oberleitung der Sieg um einen Tag später mit weit geringeren Opfern möglich gewesen wäre und bei einer leicht ausführbaren Umgehung des Feindes voraussichtlich mit einer vollständigen Vernichtung des Korps Frossard (Anm. 32) geendigt haben würde. Wir wussten ja nicht einmal, wo unsere anderen Bataillone steckten, und erst als wir wieder auf dem Winterberg gelandet waren, sahen wir neue Bataillone herankommen und in den Kampf eingreifen. Wir sahen die preussischen Schützenschwärme am roten Berge langsam höher kriechen und ahnten nicht, wie sich dort auch unsere 9. Kompanie unter der persönlichen Führung unseres Brigadekommandeurs, des heldenmütigen Generalmajors von François am Sturme beteiligte (Anm. 33). Erst nach Jahren habe ich diese Scene auf dem Wandgemälde A. von Werner’s (Anm. 34) im Saarbrückener Rathaus zu Gesicht bekommen. Wir merkten wie die feindlichen Schrapnellwölkchen allmählich seltener wurden und das Chassepotfeuer auf der Höhe immermehr verstummte. Wir sahen staunend wie die erste preussische Batterie am roten Berge hinaufgeschafft wurde und alsbald die Verfolgung des abziehenden Feindes eröffnete. Wir sahen schliesslich eine lange Reihe von Geschützen ihr Feuer in der Richtung auf Forbach vereinigen und vergassen darüber Hunger, Müdigkeit und Durst. –
Im Kreise unserer Offiziere kam die Rede auf meinen schwer verwundeten Kompagnieführer Bernecker, und der Regimentsadjutant Premierleutnant Fleischhauer meinte: »Viebig macht sich gewiss ein Vergnügen daraus ihn zu holen.« Ich war natürlich sofort bereit und fühlte mich dennoch erleichtert, als in demselben Augenblick die Meldung kam, dass Bernecker bereits geborgen sei. Im Sommer 1880 sah ich eines Nachmittags im alten Wiesbadener Kurhaus einen kranken Mann in einer Sofaecke sitzen und ging unwillkürlich auf ihn zu: »Kennen Sie mich noch, Herr Hauptmann?« Da belebte sich das wachsbleiche Gesicht und er sagte nur das eine Wort: »Spichern!« Nach kurzer Unterhaltung nahmen wir für immer Abschied. Er ist aber wie ich sehe erst am 17.10.1889 im Alter von 53 Jahren gestorben. Ausser Bernecker war, ohne dass ich es bemerkt hätte, auch unser Premierleutnant von Beaulieu im Stiftswalde durch einen Schuss in die linke Brust verwundet worden – er starb am 10. August im Lazareth zu St. Johann – und von den Kompagnieoffizieren war nur noch der Sekondeleutnant (Leutnant) der Reserve Bäumer, ein älterer Referendar aus Dortmund, von dem noch mehr die Rede sein wird, unverwundet zur Stelle. Die Folge war, das Hauptmann Köppen, der als ältester Hauptmann an Stelle des an der Spitze der 3. Kompagnie gefallenen Majors von Wichmann die Führung des Bataillons zu übernehmen, noch am Abend der Schlacht zu mir sagte: »Sie legen von heute ab den Degen an, tun Offiziersdienst und übernehmen die Führung des 8. Zugs.« –
Gegen 9 Uhr kamen die Weiber von »Dale«, d. h. St. Arnual (Saarbrücker Stadtteil) und brachten was sie hatten. Ich habe an diesem Abend sogar gebackene Kartoffeln gegessen, und als mir eine der Frauen eine grosse blecherne Milchkanne reichte, da konnte ich sie kaum wieder vom Munde bringen, obschon ich mir immer sagte, dass ich den anderen doch auch etwas übrig lassen müsse. Noch in der Nacht hörte man einzelne Schüsse fallen – es waren Signalschüsse der im Walde liegenden Verwundeten, die sich auf diese Weise bemerklich zu machen suchten –, sah aber auch die Handlaternen der braven Saarbrücker sich hin und her bewegen, die dort oben ihren Samariterdienst (Anm. 35) verrichten. –
Gross war die Zahl der Opfer, die das Regiment gebracht hatte: 27 Offiziere und 628 Mann waren ausser Gefechte gesetzt, davon 9 Offiziere, 149 Mann tot und 78 vermisst. Aber diese schweren Opfer waren, wie mein Vater schrieb, »wenigstens nicht umsonst gebracht.« »Die Wirkung dieser Siege (Spichern und Wörth Anm. 36) ist in militärischer wie politischer Beziehung ungleich grösser gewesen als man irgend erwarten konnte.« Am Morgen des 7. August betraten wir noch einmal das Schlachtfeld, um die Leiche des von unseren Füsilieren leider wenig betrauerten Majors von Wichman zu suchen. Ich selbst habe sie nicht gesehen, aber die Leichen von Freund und Feind genug und übergenug, und die Bilder, die sich da dem Auge boten, lassen sich nicht beschreiben. Stille Schläfer und verstümmelte Körper, blauschwarzgefärbte Gesichter und wild verzerrte Hände. Vorüber, vorüber, nur vorüber! Jetzt erst bemerkte ich das von den Franzosen im Stich gelassene Zeltlager vor dem Dorfe Spichern und jetzt erst sah ich, wie nah wir überhaupt an jener Lichtung des Waldes den französischen Schützen gegenüber gestanden hatten. –
Unsere Tornister fanden wir noch vor, aber gänzlich durchwühlt und ausgeraubt. Nur die zur feldmarschmässigen Ausrüstung gehörenden Gesangsbücher hatten die Franzosen drin gelassen. Die Bagage (Anm. 37) mit meinem Köfferchen, das schon bei dem Unfall in Stolberg Schiffbruch gelitten hatte, war bis auf weiteres nicht erreichbar und so besass ich einstweilen nichts als was ich auf dem Leibe trug. Was sonst an diesem Tage noch geschah, das ist mir völlig in Nebel gehüllt. Es ist mir dunkel, als sei ich noch einmal durch Saarbrücken gekommen und hätte den dicken Forell mit einem weissen Maulkorb am Fenster stehen sehen, aber die Erschöpfung war zu gross, um an irgend etwas denken zu können. Nach Hause schrieb ich auf einer am 9. August dort angelangten Feldpostkarte nur die wenigen Zeilen: »Gestern grosses 7stündiges Gefecht zwischen Saarbrücken und Forbach, das nach hartnäckigem Kampfe mit dem Siege der Unsrigen endete. Ich selbst drei Stunden im mörderischen Feuer, unversehrt. Massenhaft Tote und Verwundete. Ich danke Gott und hoffe auf ihn.« –
Die Eltern hatten mir schon am 7. August von dem allgemeinen Jubel über die Siegesnachricht von Wörth berichtet. »Behufs Ausstattung eines der Lazarethbedürfnisse«, so schrieb mein Vater, »war gestern die liebe Mutter einen grossen Teil des Tages im Depot beschäftigt und kam sogar nicht einmal Mittags zum Essen nach Hause. Herr Goering (Anm. 38) ist gestern mit einem grossen Transport Lazarethbedürfnisse aller Art von hier über Call nach Trier abgegangen.« Aber von Spichern wussten die Eltern bei Abgang dieses Briefes noch nichts, und um so rührender war die Freude meiner Eltern und aller Bekannten, die in den folgenden Briefen vom 11. des Monats, beim Vater in ruhigerer bei der Mutter in leidenschaftlicherer Weise zum Ausdruck kam. In meiner ehemaligen Kaserne waren inzwischen fast 500 Verwundete, darunter auch viele Franzosen untergebracht und meine Mutter war mit der Pflege derselben so beschäftigt, dass sie fast nur noch als Gast nach Hause kam. Aber so viel konnte sie doch schreiben: »Gott sei gelobt und gedankt, dass du uns erhalten geblieben bist! Möchte er dich auch ferner behüten und beschützen. Sei tausendmal gegrüsst und ans Herz gedrückt von Deiner treuen Mutter.« –
Die Nacht vom 7. auf den 8 August biwakierten wir am Fusse des roten Berges in der Nähe des französischen Zollhauses, am folgenden Tage jenseits Forbach in Feindesland, und ich war froh, dass ich mich wenigstens nicht an dem traurigen Totengräberdienste zu beteiligen brauchte. Dass auch der Unteroffizier Walter Wiegmann aus Düsseldorf, der Sohn unserer Hausfreundin Frau Prof. Wiegmann zu den Toten der 3. Kompagnie gehörte, wusste ich damals noch nicht, sonst hätte ich mich doch wohl darum gekümmert. Die schwergeprüfte Mutter hat die Leiche später ausgraben lassen und ich hörte Bedenken äussern, ob man auch wieder die richtige gefunden habe. –
Am 8. August war ich mit einem Kameraden vormittags in Forbach, um mich für meinen Tornister wieder mit den nötigsten Wäschegegenständen und Esswerkzeugen zu versehen. Wir besahen uns das Haus, in dem General Frossard die Schlacht geleitet oder vielmehr nicht geleitet hatte, stärkten uns im ›Hotel au chariot d’or‹ mit warmem Kalbsbraten und einem Fläschchen Sekt, radebrechten die ersten französischen Brocken und stöberten in dem verlassenen französischen Lager umher, wo es noch wüst und schauderhaft aussah. Die Pferdekadaver begannen schon anzuschwellen und streckten die Beine steif in die Luft und deutliche Spuren zeugten von der Eile, mit der am 6. das Lager geräumt worden war. Ich sah einen Toten, dem der rechte Arm glatt abgerissen war. Neben der Hand lag noch ein blechener Becher gez. Charpeil mit einem kleinen Restchen Rotwein, und diesen Becher habe ich bis der Henkel brach, am Trageriemen einer französischen Feldflasche mit mir geführt, die wegen ihrer Grösse und Unzerbrechlichkeit viel praktischer als die unsrigen war. Den Becher und auch die Flasche besitze ich heute noch. Im Tornister des Gefallenen fand ich einen Brief, den ich mit allen orthographischen Fehlern hier wiedergebe (Frei übersetzt durch die Herausgeber).
Gaillac, den 3. August 1870
Liebster Freund,
lass mich Dir für die guten Neuigkeiten, danken die Du mir in Deinem letzten Brief geschickt hast, denn es war nötig mich zu beruhigen. Mein Glückwunsch zu Deiner Beförderung und zu Deinen Erfolgen dort.
Eigentlich sollte ich nicht verärgert sein, trotz der guten Gründe, die es dafür gibt. Es hat mich aber verdrossen, dass Du mich in den Tagen, als Du in Monestier warst, nicht besucht hast, vor allem aber, dass Du weggegangen bist, ohne mir Adieu zu sagen.
Du hast mir in Deinem Brief geschrieben, du hättest keine Zeit gehabt. Aber ja doch! Du hattest! Denn da ist neulich an einem Tag Militär in der Nähe vorbeigekommen und sie waren von Deinem Regiment. Aber wollen wir denken, Dein Brief hat die Wunden in meinem Herzen geheilt.
Schreibe mir oft, mein Freund, denn ich versichere Dir, dass mir immer bewusst ist, welch grosser Gefahr Du ausgesetzt bist.
Aber Gott im Himmel wird die Seinen nicht verlassen und er wird Dich beschützen.
Schreib mir bald, halte mich auf dem Laufenden über die Ereignisse. Heute ist ein Telegramm angekommen, dass die Franzosen die erste Schlacht gewonnen haben (Es handelt sich dabei um die franz. Besetzung von Saarbrücken am 2.8.1870), und ich zweifele nicht daran, dass das Gewinnen weiter gehen wird.
Ich schliesse, mein lieber Philipe, Dich mit ganzem Herzen umarmend
Deine treue Freundin
Marie Gaston
(Der Schluss des Originalbriefes:
ce matin on a recu un dépeche annoncant que les francais avait gagné la première bataille, je ne doute pas qu’il gagne tout à faits.Je termine Mon cher philipe en tembrassent de tout mon coeur ta devoué ami Marie Gaston)
Am Abend des 8. August wurde durch unseren Divisionspfarrer, dem sogenannten Divisionsjesus ein feierlicher Feldgottesdienst abgehalten, dessen ich mich noch heute deutlich erinnere. Der gute Mayer, der später von seiner jungen Frau aus Frankreich abgeholt, am 7. Oktober 1870 in Münster an Typhus starb, spielte zwar eine etwas komische Figur, wenn man ihn mit seinem schwarzen Rock auf seiner Rosinante (Stute von Don Quijote) reiten sah, hier aber traf er den rechten Ton und manchem rauhen Krieger rollte eine stille Träne in den Bart. –
Am 9. August fand im Offizierszelt der 4. Kompagnie ein origineller Kriegsrat statt. Premierleutnant Hesse von der 9. Kompagnie (später Amtmann in Westfalen) der am roten Berge dem sterbenden General von François von der dargebotenen Hand den Trauring abgezogen hatte, war mit der Führung der 4. Kompagnie beauftragt. Jetzt sollte er, der uns ja gar nicht gesehen hatte, einen Gefechtsbericht über unsere Taten einreichen und der wurde dann von M. Bäumer und mir, so gut es ging, zurechtgeschmiedet. Auch die ersten Vorschläge zur Verleihung des Eisernen Kreuzes sollten bereits eingereicht werden und Hesse sagte mir, dass er mich eingeben wolle. Ich solle ihm nur sagen, was ich gemacht habe und wo ich gewesen sei. Nun konnte ich zwar mit guten Gewissen sagen, dass ich nicht aus der Nähe meines Kompagnieführers gewichen sei, war aber dumm genug zu sagen, ich sei mir keiner besonderen Heldentat bewusst, und es werde sich ja wohl noch später Gelegenheit bieten, mir das Kreuz zu verdienen. Die Folge war, dass ich es erst viel später bekam, nachdem ich inzwischen allerlei Erfahrungen gesammelt hatte, wie man sich diese Auszeichnung verschaffen konnte. Oberst Eskens, der bei Spichern die Führung des stundenweit auseinandergerissenen Regiments vollständig verloren und auch später gar keine Gelegenheit zu persönlicher Bewährung hatte, bekam das Kreuz schon am 21. August, und als am 3. März 1871 dem Regiment eine Anzahl von Kreuzen 1. Klasse zur Verteilung überwiesen wurde, nachdem er vom 13. November 1870 bis 12. Februar 1871 infolge eines Sturzes mit dem Pferde krank und dienstunfähig gewesen war, da nahm er für sich das erste davon und erklärte dann ganz naiv, dass er die Dekoration zu Ehren des Regiments tragen werde. So wenigstens ist mir die Sache erzählt worden, während die Regimentsgeschichte auf Seite 425 allerdings von einer besonderen Allerhöchsten Anerkennung »der Umsicht und persönlichen Tapferkeit« spricht, womit der Oberst »sein Regiment in den Schlachten bei Spichern und Gravelotte geführt hatte.« –
Am 10. August begann der weitere Vormarsch in der Richtung auf Metz und wir biwakierten bei strömenden Regen wieder einmal ohne Stroh zwischen Carling und l’Hôpital und lebten, wie unsere Füsiliere sagten, von dem »eisernen Verstand«, den wir wie gewöhnlich »in lebenden Häuptern« empfangen hatten. Ich kroch in eine der berühmten Laubhütten und rannte mir dabei die Spitze eines vorstehenden Baumastes ins Auge, das sofort derartig anschwoll, dass es gar nicht geöffnet werden konnte. Die ganze Nacht wurde es im Offizierszelt gekühlt und war am folgenden Morgen wenigstens soweit abgeschwollen, dass die Unverletztheit des Augapfels festgestellt werden konnte. Ich war buchstäblich mit einem blauen Auge davon gekommen und bildete in den nächsten Tagen eine interessante Person. Wir 39er im Allgemeinen und ich im Besonderen waren bei den uns begegnenden Regimentern, die noch nicht im Feuer gewesen waren, der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. »Kleine Kerle, aber sie beissen«, hörte ich einen General im vorbeimarschieren sagen, und es wurde sogar berichtet, dass ein gefangener französischer Offizier vor jedem Mann mit der NO 39 sein Käppi gelüftet habe. Die Schramme unter meinem Auge hielt man natürlich für die Spur eines Streifschusses, und irgendein General, der die Unteroffiziertroddel an meinem Degen und an meinem Kragen keinen Knopf bemerkte, fragte mich ganz verwundert: »Was sind Sie denn für einer?«
Am 12. August passierten wir St. Avold und biwakierten am 13. bei Domangeville in der Nähe der französischen Nied, wo wir wieder in enge Fühlung mit dem Feinde kamen. Am Sonntag den 14. August um 3:30 Uhr nachmittags wurde die 14. Division im Biwak plötzlich alarmiert und bald hörte man Kanonendonner aus der Richtung von Colombey (Anm. 39), die in ihren Folgen für die »Rheinarmee« des Marschalls Bazaine (Anm. 40) so verhängnisvoll werden sollte. Wir selbst, die 27. Infantriebrigade wurden als allgemeine Reserve des VII. Armeekorps nach der Gegend zwischen Marsilly und Colombey abkommandiert und nahmen nach einem beschwerlichen Eilmarsch Aufstellung in der Nähe des mir später noch bekannt gewordenen Dorfes Coincy. Hier fand auf den Feldern unter allgemeinem Geschimpfe ein ganz schulmässiges Brigadeexerzieren statt, wie es heutzutage selbst im Frieden nicht mehr denkbar ist. Die Bataillone standen »nach der Mitte in Kolonne«, eine jetzt verschollene Formation. Die Abstände zwischen den Bataillonen wurden von den Adjutanten abgeritten, um eventuell in die »Intervalle« »aus der Tiefe rechts und links deployieren (ausschwärmen)« zu können. Verschiedene Abschwenkungen, wobei ein bestimmtes Bataillon das »pivot« (Flügelmann) hatte und irgend ein Punkt des Geländes als »point de vue« (Aussichtspunkt) dienen musste, wurden ausgeführt, um die richtige Front herauszubekommen u.s.w. Schliesslich aber sahen wir bei einem wunderbar schönen Sonnenuntergang dem heissen Kampfe zu, der sich einige Tausend Schritte vor unserer Front abspielte. Zwei Füsiliere wurden durch verirrte Geschosse verwundet und einem ging eine Chassepotkugel durchs Tornister, aber zur weiteren Verwendung gelangten wir an diesem Tage nicht. Ohne Stroh und ohne Verpflegung – Brot fehlte seit mehreren Tagen – verbrachten wir die Nacht auf dem Schlachtfelde. Es war empfindlich kühl und ich verkroch mich irgendwo in einem Reiserhaufen, wo ich von vorübergehenden Soldaten für einen Verwundeten gehalten und deshalb ungestört gelassen wurde. In mich zusammengekauert hockte ich da und sah nach den Sternen, die so friedlich auf uns herniederschienen.
Mit Tagesanbruch – es war Napoleonstag (15.8.1769, Geburtstag von Napoleon Bonaparte) gingen wir in die vor der Schlacht eingenommene Stellung zurück. Gefangene Franzosen sagten: »Napoléon est un méchant, c´est la ruine de la france.« (Napoleon ist ein Schurke, das ist der Untergang Frankreichs) und dergleichen. (Anm. 41) Um so stolzer konnten wir auf unseren guten König Wilhelm sein, der am Morgen des 15. August in Begleitung seines Stabes auf das Schlachtfeld ritt. »Das Regiment hatte nicht das Glück, seines Allhöchsten Kriegsherrn ansichtig zu werden«, heisst es auf Seite 311 der Regimentsgeschichte. Ich aber, der ich an der Strasse auf Wache lag, habe ihn samt Moltke und Bismarck und unserem Trierer Hausfreund Längerich, der Adjutant bei General von Goeben war, in nächster Nähe gesehen, ich habe meinen Helm geschwenkt und mit meinen Leuten ein freudiges Hurra angestimmt. (Anm. 42)
Meine Feldpostkarte vom 15. August schloss ich mit den Worten: »Nächstens erwarten wir den entscheidenden Tag«, und in der Tat gab es schon am 16. wieder einen sehr anstrengenden, heissen Marsch bis ins Biwak bei Sillegny. Dort wurden wir am 17. morgens 6 Uhr alarmiert, der halbfertige Inhalt der Kochgeschirre wurde ausgegossen und wir traten den Weitermarsch auf Corny an, wo wir auf einer Pontonbrücke die Mosel überschritten. Auf dem linken Moselufer kamen uns die ersten deutschen und französischen Verwundeten und zahlreiche französische Gefangene von Mars la Tour – Vionville entgegen (Anm. 43). Angesichts des Mont St. Quentin und der Kathedrale von Metz erreichten wir das freundlich gelegene Ars sur Moselle – zufällig bin ich am 17. August 1911 in umgekehrter Richtung desselben Weges gefahren – und bogen dort in das Tal des Mance-Baches ein. Von einem Landhaus hatte ein Herr, vermutlich ein deutscher Direktor oder Ingenieur der dortigen Hüttenwerke, mit zwei Damen eine ganze Waschbütte voll Rotwein mit Wasser aufgestellt, aus der sie uns im Vorbeimarschieren zu trinken reichten oder schöpfen liessen. Mehr Zeit hatten wir nicht, da im Mance-Tal Schüsse gefallen waren und wir, das 1. Bataillon die dort gelegene Mühle besetzen sollten, dieselbe Mühle, in die am folgenden Tage der schwer verwundete Hauptman Graf von Stosch der 3. Kompagnie gebracht wurde, um dort am 21. August nach grässlichen Qualen – er war in die Blase getroffen – zu sterben. Wir verbarrikadierten die Mühle mittels der vorgefundenen Mühlsäcke, hörten auch in einiger Ferne Gewehrfeuer und das nicht zu verkennende Knarren der »Kugelspritzen« oder »Kaffeemühlen« (Mitrailleusen), und erst nach dem Kriege erfuhr ich aus meinen Militärpapieren, dass ich ein »rencontre (Gefecht) bei Ars sur Moselle« mitgemacht hatte. Ausserdem hatte ich hier das erste Rencontre (Treffen) mit dem Einjährigen Scheuer von den 15. Husaren, der später als Gerichtsassessor in Coblenz wieder mit mir zusammentraf. Sein Pferd fiel beim Tränken in den Mühlenteich, sodass man nur noch die Ohrenspitzen sah, und konnte nur mit vieler Mühe gerettet werden. Er selbst ist später als Aachener Amtsgerichtrat in der Nähe der Kölner Hütte bei Karersee verunglückt und es musste ihm in Innsbruck ein Bein amputiert werden. –
Dann gings weiter hinauf und es folgte eine kalte Nacht ohne Stroh am Rande des Bois des Ognons nahe bei Gravelotte. Das Abendessen wurde durch stramme Haltung ersetzt, denn wir befanden uns in solcher Nähe eines grossen französischen Feldlagers, dass man den Schein der Lagerfeuer deutlich sehen und das dort herrschende Leben deutlich hören konnte. Ein merkwürdiger Kontrast. Bei uns Grabesstille und tiefes Dunkel, drüben ununterbrochener Lärm, Musik und Getöse. Ich meine sogar, ich hätte nicht nur die Marseillaise, sondern auch die Freischütz-Ouverture spielen hören. –
Kaum graute der Tag, so hörte man von neuem Hornsignale und lebhafte Bewegung, aber der unserseits erwartete Angriff blieb so lange aus, dass ich im Laufe des Vormittags den Befehl erhielt, mit einigen Füsilieren, zu denen auch mehrere Offiziersburschen gehörten, nach Ars sur Morselle hinunter zu marschieren, um das dort für das Bataillon gebackene Brot zu holen. Das Brot war noch im Backofen und ich benutzte die Wartezeit, um den Ort nach käuflichen Lebensmitteln abzusuchen. Viel gab es nicht, indessen gelang es mir, einige Flaschen Rotwein, 2 Flaschen Chartreuse (Kräuterlikör) und ein paar Tafeln Chocolat Monier aufzutreiben. Während ich aber noch so beschäftigt war, hörte ich von Gravelotte her immer heftiger werdenden Kanonendonner. Was tun? Nach kurzer Ueberlegung beschloss ich das Brot im Backofen zurückzulassen. Den schönen Rotwein konnten wir leider nicht mitnehmen, ich steckte nur meinen Burschen eine Flasche Chartreuse in den Brotbeutel, barg die Chocolade unter dem Waffenrock auf meiner Brust und begab mich auf die Suche. Aus Seite 315 der Regimentsgeschichte ersah ich, dass das Regiment um 2 Uhr nachmittags in Marsch gesetzt worden war, und es muss also zwischen 2 und 3 Uhr gewesen sein, als ich auf der Hochfläche wieder angelangt war. Dicht beim Dorfe Gravelotte stiess ich auf eine feuernde Batterie unserer Divisionsartillerie und erfuhr dort, wohin ich mich zu wenden hatte. –
In Bois des Ognons traf ich die 1. & 4. Kompagnie beim Abstieg ins obere Mance-Tal und hatte meine Leute noch nicht wieder einrangiert, als wir auch schon ins Feuer kamen. Ein Mann – ich meine es wäre ein Hornist gewesen, vielleicht aber auch der Unteroffizier Künnemeyer von meiner Kompagnie – fiel lautlos hinten über, und der brave Unteroffizier Hausmann (s. Saarbrücken) sagte auf einmal »Hä« (ganz kurz), griff mit der rechten Hand nach seinem linken Ellenbogen und verschwand im Hintergrunde. Wir überschritten die ausgetrocknete Mance und stiegen auf der anderen Seite den Hang des Bois de Vaux hinan, um dessen Ostrand zu besetzen, wo vor uns schon andere Truppenteile im Gefecht gewesen waren. Am Waldrande schwärmte das Halbbataillon zu beiden Seiten eines ins freie führenden Fusspfades in die dort befindlichen Gräben und harrte der Dinge, die da kommen sollten, während von hinten die Granaten unserer Artillerie fortwährend über unsere Köpfe sausten und zischten. Halblinks vor uns hatten wir, nur etwa 600 Schritt entfernt, die berühmt gewordene Ferme (Gehöft) St. Hubert, halb rechts die vielgenannte Steinbrücke von Rozerieulles, vor uns, gegenüber Point du jour, eine sanft ansteigende, nur von einigen Kiesgruben unterbrochene, sonst auf 1200 Schritt ganz deckungslose Fläche bis zu den etagenweise übereinander eingegrabene Schützenlinien des Feindes. Zum Schusse kamen wir fast gar nicht, bekamen aber jedes Mal Feuer, sobald wir uns blicken liessen. –
Ein paar Schritte links von mir lag ein Verwundeter von einem anderen Regiment und hatte noch sein Gewehr auf dem Rande der Böschung liegen. Er war durch die Schläfe geschossen, sodass man das Gehirn hervorquellen sah, und gab noch Lebenszeichen von sich, indem er sich mit der Hand über die Schläfe wischte. Bald wurde er ganz still. Mir selbst streifte eine Chassepotkugel über die Stiefelsohle, ohne irgendwelchen Schaden zu tun. Oberst Eskens, sein Adjutant Fleischhammer mit zerschossener Helmspitze und einige andere Offiziere standen beobachtend am Ausgang des Waldes, aber Eskens, dessen Leibesbeschaffenheit den feindlichen Geschossen eine besonders breite Fläche bot, meinte nicht mit Unrecht: »Kommen Sie, meine Herren, hier ist nicht gut sein«, und zog sich ebenfalls in die Deckung zurück. Bald kam auch Hauptmann Köppen, der mit dem anderen Halbbataillon in den Kiesgruben gekämpft hatte, mit blutigem Notverband um die rechte Hand und sagte: »Seht ihr wohl, man ist nicht gleich tot«, begann aber doch zu schwanken und musste von 2 Füsilieren abgeführt werden. Die Gefechtslage in der er seine Wunde davontrug, ist auf dem Gemälde von Professor Hünten in der Düsseldorfer Kunsthalle dargestellt. Die Zersplitterung der Hand erwies sich nachher als eine schwere und es dauerte bis in den Februar 1871, ehe er wieder zum Regiment zurückkehren konnte. –
Gegen 7:30 Uhr abends hörte man aus der Ferne das immer näher kommende, von Hornist zu Hornist weitergegebene Signal »Das Ganze avancieren (vorrücken)«, man hörte irgendwo eine Regimentsmusik den Avancier-Marsch spielen, man hörte ferner und näher Hurrageschrei und jetzt erst merkten wir, dass wir uns inmitten eines gewaltigen Völkerringens befanden. Mit einem befreienden Hurra stürmten nun auch wir die 4. Kompagnie unter Führung des Premierleutnants Hesse möglichst gebückt übers freie Feld vorwärts bis in eine der Kiesgruben 250 Schritt vor Point du jour. Es dunkelte bereits und als nun von halb rechts ein Schwarm von menschlichen Gestalten auf uns zugelaufen kam, da fingen unsere Füsiliere ohne Kommando zu schiessen an, bis wir durch Rufe verständigt wurden, dass es sich um versprengte preussische Soldaten verschiedener Truppenteile handelte. –
Gegen 9 Uhr abends führte Hesse die Kompagnie bis vor den Waldrand zurück, wo das Bataillon sich wieder sammelte und die Gewehre zusammengesetzt wurden. Jetzt erst war der Augenblick gekommen, wo ich den Becher mit Chartreuse im Kreise der Offiziere kredenzen konnte, und als ich mich nun auch meiner Chocolade erinnerte, da griff ich zwar unter dem Waffenrock in eine breiige Masse, aber schmecken tats doch und ich sollte den Rest meiner Kräfte ja auch noch nötig haben.-
»Während ein Teil der Leute sich bereit hielt, etwaige Vorstösse der Franzosen zurückzuweisen, suchte ein anderer Teil das vorliegende Feld nach Verwundeten ab und trug sie nach den am Waldrande eingerichtete Verbandsplätzen zusammen.« So heisst es auf Seite 329 der Regimentsgeschichte, und dieser Teil bestand aus je einem Zuge der 3. & 4. Kompagnie unter Führung des Vicefeldwebels Witting, u. des Offiziersdiensttuenden Unteroffizier Viebig; aber kein dritter kann ahnen, welch überwältigende Eindrücke hinter diesen nüchternen Worten verborgen sind. Wir liessen sämtliche Waffen u.s.w. zurück und nahmen nur die Mäntel mit. Im Hintergrunde die lodernden Flammen von Moscou, St. Hubert und Point du jour und noch vier anderer Feuerstellen mit rotem Widerscheine, daher im Vordergrunde trotz sternenklaren Himmels tiefe Finsternis, von allen Seiten die Jammerrufe »Ach kommt doch, holt mich doch.« Alle Augenblicke stiess man mit dem Fusse gegen einen Toten oder Verwundeten und beugte sich nieder um zu sehen, ob er noch lebte oder nicht. Da habe ich in manches brechende oder gebrochene Auge geschaut, manchem schwer getroffenen Mut zugesprochen, und wenn sich Witting darüber wunderte, wie ich das konnte, dann musste ich mich selbst darüber wundern. Alle Müdigkeit war vergessen, ich fühlte überhaupt keine Knochen mehr, schwebte wie ein körperloser Schatten übers Feld und tat wie im Traume das Selbstverständliche, als hätte ich nie etwas Anderes getan. Noch Heute ist’s mir manchmal so, als hätte ich das ganze geträumt. –
Die leichter Verwundeten wurden sitzend von je 2 Füsilieren auf den verschlungenen Händen getragen und so wie auf einer Bahre zum Verbandplatz getragen, der freilich einstweilen nur in der Idee existierte. Weit und breit war kein Lazarethgehülfe (jetzt sagt man Sanitätssoldat), geschweige denn ein Arzt zu finden. Die ganze Hülfeleistung bestand zunächst darin, dass die Verwundeten so gut es ging auf der Erde gebettet wurden und wenigstens den schwachen Trost des Beisammenseins hatten. Nicht einmal Wasser konnten wir schaffen, um den brennenden Durst zu stillen, denn die ersten nach Gravelotte geschickten Leute kamen mit leeren Kochgeschirren zurück. Vergeblich hatten sie sich um den Zutritt zu den Brunnen geprügelt, die doch statt Wasser nur noch Jauche von sich gaben. Erst bei Tagesanbruch konnte Leutnant Kohtz, das sogenannte Kötzchen die Verwundeten mit Wasser erquicken. –
Etwa 60 bis 80 Verwundete hatten Witting und ich zusammengebracht, als wir uns von neuem weiter vorwärts auf die Suche machten. In unserem Eifer hatten wir nicht bedacht, wie nahe wir den französischen Stellungen waren, und auf einmal krachte aus nächster Nähe eine Salve über uns hinweg. Alles lief sauve qui peut (rette sich, wer kann!) nach dem Walde zurück, es gab ein allgemeines Durcheinander, die Gewehrpyramiden wurden umgerannt und das ganze Bataillon ging in die am Nachmittag besetzt gehaltenen Schützengräben zurück, wo ich alsbald in hockender Stellung in einen kurzen, aber tiefen Schlaf versank. Um 3 Uhr morgens verliess das Regiment seine Stellung und die Verwundeten mussten trotz ihrer Rufe »Nehmt uns doch mit« bis auf weiteres ihrem Schicksal überlassen werden. Wir traten den Rückmarsch nach unserem früheren Biwakplatz an, aber mein Helm, mein Mantel und mein Degen waren nicht mehr zu finden und ich musste mich mit dem, was man gerade auf dem Felde fand, einem Offiziershelm ohne Vorderschiene, einem Mantel mit fremder Nummer und andersfarbiger Achselklappe und einem Degen ohne Scheide, der mich beim Gehen jeden Augenblick in die Beine stach, begnügen. Auch ein kleines silbernes Essbesteck in rotem Leder hatte mein Bursche für mich erobert und erst gegen Ende des Feldzugs, als eines Tages die erste Kompagnie bei uns zu Gaste war, entdeckte der Leutnant der Reserve H. von der Leyen aus Crefeld in meiner Hand – sein längst verloren geglaubtes Eigentum. Ich selbst hatte beim Aufsuchen der Verwundeten 2 blutbefleckte Generalstabskarten gefunden, die mir während der Belagerung von Metz noch manche gute Dienste leisteten und mitsamt dem eingetrockneten Blute noch heute in meinem Besitze sind. Dann stiegen wir wieder in die Mance-Schlucht hinab und nahmen unseren Weg bachaufwärts bis zu der denkwürdigen Chaussee-Enge zwischen St. Hubert und Gravelotte, wo jetzt das wirkungsvolle Denkmal der 8. Jäger steht. Zwischen zerfetzten Bäumen, aufgehäuften Leichen, toten Pferden, zerbrochenen Geschützen und Fahrzeugen wanden wir uns im ersten Tagesgrauen nach Gravelotte hindurch und neben mir rasten fortwährend die Lazarethwagen auf u. ab. Im Dorfe – ich habe es zuletzt am 18. August 1911 von Lorry aus noch einmal wiedergesehen – lagen auf den Düngerhaufen vor den überfüllten Häusern ganze Reihen von Verwundeten, und man war froh, als wir wieder draussen auf den Biwakplatz gelangten. Sofort liess ich mich in eine Ackerfurche fallen und streckte alle Viere von mir, aber es dauerte nicht lange so erwachte ich wieder und sah wie durch einen grauen Schleier ein paar Reiter dicht vor mir halten. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und erkannte den alten Steinmetz, der vom Pferde herab zu uns sagte: »Na Kinder, Ihr habt Euch brav geschlagen, aber nun auch die Mäntel rollen, es kann gleich wieder losgehen.« Wir waren empört. Er hatte ja recht, denn noch niemand wusste bei uns, dass auf dem linken Flügel bei St. Privat (Anm. 44) die Entscheidung bereits gefallen war; aber dass er bei unserer Stimmung ans Mäntelrollen dachte, das entlockte uns manchen stillen Fluch. Gott sei Dank war’s auch überflüssig, denn bald erschien sogar unsere Bagage und auch die heissersehnte Proviantkolonne und man begann allmählich wieder etwas Mensch zu werden. –
Die Feldpost im Dorfe bekam nun bald genug zu tun. Am 19. schrieb ich nur einige Worte, am 20. aber auf zwei Feldpostkarten einen längeren Bericht, der zugleich die erfreuliche Meldung enthielt, dass ich am letzteren Tage zum Vicefeldwebel befördert worden war. Bis zur Ankunft dieser Karten, die erst am 25. u. 26. August in Düsseldorf eintrafen, waren die Eltern in begreiflicher Unruhe. Sie hatten sich eingebildet, dass wir 39er nach Spichern länger in der Reserve bleiben und nicht sobald wieder in’s Feuer kommen würden, und als nun gar ein Angehöriger des Regiments nach Düsseldorf gelangte, der mich am 18. beim Beginn der Schlacht gesund und munter gesehen hatte, nachher aber zufälligerweise nicht mehr mit mir zusammengetroffen war, da war die Not natürlich doppelt gross. »Nach Tagen bängster Sorgen um dich«, so schrieb mein Vater am 26. August, »erhielten wir endlich gestern Deine ersten Zeilen vom 19. und dankten Gott aus Herzensgrunde, dass Du abermals so wunderbar erhalten geblieben.« Unter Vaters Brief vom 28., der mich zugleich über die allgemeine Kriegslage unterrichtete, schrieb auch Clara mit kindlichen Buchstaben, die ich von ihrer Hand besitze. »Herzlichen Gruss von deiner dichliebenden und oftgedenkenden Schwester Clara Viebig.« Auch Herr Limbourg aus Bitburg, dessen Sohn Joseph sich als Vicefeldwebel bei der 2. schweren Reservebatterie der Gardelandwehrdivision an der Beschiessung von Strassburg beteiligte, gratulierte mir am 28. August, dass der liebe Gott mich so sichtlich in seinen Schutz genommen habe und sprach die Hoffnung aus, dass der jetzige Kampf eine entscheidende Abrechnung mit Frankreich bringen und uns die Früchte des Sieges dauernd sichern möge. Mein Kollege Referendar Hugo Wirtz schrieb an demselben Tage: »wie sich unsere guten vergnügungssüchtigen fidelen Düsseldorfer verändert haben«, musste aber in demselben Briefe leider auch berichten, wie sich das Interesse der krankenpflegenden jungen Damen – er nennt die Namen Hagedorn, Jäger und von Sybel – hauptsächlich den Franzosen zugewandt und dies sogar »einen furchtbaren Sturm in den Zeitungen« hervorgerufen habe. –
So weit waren wir nun freilich noch nicht, und doch ersehe ich aus meinen eigenen Feldpostkarten, dass auch wir Krieger selbst schon von baldiger Beendigung des Feldzuges träumten und mindestens auf baldige Quartiere statt des »ewigen Biwakierens hofften.« Auch mein Vater schrieb schon vor dem 26. August: »Wären nur Metz u. Strassburg erst in unseren Händen, dann dürfte der Krieg bald sein Ende erreicht haben. Um die Herausgabe von Elsass u. Lothringen dürfte es sich beim Friedensschluss hauptsächlich handeln, – und Elsass wäre das mindeste!« – Die grossen Schlachttage waren freilich für uns vorbei und ich habe von jetzt ab nur noch kleinere Gefechte mitgemacht; aber töter wie tot kann man schliesslich nicht geschossen werden und dazu fand sich auch auf Vorposten und Patrouillengängen noch reichlich Gelegenheit. Kein Mensch ahnte damals, wie lange die Geschichte noch dauern sollte und mit Recht sang Emanuel Geibel (Anm. 45):
»Wir träumen nicht von raschem Sieg,
Von leichten Ruhmeszügen;
Ein Weltgericht ist dieser Krieg
Und stark der Geist der Lügen;
Doch der einst unsrer Väter Burg
Getrost, er führt auch uns hindurch,
Vorwärts!