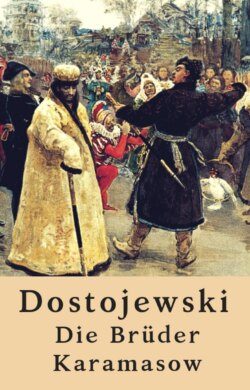Читать книгу Die Brüder Karamasow - Fjodor Dostojewski - Страница 8
4. Der dritte Sohn Aljoscha
ОглавлениеEr war damals erst zwanzig Jahre alt; sein Bruder Iwan war im vierundzwanzigsten, ihr ältester Bruder Dmitri im achtundzwanzigsten Lebensjahr. Zuallererst erkläre ich, dieser Aljoscha war ganz und gar kein Fanatiker und ebensowenig ein Mystiker, nach meiner Meinung wenigstens. Ich will von vornherein meine Ansicht rückhaltlos aussprechen. Er war einfach ein jugendlicher Menschenfreund, und wenn er ins Kloster ging, so nur, weil allein dieser Weg zu jener Zeit seine Bewunderung erregte und sich seiner aus der dunklen Schlechtigkeit der Welt zum Licht der Liebe strebenden Seele gewissermaßen als idealer Ausweg anbot. Ihm imponierte dieser Weg nur deswegen, weil er auf ihm einer – wie er meinte – ungewöhnlichen Persönlichkeit begegnet war, unserem berühmten StarezStarez – »der Alte«, in der russ.-orthodoxen Kirche ein Mönch in der höchsten asketischen Stufe Sossima, an den er sich mit der ganzen unersättlichen Leidenschaft der ersten Liebe anschloß. Ich bestreite allerdings nicht, dass er auch damals schon ein sonderbarer Mensch war, eigentlich von der Wiege an. Ich habe bereits erwähnt, dass er sich sein Leben lang an seine Mutter erinnerte, an ihr Gesicht und an ihre Liebkosungen, »ganz als ob sie lebendig vor mir stünde« und das, obwohl sie gestorben war, als er noch nicht vier Jahr alt war. Solche Erinnerungen bleiben bekanntlich aus noch früherer Zeit, aus dem zweiten Lebensjahr sogar, haften, aber sie treten das ganze Leben hindurch nur wie helle Punkte aus dem Dunkel hervor, wie ein abgerißnes Eckchen von einem großen Gemälde, das ganz verblichen und verschwunden ist bis auf dieses Eckchen. Genauso war es bei ihm; er erinnerte sich an einen stillen Sommerabend, an ein geöffnetes Fenster, an die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne (die schrägen Strahlen hatte er am deutlichsten im Gedächtnis), an das Heiligenbild, das brennende Lämpchen in der Ecke des Zimmers, davor seine Mutter, sie lag auf Knien und schrie, umschlang ihn mit beiden Armen und drückte ihn an sich, dass es ihm weh tat; dann betete sie für ihn zur Muttergottes, dabei streckte sie ihn mit beiden Händen dem Heiligenbild entgegen, als wollte sie ihn unter den Schutz der Muttergottes stellen, und dann kam plötzlich die Kinderfrau und riß ihn von der Mutter weg. Das war das Bild, das ihm vor Augen stand! Aljoscha wußte auch noch, wie das Gesicht der Mutter in jenem Augenblick ausgesehen hatte: verzückt, aber schön, soweit er sich erinnern könne. Aber nur selten vertraute er jemandem diese Erinnerung an. In seiner Kindheit und seinen Jugendjahren war er wenig mitteilsam, sogar wortkarg, aber nicht aus Schüchternheit und finsterer Menschenscheu, sondern aus einer Art Innerer, rein persönlicher Sorge, die andere Menschen nichts anging, aber für ihn selbst so wichtig war, dass er um ihretwillen die anderen gewissermaßen vergaß. Er liebte die Menschen; er schien ihnen sein ganzes Leben hindurch zu vertrauen, und dabei hielt ihn nie jemand für beschränkt oder naiv. Etwas war in ihm, was nachdrücklich bekundete (auch in seinem ganzen späteren Leben), dass er nicht über die Menschen richten und sie um keinen Preis verdammen wolle. Da er unter keinen Umständen jemand verdammte, schien es sogar, als halte er alles für berechtigt, obgleich er oft tieftraurig war. Mehr noch: in diesem Sinn ging er so weit, dass ihn niemand erstaunen oder erschrecken konnte, und das schon seit seiner frühesten Jugend. Als er mit zwanzig Jahren zu seinem Vater kam und geradezu in eine schmutzige Lasterhöhle geriet, entfernte er sich immer nur schweigend, wenn er in seiner Reinheit etwas nicht mehr mit ansehen konnte, aber ohne das geringste Zeichen von Verachtung oder Verdammung für irgendwen. Sein Vater, der als ehemaliger Kostgänger ein feines Ohr für Beleidigungen besaß, war ihm gegenüber zwar anfangs mißtrauisch und mürrisch (»Der schweigt mir zuviel und denkt zuviel im stillen«), ließ das aber bald, schon nach etwa vierzehn Tagen, und begann Ihn schrecklich oft zu umarmen und abzuküssen. Trotz aller Säufertränen und der Betrunkenenrührseligkeit sah man doch, dass er ihn so tief und aufrichtig liebgewonnen hatte, wie es wohl niemand von seinem Schlag gelingen würde.
Alle Menschen liebten diesen Aljoscha; das war so schon von seinen Kinderjahren an. Als er im Hause seines Wohltäters und Erziehers Jefim Petrowitsch Poljonow lebte, nahm er dessen gesamte Familie derart für sich ein, dass man ihn wie ein eigenes Kind behandelte. Und er war so jung in dieses Haus gekommen, dass man bei ihm weder berechnende Schlauheit und Intrigantentum erwarten konnte noch die Kunst, sich einzuschmeicheln und andere zu gewinnen. Die Gabe, sich besondere Zuneigung zu erwerben, war ungekünstelt, unmittelbar, sie machte gleichsam einen Teil seiner Natur aus. Ebenso erging es ihm in der Schule, eigentlich gehörte er doch gerade zu jenen Kindern, die bei ihren Kameraden Mißtrauen, manchmal Spottlust, wenn nicht gar Haß erwecken. Er war ein Grübler und sonderte sich oft von den anderen ab. Er zog sich von Kindheit an gern in einen Winkel zurück und las, und trotzdem schätzten ihn seine Kameraden derart, dass man ihn als Liebling aller bezeichnen konnte. Selten war er ausgelassen, selten auch nur lustig; aber alle sahen mit einem Blick, das zeugte durchaus nicht von Mißmut, sondern von Ausgeglichenheit und Ruhe. Er wollte sich unter seinen Altersgenossen nicht hervortun und fürchtete sich vielleicht gerade deshalb vor keinem. Die Knaben merkten indes sofort, dass er sich mit seiner Furchtlosigkeit nicht brüstete: Er schien sich seiner Kühnheit und Unerschrockenheit gar nicht bewußt zu sein. Beleidigungen vergaß er rasch. Es kam vor, dass er einem, der ihn gekränkt hatte, nach einer Stunde so vertrauensvoll und ruhig antwortete oder selbst ein Gespräch mit ihm anfing, als wäre überhaupt nichts zwischen ihnen vorgefallen. Nie hatte es in solchen Fällen den Anschein, er hätte die Beleidigung zufällig vergessen oder absichtlich verziehen; er hielt sie einfach nicht für eine Beleidigung, und das besonders entwaffnete die Kameraden und unterwarf sie ihm. Ein Charakterzug aber erregte von der untersten Klasse des Gymnasiums bis zur obersten die Necklust seiner Kameraden, nicht aus Bosheit, sondern weil es sie amüsierte. Das war seine ungekünstelte, fanatische Schamhaftigkeit. Er konnte gewisse Worte und Gespräche über Frauen nicht vertragen, und diese »gewissen« Worte und Gespräche sind in den Schulen leider unausrottbar. Knaben, unverdorben und fast noch Kinder, reden zuweilen in den Klassen ganz laut von Dingen, von denen nicht einmal Soldaten sprechen; ja, die Soldaten wissen und verstehen oft vieles nicht, was auf diesem Gebiet schon den jungen Kindern unserer gebildeten höchsten Gesellschaftskreise bekannt ist. Moralische Verderbtheit braucht das nicht zu sein, auch nicht echter, im Innersten schamloser Zynismus; es ist ein äußerlicher Zynismus, der als interessant oder elegant, als forsch und nachahmenswert gilt. Als die Kameraden sahen, dass sich Aljoschka Karamasow die Ohren zuhielt, sobald sie von »solchen Dingen« zu reden begannen, stellten sie sich manchmal absichtlich dicht um ihn herum, rissen ihm die Hände von den Ohren und schrien die Unanständigkeiten. Aljoscha machte sich frei, ließ sich zu Boden fallen, verbarg sich, ohne ein Wort zu sagen, ohne zu schimpfen: Er ertrug die Beleidigung schweigend. Erst gegen Ende der Schulzeit ließen sie ihn in Ruhe und hänselten »das Mädchen« nicht mehr; sie blickten eher mitleidig auf ihn herab. Übrigens war er, was das Lernen anlangte, einer der Besten, doch niemals ausdrücklich Erster.
Nach Jefim Petrowitschs Tod blieb Aljoscha noch zwei Jahre auf dem Gymnasium der Gouvernementsstadt. Jefim Petrowitschs Witwe begab sich mit der ganzen, nur aus weiblichen Personen bestehenden Familie für längere Zeit nach Italien, und Aljoscha kam in das Haus zweier Damen, entfernter Verwandter Jefim Petrowitschs, die er bis dahin nie gesehen hatte – unter welchen Abmachungen, das wußte er selbst nicht. Ein charakteristischer, sogar sehr charakteristischer Zug an ihm war, dass er sich nie darum kümmerte, auf wessen Kosten er lebte. In diesem Punkt war er das direkte Gegenteil seines älteren Bruders Iwan Fjodorowitsch, der sich die ersten beiden Universitätsjahre kümmerlich durch eigene Arbeit ernährte und es von Kindheit an als bitter empfand, aus der Tasche eines Wohltäters leben zu müssen. Man durfte jedoch diesen seltsamen Zug an Alexejs Charakter nicht allzu streng beurteilen; jeder, der ihn näher kennenlernte, konnte bei einem Gespräch über dieses Thema feststellen, dass Alexej so etwas wie ein »frommer Narr« war. Wäre ihm plötzlich ein Kapital zugefallen, er hätte es sicherlich unbedenklich auf die erste Bitte weggegeben, sei es zu einem guten Zweck, sei es, weil ein geschickter Schwindler ihn darum ersuchte. Überhaupt schien er den Wert des Geldes nicht zu kennen – selbstverständlich meine ich das nicht im buchstäblichen Sinn. Wenn er Taschengeld bekam (worum er niemals bat), so wußte er entweder wochenlang nichts damit anzufangen, oder er ging so erschreckend achtlos damit um, dass es im Nu verschwunden war. Pjotr Alexandrowitsch Miussow, der ein feines Gefühl für Geld und bürgerliche Ehrenhaftigkeit besaß, sagte später einmal über Alexej: »Er ist vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der, plötzlich allein und ohne Geld auf einen Platz in einer fremden Millionenstadt verschlagen, bestimmt nicht umkommen würde. Man würde ihm sofort Nahrung und Unterkunft gewähren; täten es die Leute nicht von allein, würde er sich selbst bei jemand unterbringen, was ihn nicht die geringste Überwindung kosten und keine Erniedrigung für ihn bedeuten würde. Und, die ihn aufnähmen, wurden das nicht als Last, sondern im Gegenteil vielleicht als Vergnügen empfinden.«
Das Gymnasium beendete er nicht; es fehlte ihm noch ein ganzes Jahr, als er den Damen auf einmal erklärte, er wolle zu seinem Vater fahren: in einer Angelegenheit, die ihm eingefallen sei. Den Damen tat das leid, sie wollten ihn gar nicht weglassen. Die Fahrt kostete nur wenig, und die Damen erlaubten ihm nicht, seine Uhr, die ihm die Familie seines Wohltäters vor ihrer Abreise ins Ausland geschenkt hatte, zu versetzen. Sie statteten ihn reichlich mit Geld aus, versorgten ihn sogar mit neuen Kleidern und neuer Wäsche. Die Hälfte des Geldes gab er ihnen jedoch mit der Erklärung zurück, er wollte unbedingt dritter Klasse fahren. Nach der Ankunft in unserem Städtchen gab er seinem Vater auf die Frage, warum er eigentlich vor Abschluß des Gymnasiums gekommen sei, überhaupt keine Antwort; er war nur ungewöhnlich nachdenklich. Bald stellte sich heraus, dass er das Grab seiner Mutter suchte. Er gab damals sogar selber zu, nur deshalb gekommen zu sein. Aber das dürfte schwerlich der einzige Grund gewesen sein. Wahrscheinlich wußte er selbst nicht, was plötzlich in seiner Seele erwacht war und ihn unwiderstehlich auf einen neuen, unbekannten, aber schon unvermeidlichen Weg zog. Fjodor Pawlowitsch konnte ihm nicht zeigen, wo seine zweite Frau begraben lag; er war nicht wieder an ihrem Grab gewesen, seit man den Sarg zugeschüttet hatte, und während der vielen dazwischenliegenden Jahre hatte er völlig vergessen, wo sie beerdigt worden war.
Bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte über Fjodor Pawlowitsch. Er hatte vor Aljoschas Ankunft lange nicht in unserer Stadt gelebt. Drei oder vier Jahre nach dem Tode seiner zweiten Frau war er nach Südrußland gegangen, zuletzt nach Odessa, wo er mehrere Jahre verbrachte. Anfangs hatte er dort, wie er sich ausdrückte, »viele Juden und Jüdchen« kennengelernt, und zuletzt war er nicht nur »bei Juden, sondern auch bei den Hebräern ein und aus gegangen«. Es ist anzunehmen, dass er sich in dieser Periode seines Lebens die besondere Kunst zu eigen machte, Geld zusammenzuscharren, indem er es anderen Leuten abgaunerte. Erst drei Jahre vor Aljoschas Ankunft kehrte er für immer in unser Städtchen zurück. Seine früheren Bekannten fanden ihn sehr gealtert, obgleich er durchaus noch nicht alt war. Er benahm sich aber keineswegs anständiger, sondern noch schamloser als früher. So zeigte sich zum Beispiel bei dem früheren Possenreißer das Bedürfnis, sich andere als Possenreißer zu halten. Bei den Weibern verhielt er sich nicht wie früher nur schamlos, sondern geradezu widerwärtig. Binnen kurzem eröffnete er zahlreiche neue Schenken in unserem Kreis. Er musste an die hunderttausend Rubel besitzen, jedenfalls nicht viel weniger. Viele Einwohner der Stadt und des Kreises wurden alsbald seine Schuldner, selbstverständlich nur gegen vollkommen sichere Pfänder. In der allerletzten Zeit bekam er ein aufgedunsenes Aussehen, er büßte seine Selbstsicherheit und Gleichförmigkeit ein und wurde irgendwie leichtfertig. So fing er das eine an, um bei etwas anderem zu enden, änderte unversehens seine Absichten und betrank sich immer häufiger. Hätte der Diener Grigori, der zu dieser Zeit ebenfalls schon ziemlich gealtert war, ihn nicht manchmal fast wie ein Erzieher beaufsichtigt, wäre Fjodor Pawlowitsch wohl in arge Unannehmlichkeiten geraten. Aljoschas Ankunft hatte auf ihn sogar eine moralische Wirkung, so als wäre in diesem früh vergreisten Menschen etwas erwacht, was lange betäubt in seiner Seele gelegen hatte. »Weißt du«, sagte er oft zu Aljoscha und starrte ihn dabei an, »dass du mit ihr, mit der Schreierin, große Ähnlichkeit hast?« (So nannte er seine verstorbene Frau, Aljoschas Mutter.) Ihr Grab zeigte Aljoscha schließlich der Diener Grigori. Er führte ihn in einen abgelegenen Winkel des städtischen Friedhofs und zeigte ihm eine Platte aus Gußeisen, nicht kostbar, aber sauber gearbeitet, mit Namen und Stand, Alter und Todesjahr der Verstorbenen; darunter stand ein vierzeiliger Vers: altertümliche Kirchhofspoesie, wie sie auf Gräbern von Leuten des Mittelstandes üblich ist. Zu Aljoschas Verwunderung war diese Platte eine Stiftung Grigoris. Er hatte sie auf eigne Kosten auf dem Grab der armen »Schreierin« anbringen lassen, nachdem Fjodor Pawlowitsch, dem er mehrfach mit Vorhaltungen wegen des Grabes zugesetzt hatte, nach Odessa gereist war und mit anderen Erinnerungen an die Vergangenheit auch den Gedanken an die Gräber getilgt hatte. Aljoscha zeigte sich am Grabe seiner Mutter nicht besonders empfindsam; er hörte sich Grigoris würdigen und gesetzten Bericht über das Anbringen der Platte an, stand ein Weilchen mit gesenktem Kopf und ging dann, ohne ein Wort gesagt zu haben. Seitdem war er vielleicht ein Jahr lang nicht mehr auf dem Friedhof gewesen. Auf Fjodor Pawlowitsch aber übte auch dieser kleine Vorfall seine Wirkung aus, und zwar eine sehr eigentümliche. Er nahm auf einmal tausend Rubel und brachte sie in unser Kloster: für Seelenmessen für seine Gattin – aber nicht für Aljoschas Mutter, die »Schreierin«, sondern für die erste, Adelaida Iwanowna, die ihn geprügelt hatte. Am Abend jenes Tages betrank er sich und schimpfte vor Aljoscha auf die Mönche. Er selbst war alles andere als ein religiöser Mensch; wahrscheinlich hatte er noch nie im Leben auch nur eine Fünfkopekenkerze vor einem Heiligenbild aufgestellt. Solche Typen haben eben mitunter sonderbare Gefühlsausbrüche und unvermittelte Einfälle.
Ich habe bereits gesagt, dass er sehr aufgedunsen war. Sein Gesicht war ein unbestechlicher Zeuge für die Art und den Inhalt seines bisherigen Lebens. Außer den langen, fleischigen Säckchen unter den ewig frechen, mißtrauischen und spöttischen kleinen Augen, außer den vielen und tiefen Runzeln auf seinem kleinen fetten Gesicht war da unter seinem spitzigen Kinn noch ein zweites, dick und lang wie ein Geldbeutel, was ihm ein widerliches, lüsternes Aussehen verlieh. Dazu kam noch der breite, sinnliche Mund mit den dicken Lippen, hinter denen die fast verfaulten Zähne als ganz kleine Stummel sichtbar wurden. Wenn er zu reden anfing, spritzte ihm der Speichel aus dem Mund. Übrigens machte er auch selbst gern Witze über sein Gesicht, obgleich er damit ganz zufrieden war, glaube ich. Besonders gern wies er auf seine Nase hin, die mittelgroß, sehr schmal und stark gekrümmt war. »Eine echte Römernase«, sagte er, »zusammen mit dem Doppelkinn das typische Abbild eines alten römischen Patriziers aus der Zeit des Verfalls.« Darauf war er offenbar stolz.
Kurz nachdem er das Grab seiner Mutter gefunden hatte, erklärte Aljoscha dem Vater, er wolle in das Kloster eintreten, und die Mönche seien bereit, ihn als Novizen aufzunehmen. Dies sei sein innigster Wunsch, und er bitte ihn als Vater um die förmliche Erlaubnis. Der Vater wußte bereits, dass der Starez Sossima, der zurückgezogen in der Einsiedelei des Klosters lebte, seinen »stillen Jungen« besonders beeindruckt hatte.
»Dieser Starez ist unter den hiesigen Mönchen allerdings der ehrenhafteste«, erwiderte er, nachdem er seinen Sohn schweigend und nachdenklich angehört hatte, ohne sich über dessen Bitte weiter zu wundern. »Hm. Da willst du also hingehen, mein stiller Junge!« Er war ziemlich betrunken und verzog auf einmal das Gesicht zu seinem breiten, halbtrunkenen Lächeln, in dem die Schlauheit und List des Säufers war. »Hm. Habe ich es doch geahnt, dass du schließlich dort enden würdest, kannst du dir das vorstellen? Dich zieht es ja geradezu dorthin. Na schön, meinetwegen. Du hast deine zweitausend Rubel, das ist deine Mitgift. Ich werde dich schon nicht im Stich lassen, mein Engel, und ich werde auch jetzt, wie sich's gehört, was für dich einzahlen, wenn sie es verlangen. Aber wenn sie es nicht verlangen – wozu dann aufdrängen, wie? Du brauchst ja nicht mehr Geld als ein Kanarienvogel, zwei Körnchen die Woche. Hm ... Weißt du, zu einem Kloster gehört eigentlich eine kleine Vorstadtkolonie, da wohnen, das ist allgemein bekannt, nur sogenannte ›Klosterweiber‹, so an die dreißig Frauenzimmer, glaube ich. Ich war mal da, weißt du, interessant in seiner Art, natürlich nur so als Abwechslung. Ekelhaft war nur, alles entsetzlich russisch, keine Französinnen, wo sie doch welche haben könnten, an Geld fehlt es nämlich nicht. Sobald die das erfahren, sind sie da. Na, aber hier ist nichts, hier gibt es keine Klosterweiber, hier gibt es nur an die zweihundert Mönche. Hier geht es anständig zu. Und gefastet wird auch, das muss man ihnen lassen ... Hm, also du willst zu den Mönchen gehen. Es tut mir leid um dich, Aljoscha, ich habe dich wirklich liebgewonnen, glaubst du es? Übrigens kommt mir die Sache auch gelegen; du kannst gleich für uns Sünder beten. Ich habe, so wahr ich hier sitze, viel zuviel gesündigt. Und dauernd habe ich gegrübelt: Wer wird einmal für mich beten? Gibt es einen solchen Menschen auf dieser Welt? Ich bin in dieser Hinsicht schrecklich dumm, du bist ein lieber Junge, du glaubst es wahrscheinlich gar nicht. Schrecklich dumm. Aber sieh mal, so dumm ich auch bin, ich denke immerzu daran, immerzu. Das heißt natürlich, ab und zu, nicht immerzu. Ausgeschlossen, denke ich dann, dass die Teufel mich vergessen und nicht mich mit ihrem Feuerhaken zu sich hinunterziehen, wenn ich sterbe. Na, und dann denke ich: Feuerhaken? Aber woher haben sie die? Und woraus sind die? Aus Eisen? Wo schmiedet man die denn? Sie haben wohl so eine Fabrik da bei sich? Die Mönche im Kloster glauben doch sicher, die Hölle habe zum Beispiel eine Art Zimmerdecke. Ich glaube aber nur an eine Hölle ohne Decke, das macht sich gleich viel feinsinniger und aufgeklärter, sozusagen lutherisch. Aber ist es im Grunde nicht ganz egal, ob die Hölle eine Decke hat oder nicht? Und doch liegt darin das ganze verdammte Problem. Wenn keine Decke da ist, so sind auch keine Feuerhaken da. Und wenn keine Feuerhaken da sind, dann stimmt das mit der ganzen Hölle nicht. Dann wird wieder alles unwahrscheinlich: Wer soll mich dann mit Feuerhaken hinunterziehen? Und wenn ich nicht hinuntergezogen werde, dann hört ja alles auf; wo bleibt da die Gerechtigkeit! Il faudrait les inventer, diese Feuerhaken speziell für mich, für mich allein! Wenn du eine Ahnung hättest, Aljoscha, was ich für ein Dreckskerl bin!«
»Es gibt dort keine Feuerhaken«, sagte Aljoscha leise und ernst, dabei sah er seinen Vater unverwandt an.
»Richtig, richtig, nur Schatten von Feuerhaken. Ich weiß es, ich weiß. Wie hat doch ein Franzose die Hölle beschrieben: »J'ai vu l'ombre d'un cocher qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'une carosse.Ich habe den Schatten des Kutschers gesehen, welcher mit dem Schatten einer Bürste den Schatten einer Kutsche reibt. Woher weißt du denn, mein Bester, dass es dort keine Feuerhaken gibt? Wenn du ein Weilchen bei den Mönchen bist, wirst du anders singen. Aber geh nur hin; arbeite dich zur Wahrheit durch, und dann komm her und erzähle – es fällt einem doch leichter, ins Jenseits aufzubrechen, wenn man genau weiß, was da los ist. Und es wird auch besser für dich sein, du wohnst bei den Mönchen und nicht bei mir, bei einem alten Säufer mitsamt seinen Frauenzimmern ... obwohl dich Engel ja nichts anficht. Na, vielleicht wird dich auch dort nichts anfechten; deswegen gebe ich dir auch die Erlaubnis, eben weil ich darauf hoffe. Dir hat ja der Teufel den Geist nicht angefressen. Du wirst entflammen und wieder verlöschen, wirst dich auskurieren und wieder zurückkommen. Und ich werde auf dich warten, denn ich fühle, du bist der einzige Mensch auf der Erde, der mich nicht verdammt hat. Du bist mein lieber Junge, das fühle ich, wie sollte ich das nicht fühlen?«
Er fing sogar an zu schluchzen. Er war sentimental. Schlecht und sentimental.